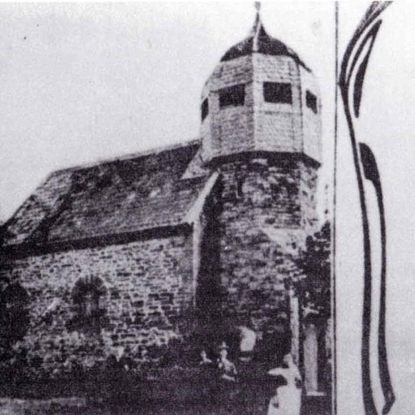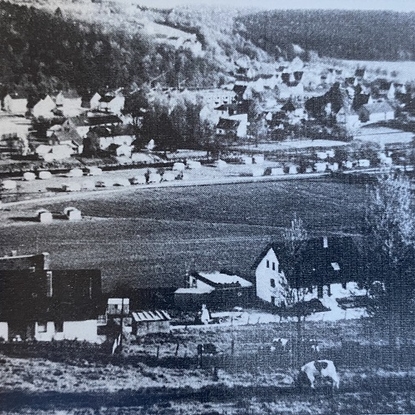Orte
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um die Karte von OpenStreetMap zu laden!
Filter
Die Agger ist ein Nebenfluss der Sieg. Ihre Quelle liegt in Meinerzhagen, nach 69,5 km mündet sie zwischen Siegburg und Troisdorf in die Sieg. Der Name Agger ist keltischen Ursprungs und bedeutet "fließendes Wasser"
Aggerhütte liegt im äußersten Norden des Stadgebietes., angrenzend zur Stadt Overath. Der Name enstammt einer Erzhütte zur Verhüttung von Kupfererzen im 18. Jahrhundert.1875 wohnten in Aggerhütte 9 Personen in 2 Häusern.
Algert
bei Inger: Der Ort liegt nordwestlich von Inger in einer Mulde auf dem Höhenrücken zwischen Jabach und Auelsbach. Das Algerter Feld grenzt im Westen an den sog. Ingerberg, der sich bis Lohmar erstreckt. Ein uralter Weg führt von Lohmar über den Ingerberg durch Algert nach Inger und weiter nach Birk.
Nach Dittmaier deutet das mundartliche „Alsched oder Aelsched“ auf „Altgerode“ hin. Allerdings lässt diese mundartliche Bezeichnung analog zu „Wahlsched“ auch die Ableitung auf eine Scheid-Siedlung zu. Tatsächlich wird die Siedlung auf der Wiebeking-Karte von 1790 Ahlscheid genannt.
Alle anderen urkundlichen Nachweise geben jedoch keinen Anhaltspunkt für diese Ableitung.
Sollte es zutreffen, daß Aldenach eine alte Bezeichnung für Algert ist (bei der Auftragung der Untersassen – siehe unten – wird dies mit einem Fragezeichen versehen), dann reichen die urkundlichen Nachweise bis 1395 zurück. In diesem Jahr, am 16. 5. 1395, nimmt Kunigunde, die Witwe Heinrichs von Aldenach, mehrere Ländereien im Kirchspiel Lohmar in Erbpacht, und zwar gegen einen Zins von 5 Malter Hafer.21 Noch weitere zweimal finden wir den Namen Aldenach: In einer Urkunde von 1468 machen „peter ind druede van aldenachen“ dem Kloster Seligenthal eine Stiftung. Bei der „Auftragung der Untersassen des Herzogtums Berg“ aus dem Jahre 1487 erklären sich „herman van aldenachen“ und „druede van aldenachen“ aus dem Kirchspiel Lohmar bereit, ihrem Herzog ein Dar-lehen zu geben. Zu den Mitbegründern der Birker Marienbruderschaft im Jahre 1503 gehören „Druyck van Aldenach, Johan van Altger“, ferner finden wir im Mitgliederverzeichnis „Peter van Alchet“. Es unterzeichnet als Brudermeister u. a. auch ein „Wilhelm von Altger“. Hier haben wir den besten Beweis dafür, daß Algert – wie Dittmaier eben vermutet – von Altgerode abgeleitet wird (Altgerode – Altger – Alsched). Nach dem Pastoratslagerbuch von Lohmar aus dem Jahre 1582 geben aus algert bzw. Alget jährlich „Christian Klein, goddert Köstgen, Joannes Henrich bloch, Meiß Jahns erben, alda pützer erben zwey hoener“ an den Pastor zu Lohmar.
Bei der Erstellung des Rent und Lagerbuches für das Amt Blankenberg im Jahre 1644 wirkt ein „Meis Hans Peter zu Algert“ als Geschworener des Kirchspiels Lohmar mit. Im gleichen Jahr werden auch neue Heberegister (Steuerlisten) angelegt. Besondere Erwähnung gebührt hier dem „Scheiffarts hoff zu Algert“, der um diese Zeit im Besitz des Bertram Scheifart von Merode zu Allner ist . Von diesem Hof sagt das oben erwähnte Rentund Lagerbuch: „Item in selbiger Hontschaft Ingern haben Ihrer Wohlgeb. noch einen Freyhof zu Algert gele-gen. Woraufer zu Felde ziehen 2 Pfert“. Daraus geht
hervor, dass dieser Hof ein adliges Freigut war, und nur der „Halfmann“, der jeweilige Pächter, von seinem Gewinn Abgaben zu entrichten hatte. Des-halb erscheint auch der „Halfman Heinrich“ im Heberegister. Außerdem sind „Meiß Johans Peter, Diedrich der Broder, Putzer Erben, Johan wegen seiner Schweiger Mutter, Adolph Flach und Lohmar Wilhelm zu Algert“ als abgabepflichtig genannt.
Auch im Verzeichnis der Vogteien aus dem Jahre 1646 (besondere Art von Abgaben) werden die o. g. Namen wieder erwähnt.
In die Erbhuldigungslisten lassen sich 1666 12 Personen aus Algert eintragen.
Weitere Schreibweisen erfahren wir aus den Taufbüchern von Lohmar: 1689 algerdt, 1699 Allgert und 1717 Algith.
Bei der Erstellung des Wertier und Landmaßbuches von Inger im Jahre 1711 wirkt als Wertiersmann (Landmesser) „Peteren Pütz von Alchet“ mit. Aus diesem Buch geht auch hervor, daß um diese Zeit der Landdinger von Proff im Besitz des oben erwähnten Scheifartshofes ist.
Weitere Namensbelege finden wir auf der Ploennis-Karte von 1715 AIget , im Wertier und Landmaßbuch von Lohmar aus dem Jahre 1746 all-get,32 auf der Wiebeking-Karte von 1790 Ahlscheid , auf einer Karte des Kirchspiels Lohmar von 1807 und auf der Tranchot-Karte von 1817 Algert.
Im Jahre 1829 hatte das Dorf Algert 150 Bewohner an 30 Feuerstellen, 1843 sogar 167 Bewohner in 34 Gebäuden. Von da an nimmt die Bevölkesrungszahl ständig ab; das Industriezeitalter beginnt und zieht die Landbewohner in die Städte. Werden 1851 auch noch 147 Einwohner gezählt, so wohnen 1872 nur noch 97 Personen in 22 Wohnhäusern.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Altenrath
(Stadt Troisdorf), eine weit verstreute Ortschaft am Rande der Heideter-rasse zwischen „Acher und Sülz“ an der „Alten Kölner Straße“ gelegen, die bei Euelen über die Sülz nach Pützrath, Donrath und weiter nach Haiberg führte. Von ihr zweigte in Altenrath ein Weg nach Burg und Ort Lohmar ab.
Altenrath wird häufig als die „alte Rodung“ bezeichnet. Nach Buck (Flurnamen, Seite 5) kann im Namen Altenrath aber auch der Personennamen „Alo“ enthalten sein. Danach wäre der Ort eine echte Rod-Siedlung, wie sie in der großen Rode-Epoche üblich waren. Aus der Namengebung darf man wohl mit ziemlicher Sicherheit schließen, daß es zur Zeit der ersten Rodungen zwischen 800-900 gewesen ist, als fränkische Bauern genau an den Stellen siedelten, an denen einst die Bewohner der Stein und Eisenzeit lebten.
Noch heute bestehende Flurbezeichnungen wie „Brand“ und „Brändchen“ deuten auf die Art der Rodung hin. Altenrath wurde nach „über valoris“ bereits im Jahr 1117 erwähnt. Der Pfarrer, besser gesagt die Pfarrstelle, wurde mit 4 Mark eingeschätzt. Wenn wir Binterim und Mooren (Bd. I, 31 u. 421) folgen, so (H. Schulte, Troisdorfer Jahreshefte 1972) bestand das Patrozinium schon zur Zeit Karls des Großen. Auch Rademacher schreibt: „Die Erbauung der Kirche und die Pfarrgründung erfolgten in den ersten Zeiten der Karolinger, wahrscheinlich schon in der Merowingerzeit. Leider ist von der ursprünglichen Kirche“, die wohl aus Holz errichtet war, „nichts erhalten“.
Den ältesten urkundlichen Nachweis finden wir, wie schon gesagt, 1117 im über valoris, wo es heißt: „Aldenroyde parochia tit. s. Mathaei et Georgii ... est consecreta 1117 ab archiepiscope“, die Pfarrkirche zu Altenrath ist 1117 vom Bischof konsekriert worden.
Eine Urkunde von 1197 nennt Aldenrade, eine andere aus der Zeit um 1300 wieder Aldenroyde.
Um diese Zeit bildet Altenrath einen Bezirk in der Herrschaft Löwenburg und gehörte den Grafen von Sayn. 1311 verkaufte Heinrich, Herr von Löwenberg, die Gerechtsame und niedere Gerichtsbarkeit von Aldenrade upper Heide an den Grafen Adolf von Berg für 160 Mark Brabantischer Denare.
Im Vasallenverzeichnis des Abtes Wolfard I. von Siegburg aus 1320 heißt es: „Item der edel Heinrich van Alpheim van der ghifft der kirchen van Aldenrade ind van dem zienden daeselffs was so viel bedeutet, daß Heinrich von Alpen der Abtei auch von seinem Geschenk der Kirche von Altenrath Abgaben oder Dienstleistungen zu entrichten habe. Aus einer Urkunde des Jahres 1333 geht hervor, daß Heinrich von Löwenberg „traget auf zu manlehn“ die Herrschaft Küdekoven, die „hongerich-te zu Alderadt“, Reidt, Caßel und Rodenkirchen Herrn „Wilhelmen Graven von Jülich“... „uns gegeben 1500 Marek, dry heller vor zwano vennige gerechent“.
Interessant sind weitere Schreibweisen aus Urkunden vom 27.5.1350 Aldenrait, vom 17.2.1351 Aldenroyde, vom 28.10.1353 Aldenraede und vom 3.2.1355 Aldenrade. In allen diesen Urkunden wird ein Rittergeschlecht „Winter von Aldenroide“ genannt. Der in der letzteren Urkunde genannte „Gottfried Winter von Aldenrade“ wird zwar im Siegburger Urkundenbuch als von Altenrath/Siegkr. stammend bezeichnet. Aber nach Lacomblet II und Fahne II soll dieses Geschlecht von einem im 19. Jh. verschwundenen Hof Altenrode bei Freimersheim an der Erft stammen, ferner besteht ein Burghaus Altenrath bei Gleuel.65 Gleichviel sollte die Ansicht des früheren Pfarrers von Altenrath, Delvos, nicht unerwähnt bleiben. Er meinte, daß, da während des Mittelalters mehrere edle Geschlechter im früheren Pfarrgebiet lebten, vielleicht ein Geschlecht seinen Namen von unserem Altenrath ableiten könnte. Möglicherweise habe der Stammsitz, der um 1500 in Köln lebenden Herren von Aldenroide, in Utzenrath gelegen.
Inzwischen war Dietrich von Blankenberg Verwalter des Altenrather Hochgerichts geworden. 1363 wurde das „kirspel Aldenraede“ von Dietrichs Nachfolger Gottfried von Dalenbroich an den Grafen Wilhelm von Berg verkauft. Damit gehörte Altenrath nun endgültig zum Herrschaftsbereich derer von Berg, von kleineren Unterbrechungen abgesehen.
Die Schreibweise Aldenrade wird 1370 im Vasallenverzeichnis des Abtes Wolfard II. zu Siegburg bekundet: „Item her Arnold van Hoenappel ritter van dem zienden der kirchen zo Aldenrade“. Die gleiche Schreibweise finden wir in einer Urkunde von 1402, aus der hervorgeht, daß ein Elias Weiter gegen den Pastor zu Aldenrade wegen Diffamierung klagt.70 Am 29. 4. 1413 verpfändet Johann von Loen, Herr von Heinsberg und Löwenburg, dem Ritter Johann von Landsberg das Kirchspiel und Gericht Altenrath mit allen Renten, Diensten und Einkünften, bis seine Schuldsumme an Ritter Johann bezahlt sei. Zur Zeit wird also Altenrath wieder von den Herren von Löwenburg verwaltet. Dies geht auch aus dem „Weistum aus der Löwen-burgischen Zeit“ von 1432 hervor. „Zo alden onzen
raede hait mann vnngeboden gedinghe gehalten“ im Namen eines „her vann leiffenburgh“ (Herr von Löwenburg) und „in lant leuenburgh“ (im Lande Löwenburg), heißt es in diesem Weistum.
Um 1470 schenkte Junker Stael von Haus Sülz vier Morgen Land „ahn der Kirchen zu Aldenraidt gelegen“ als sog. „Offergut“ für den Küster, den Offermann; ein Hinweis für die besonders engen Beziehungen des Hauses Sülz zur Pfarrkirche Altenrath während des ganzen frühen und späten Mit-telalters.
Im Jahre 1522 schenkten Wilhelm Plettenburgh von Schönrath und seine Gattin Barbara von Merode der Kirche zu Aldenradt einen Busch und Broich.
1566, vor dem 8. Aug., klagt ein Kerstien Boeckeschuis zu Altenrath beim Herzog von Jülich-Kleve-Berg, daß ihm ein gewisser Peter Bitter sieben Viertel Land von guter Qualität und mehr als 25 Goldgulden wert nach ei-nem Gerichtsbeschluß zu Kirchscheid abgenommen habe. Er bittet den Herzog, ihm in dieser Sache behilflich zu sein.74 Diese Urkunde bestätigt wiederum, daß Altenrath zum Herzogtum Berg gehört. Die in der Urkunde genannten Personen, Kerstien Boeckeschuis und Peter Bitter, treten in den Jahren 1560 bis 1565 als Anwälte bei den Kirchscheider Hofgedingen auf. Dies geht aus den Protokollen dieser Gerichtsverhandlungen hervor. Auch der o. g. Beschluß wird in den Protokollen bestätigt. Beide müssen in Alten-rath einen Hof besessen haben, gelegen „zum Berg“, einer Siedlung bei Altenrath. Am DreiKönigstag-1563 zahlt „kerst-genn borkennsthuis“ Abgaben an den Kirchsen 1636 unter Strafandrohung aufgefordert wurden, nach Siegburg zu-rückzukehren. So bedroht, baten die Altenrather Töpfer Wolfgang Wilhelm, Herzog von Berg, um Beistand. Dieser schrieb am 6.4.1637 an den Sieg-burger Abt und drohte mit Repressalien, wenn er die von Siegburg nach Altenrath verzogenen Töpfer nicht unbehelligt lasse.
Aus den Tauf-, Sterbeund Kopulationsbüchern Altenraths von 1653 bis 1809 geht hervor, daß viele Bewohner des Heidedorfes mit der Weberei beschäftigt waren; denn die Berufsbezeichnung „textor“ = Weber ist häufig anzutreffen. Nicht von ungefähr passen hierhin die Namen „Wäsche“ und „flasberg“ = Flachsberg.
Weitere Schreibweisen für Altenrath: 1645 Aldenraidt , 1670 und 1673 Aldenrade, desgl. Vischer 1690 . Die Ploennis-Karte von 1715 wie auch die Wiebeking-Karte von 1790 enthalten Dorf Altenrath. Nur auf der Tranchot-Karte von 1817 heißt es noch einmal Aldenrath.
Im Jahre 1829 zählte Altenrath (ohne Boxhohn, Sand, Schauenberg und Witzenbach) 475 Bewohner an 110 Feuerstellen, 1840 536 Bewohner (520 Kath., 16 Juden) an 113 Feuerstellen. Bis 1843 stieg die Bevölkerungszahl auf 600 (darunter 6 Juden), die Zahl der Gebäude auf 117. Diese Zahlen blieben bis 1871 konstant. 1872 wurden dagegen nur noch 538 Einwohner gezählt, jedoch 122 Wohnhäuser und 129 Haushaltungen. Mit Boxhohn (15), Sand (57), Schauenberg (8) und Witzenbach (4) hatte Altenrath 622 Einwohner und war damit größer als Lohmar (557 + 14 Lohmarhohn = 571 Einwohner).84
Dieser Abriß der Geschichte Altenraths wäre jedoch unvollständig, wollte man nach Altenraths langer Zugehörigkeit zum Amtsverband Lohmar, aus dem am 1.8.1969 die Gemeinde Altenrath ausschied und als Stadtteil nach Troisdorf kam, nicht wenigstens noch kurz die letzten Jahrzehnte ansprechen.
Mit dem Erlaß des Reichskriegsministeriums vom 17. 8.1936, Ort und Gemeinde Altenrath in den Truppenübungsplatz Wahn einzubeziehen, erfährt die über viele Jahrhunderte reichende Siedlungsgeschichte eine jähe Zäsur. Die Einwohner, seit Urahnenzeiten mit der angestammten Hei-mat eng verbunden, mußten sich finanziell abfinden lassen und räumen. Der Ort, von jedem Leben entblößt, galt über Jahre als Gespensterdorf. Dem damaligen Bürgermeister von Lohmar, Ludwig Polstorff, ist zu danken, daß nach Kriegsende im April 1945, die verbliebenen Häuser nicht der Ma-terialplünderung verfielen, sondern der Ort von Ausgebombten, Evakuierten und Flüchtlingen wiederbesiedelt werden konnte. So zählte Altenrath bereits 1961 (Volkszählung) 1244 Einwohner und 368 Haushaltungen.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Bachermühle liegt im Norden der Stadt Lohmar unmittelbar an der B 484 gegenüber der Einmündung der Kreisstraße nach Neuhonrath. Bachermühle war eine Wasserkornmühle, die im Mühlenverzeichnis des Amtes Blankenberg breits 1644 genannt wird. Die Mühle hatte 1858 11 Bewohner. 1871 wohnten hier 9 und 1875 15 Personen.
Quelle: Wilhelm Pape, Siedlungs- und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar, 1983
Die Siedlung liegt nördlich von Inger/Blrk am sanft zur Quellmulde des Jabaches sich senkenden Südrandes. Ob der Name von Bach abgeleitet werden kann, ist ungeklärt. Wenn auch 1790 der Ort mit Bach bezeichnet wird, so bedeutet dies nicht viel; denn die frühesten Nennungen Bechge und Bichgen lassen sich hier schlecht einordnen. In einer Urkunde vom 17.3. und 19. 5.1384 teilt der Dekan der Chrlstianität Siegburg dem Erzbischof Friedrich III. von Köln die Ergebnisse einer Untersuchung über die Güter und Einkünfte mit, die zwei neu zu gründenden Vikarien zu Siegburg zugewiesen werden sollen, „...ex bonis Henkini de Bechge sitls In Bachga in parrochia de Lomer“ = aus den Gütern des Henkin von Bechge, gelegen in Bich in der Pfarre Lohmar.
Eine weitere Schreibweise ergibt sich aus Dittmaiers Angabe de Bichgen aus der Zeit um 1400. Bei der Auftragung der Untersassen des Herzogtums Berg aus dem Jahre 1487 wird ein „hanness zer Bach“ aus dem Kirchspiel Lohmar erwähnt, der ebenfalls bereit ist, Herzog Wilhelm II. ein Darlehen zu geben104. Da Bach im Sülztal und Bach bei Neuhonrath ausscheiden, liegt die Vermutung nahe, daß hiermit Bich gemeint Ist. Man muß diese Vermutung jedoch mit einem Fragezeichen versehen, da „zur Bach“auch der Bachhof zu Lohmar darstellen könnte. Im Birker Bruderschaftsbuch von 1503 finden wir die Eintragung: „Item moen tzilge van ynger halt gegevn Ir holffgen dat sy vlßgehalden halt tzo biche“105.
In den Heberegistern (Steuerlisten) des Jahres 1644 werden „Meiß Erben zu Bich In der Honschaft Inger als abgabepflichtig genannt. Auch im Verzeichnis der Vogteien (Steuerart) aus dem Jahre 1646 heißt es „Brauntrittges(?) sohn zue Wlnckell... vorhin Metzers Peter Meiß erben zue biech".
Am 14. 7.1644 werden die Limiten (Grenzen) der Honschaften im Kirchspiel Lohmar neu festgesetzt und beschrieben. Bei der Grenzbeschreibung der Honschaft Inger heißt es: „...auf den Bicher Schorenstein“, und unter der Honschaft Breidt: „biß auf den Bicher Schorenstein, Bich gehört aber In die Inger Hondtschaff“. Daraus ergibt sich für uns die Erkenntnis, daß der Schornstein eines Bicher Hofes gemeinsamer Grenzpunkt der Honschaften Inger und Breidt darstellt, daß aber die Siedlung zu Inger gehört. Wir haben bewußt „eines Bicher Hofes“ gesagt; denn nach den Erbhuldi-gungslisten des Jahres 1666 leisten 3 Haushaltungsvorstände den Erbhuldigungseid. Hier heißt es: „Erstlich belch – Jan stuven, nesselrodter halffman, Jacob daselbst“100. Danach wird Bich von mindestens 3 Familien bewohnt. Im Wertierund Landmaßbuch der Honschaft Inger aus dem Jahre 1711 werden zwei Höfe genannt: „Gerhardt Stauff zu Beich“ und „Wilhelm Faen zu Belch“.
In der Mitte des 18. Jahrh. ist ein gut zu Bich im Besitz der Eheleute Peter Büscher und Katharina, wie aus den Obligationsbüchern hervorgeht. Sie verpfänden ihr Gut sowie Ihren Zehnten zu Birk für eine Schuld in Höhe von 625 Reichstalern einem Herrn von Cronenberg zu Köln. Weitere Schreibweisen finden wir In den Taufbüchern von Lohmar im Jahre 1689 Bich, auf der Ploennis-Karte von 1715 Bech, auf der Wiebeklng-Karte von 1790 Bach, ferner auf der Karte von Zimmermann aus dem Jahre 1807 und der Tranchot-Karte von 1817 Bich.
1829 war Bich ein Hof mit 7 Bewohnern an 1 Feuerstelle. 1840 wohnten dort 20 Personen an 2 Feuerstellen. Im Jahre 1872 wurden wieder nur 7 Personen In 1 Haushaltung auf dem Gehöft zu Bich gezählt112. Peter Wilhelm Orth, der von 1851 bis 1892 Bürgermeister von Lohmar war, wohnte in Bich und verlegte das Bürgermeisteramt It. Regierungsverfügung nach Donrath.
Birk liegt im südöstlichen Stadtgebiet von Lohmar und gehörte bis 1969 zur amtsangehörigen Gemeinde Inger.
Die Birker Kirche wurde 1840 zur selbstständigen Pfarrkirche ernannt. Sie war ursprünglich eine Kapelle, die zur Mutterkirche Lohmar gehörte.
Breidt liegt im Südosten des Stadtgebietes von Lohmar und war bis 1969 eine zum Amt Lohmar gehörige Gemeinde.
Brückerhof,
bei Wahlscheid: der Hof liegt rechts der Agger am Talsaum in einer geschützten Einbuchtung des steil ansteigenden Bergriedels zwischen Agger und Sülz, gut 500 m südlich von Schiffarth und damit von der Brücke, die Schiffarth, Brückerhof und Hitzhof mit Wahlscheid verbindet. Vielleicht ist in diesem Zusammenhang auch der Siedlungsname zu sehen.
Am 14.3.1577 erhält ein Peter Bitter zur Brücken und seine Frau Katharina von der Sultzen vom Abt und Konvent zu Siegburg ein „stück auwels, das 3 ½ Viertel 1 Rute hält“ und neben dem Mackenbacher „auwei“ am Hof zur Brücke gelegen ist, in Form des Erbbeutkaufs. Dieser Peter Bitter tritt spätestens 1563 als Anwalt auf den Kirchscheider Hofgedingen auf und ist auch in einen langwierigen Prozeß mit seinem Gegenspieler Kerstien Boeckeschuis zu Altenrath verwickelt . Er war auch bei dem Rechtsstreit um die Deichanlagen zum Schutz des Auelshofes als Zeuge anwesend.
Weitere Schreibweisen ergeben sich aus der Ploennis-Karte von 1715 als Brückerhof , aus der Wiebeking-Karte von 1790 als Bruckenhoff und aus deTranchot-Karte von 1817 wie bei Ploennis. Nach Delvos 133 soll um das Jahr 1200 der Brückerhof im Besitz des Klosters Heisterbach gewesen sein. Graf Adolf von Berg soll den Mönchen gestattet haben, den dortigen Wald zu roden. Der Rottzehnte soll ihnen erlassen worden sein. Eine Bestätigung dieser Aussage können wir jedoch nirgends auffinden.
1829 wohnten im Brückerhof 10 Personen an 1 Feuerstelle. 1843 zählte der Hof 16 Bewohner, alle evangelisch, obwohl der Hof zur Pfarre Lohmar gehörte. Die reformierte Pfarre Wahlscheid lag eben zu nahe. 1851 wohnten nur noch 9 und 1827 nur noch 5 Personen auf dem als Ackergut bezeichneten Hof.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Dahlhaus,
Ober-, Unter-, im nördlichsten Punkt des Rhein-Sieg-Kreises wie auch der Gemeinde Lohmar auf dem Höhenrücken zwischen Agger und Sülz an der Kreisstraße von Heppenberg nach Heiligenhaus gelegen. Unmittelbar bei Dahlhaus erreicht unser Gemeindegebiet seinen höchsten Punkt, 235,4 m. über NN. Die Ortschaft selbst liegt in einer Mulde, wodurch der Name Dahlhaus, besser gesagt Dahlhausen, zu Recht besteht.
Dittmaier (Siedlung, 31) gibt als ältesten Nachweis eine Urkunde aus dem Jahre 1166 an.Diese Urkunde finden wir auch im Siegburger Urkundenbuch unter der Nummer 63. Tatsächlich ist hier ein „Dalehusen“ genannt, aber gemeint ist Dahlhausen, Kreis Olpe. Dies gilt für alle Urkunden der Abtei Siegburg, die einen „Hof zu Dalehusen, Dailhausen, Daelhusen oder Dalhusen“ betreffen. Wenn wir auch auf diese Urkunden nicht zurückgreifen können, so ist die o. g. Entwicklung der Schreibweise doch interessant und wird auch für unser Dahlhaus b. Honrath in etwa so zutreffen, vorausgesetzt, daß Dahlhaus auch dieses Alter aufzuweisen hat.
In den Steuerlisten der Honschaft Honrath im Amte Blankenberg aus dem Jahre 1644 werden 3 „halbwinner“ zu Dalhaußen genannt: „Weylichs, Heydens und Katterbachs halbman“. Wir können daraus entnehmen, daß es zu Dahlhaus um diese Zeit nur Höfe gab, die nicht vom Eigentümer selbst, sondern von Pächtern geführt wurden. Aus den Erbhuldigungslisten von 1666 erfahren wir auch die Namen dieser Pächter: „Krußen, Engell und Crudtert? zu dalhauß oder dallhaußen“. Der Lehnsoder Grundherr war schon auf andere Weise seinem Landesherrn verpflichtet.
Am 4. Okt. 1695 verkauft der bisherige Besitzer des Hauses Schönrath, Goswin Adolph Freiherr von Heyden, dem Herrn Ernst Freiherrn von Erlenkamp den freiadligen Rittersitz Schönrath „und dessen Appertinentien“ (Zubehör). Dazu zählt auch der Dalhauser Hof, welcher „giebt jährlichs an Pfacht: Roggen 4 Malter – Habern 16 Malter, Zum newen Jahr 1 Rthr., Hüner 16 stück – Einen fetten Hammel, Die halben schweyne ad drey stück – Acht Säcke Kohlen (hieraus könnte man schließen, daß zum Dahlhauser Hof eine Köhlerei gehört hat), Vier Maßen Butter – Ein Rindt auszufüttern, Sechs Dienste mit einem Pferdt zu thun“. Dies bezeugt, daß der Hof schon von respektabler Größe war.
Weitere Namensbelege ergeben sich aus der Ploennis-Karte von 1715 Dahlhusen und einer Flurkarte aus dem Jahre 1822 Unterste und Oberste Dahlhaus.
Diese beiden Siedlungen Oberund Unterdahlhaus sind heute zu Dahlhaus zusammengewachsen. Schon in den Statistiken von 1858 bis 1864 wurden die beiden Orte zusammengefaßt. So verzeichnet Dahlhaus 1858 115, 1861 sogar 127 Einwohner. Bis 1864 sank die Zahl auf 98, um dann aber wieder langsam anzusteigen. So wohnten 1871 in Oberdahlhaus 74 Personen in 16 Häusern, in Unterdahlhaus 30 Personen in 5 Häusern. 1875 wurden in OD 83 Personen und 15 Häuser in UD 31 Personen und 7 Häuser gezählt. Der Bevölkerungszuwachs um 1860 wie auch um 1875 ist wahrscheinlich auf die Tätigkeit in den Bergwerken Gruben Volta und Aurora, und Gruben am Lüderich zurückzuführen.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Nordöstlich von Breidt links oberhalb des Wenigerbaches in einer Mulde gelegen: Die Bedeutung des Namens, der auch Deeheim, Deesheim, Diesheim oder Deisheim gewesen sein könnte, ist unbekannt. Obwohl wir vor 1487 für Deesem keinen älteren urkundlichen Nachweis finden können, ist aber doch anzunehmen, daß die Siedlung älter sein muß. Darauf weisen Name und Lage (Nähe der Zeitstraße) des Ortes hin.
Bei der „Auftragung der Untersassen des Herzogtumns Berg“ aus dem Jahre 1487 erklärt sich „der jonge schroeder van deyss myss“ bereit, Herzog Wilhelm II. ein Darlehen zu geben. Da sich diese Eintragung unter Lomer = Lohmar befindet, ist anzunehmen, daß mit „deyss myss“ der Ort Deesem gemeint ist. Im Jahre 1503 werden im Birker Bruderschaftsbuch „Hennes van Deißmes und Elsa syn steiffmoder“, ferner „heynrich der eidom van deißmes“ als Mitbegründer dieser Bruderschaft genannt. Im Mitgliederverzeichnis finden wir die Schreibweisen Dysmys, deyßers und deysmyss. Eine Eintragung aus dem Jahre 1596 nennt „Lentzen zu Diessem“.
In den Limiten des Kirchspiels Lohmar vom 14.7.1644 heißt es, daß die Bewohner von „Breit und Deeßem ihren Weidtgang zusammen ihn busch und Velderen haben“. Aus den Heberegistern (Steuerlisten) desselben Jahres können wir entnehmen, daß deeßem schon beträchtlich gewachsen ist. Als ortsansässige Eigentümer werden „Gotthart, Wilhelm Buschenschmit, Marx, Wymar, Johentges Wilhelm, Michaeli, Heinrichs Erben, Braun Schmitzs Erben und Jeenn“ genannt, als weitere Landeigentümer „Braun Zylgen Johanß Sohn, Wilhelm zu Breit und Johannes Rengerot“. Auch im Verzeichnis der Vogteien aus dem Jahre 1646 der Honschaft Breidt wird Deeßen mehrmals genannt, ebenfalls als Deissem in den Erbhuldigungslisten des Jahres 1666. 6 Haushaltsvorstände leisten den Erbhuldigungseid, während einer krank gemeldet ist.
Weitere Namensbelege finden wir in den Taufbüchern von Lohmar, und zwar 1679 Deisem und Dießem, 1702 Desem und 1717 Diesem;7 ferner auf der Ploennis-Karte von 1715 (K 9) und auf der Wiebeking-Karte von 1790(K 10) Disum. Weitere Schreibweisen lauten 1807 Diessem (K 11), 1817 Deesem (K 12) und 1822 Desem.8
Im Jahre 1829 wohnen in Deesem 157 Personen an 30 Feuerstellen. 1840 werden 153 Personen (davon 109 kath. und 44 evangl.) gezählt. 1843 wohnten wieder 157 Personen (davon 103 kath. und 54 evangl.) in 33 Häusern. Bis 1851 stieg die Einwohnerzahl sogar auf 173, sank jedoch bis 1872 auf 128 Personen in 32 Wohnhäusern.
Aus diesen Angaben können wir erkennen, daß sich in Deesem, dass näher an den evangelischen Pfarreien Wahlscheid und Seelscheid liegt, die Reformation noch stärker als in Geber bemerkbar machte. Das Ansteigen der Bevölkerungszahl bis 1851 ist wohl in erster Linie auf den Bergbau links des Wenigerbaches in den Gruben Walpot und Alexander zurückzuführen.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Donrath
Diese Siedlung liegt im plötzlich breiter werdenden Aggertal, etwas nördlich vom Zusammenfluß der Sülz (rechts) und des Jabaches (links) in die Agger. Da hier drei Täler Zusammenstößen, ist es auch von der Verkehrslage ein idealer Siedlungsplatz. Die alte Köln-Siegener Straße kreuzte hier die Agger; eine Straße, die wegen des Erztransportes aus dem Siegerland nach Köln und wegen der in gleicher Richtung verlaufenden Post von Bedeutung war.
Dittmaier leitet das Bestimmungswort „Doden, Don“ von dem Personennamen „Dodo“ ab. Eine andere Erklärung geht von „don = dun = dune“ in der Bedeutung „Hügel, Erhöhung“ aus. Tatsächlich liegen in und bei Donrath Siedlungen auf hügelähnlichen, leichten Erhebungen des Talbodens, die gegen das Hochwasser der Agger sichern. Diese Erhebungen sind aber wahrscheinlich künstliche Aufschüttungen, die erst später zum Schutz vor Hochwasser angelegt wurden. Somit ist der Erklärung Dittmaiers unbedingt der Vorzug zu geben. Dann aber wäre Donrath eine Siedlung, deren Gründung bis ins 10. Jahrhundert zurückreichen könnte. Wir können jedoch keinen urkundlichen Namensbeleg aus der Zeit vor 1500 finden. Interessant ist jedoch der Hinweis Hennekeusers, daß in der Urkunde aus der Zeit vom 8.8.1065 bis 4.12.1075, nach der die Abtei Siegburg den Kirchscheider Hof im Tausch gegen Haus Sülz erhält, als Zeuge u. a. ein „Duodo“ genannt wird. Ist dies vielleicht der Gründer von Donrath? Viele Zeichen (urkundliche Erstnennungen von Lohmar, Sülz, Inger, Honrath usw.) sprechen dafür. Jedoch muß es leider eine Vermutung bleiben.
Die ersten Nennungen passen so gut in diesen Rahmen: Dodenroide im Register des Bruderschaftsbuches von Birk, und zwar „Jaris van doderade“, aus der Zeit von 1503 bis 1538 und Dodenraide bei Erhebungen im Jahre 1550 genannt. Im Rent und Lagerbuch des Amtes Blankenberg aus dem Jahre 1644 wird den Bewohnern von Doytenroth und anderen Orten das Fischen in der Agger mit einem Waschkorb zugebilligt. Aus den Limitenbüchern (Grenzbeschreibungen) des Kirchspiels Lohmar vom 14.7.1644 geht auch hervor, daß die Bewohner von Doenroht zusammen mit den Nachbarn der umliegenden Orte in Wald und Feld ihr Vieh hüteten. Zu dieser Zeit werden „Thöneß, Heinrich Stauf und Johan Koch zu donroht“, ferner „Wilhelm Kauttenkauller, Geißellen Gotthart, Gottharts Erben und Gottart im Backeshoff zu Lohmar“ wegen ihrer Güter zu Donrath als Abgabepflichtige in den Heberegistern des Amtes Blankenberg geführt. Fünf Personen aus Donrat leisten 1666 den Erbhuldigungseid, d. h. sie ließen sich in die sog. Erbhuldigungslisten eintragen, um dadurch wiederum ihre Treue zum Landesherrn zu bekunden. Die Schreibweise jener Zeit wird auch durch Angaben zum Donrather Steeg bekundet.
Weitere Schreibweisen finden wir in den Taufbüchern von Lohmar, und zwar 1662 Dohnraht, 1688 Donraht und 1689/90 Dorath. Die PloennisKarte von 1715 verzeichnet viele Höfe in Tohnrad . Ähnliche Schreibweisen ersehen wir aus dem Wertierund Landmaßbuch von Lohmar aus dem Jahre 1746: Thonrath. Diese beiden Schreibweisen haben die irrige Auffassung verursacht, der Name Donrath habe etwas mit tonhaltigem Boden, also mit schlechtem Ackerland zu tun. Im Wertier-und Landmaßbuch von Haiberg aus dem Jahre 1738 werden „Johs Inger, Johs petter Klein, Johs Wilhelm Klein, henricus schmit zu donroth“ genannt. Die Wiebeking-Karte von 1790 verzeichnet Dohnrath, desgl. Tranchot 1817 und Hartmann 1845. Zimmermann bringt 1807 die Schreibweise Donroth. Am 6.4.1829 war Donrath ein Dorf mit 72 Bewohnern an 13 Feuerstellen. 1840 wohnten 66 Personen an 14 Feuerstellen, 1843 64 Personen in 11 Häusern. Im Jahre 1871 werden zwar 73 Einwohner gezählt, aber diesmal ist die Einwohnerzahl von Donrather Steeg in der Zahl 73 enthalten. Erst in jüngster Zeit, besonders nach dem 2. Weltkrieg, wuchs die Zahl der Bevölkerung so stark, daß die in der Nähe liegenden Siedlungen Broich, Büchel und Kuttenkaule von Donrath aufgesogen wurden. Diesem Bevölkerungszuwachs und der Eigeninitiative der überwiegend katholischen Bewohner hat es Donrath zu verdanken, daß der Ort 1954 eine eigene Kirche als Filialkirche von Lohmar erhielt, die Marienkirche. Über ein halbes Jahrhundert, nämlich von 1851 bis 1906, war in Donrath das Bürgermeisteramt der Bürgermeisterei Lohmar. In dieser Zeit residierten hier als Bürgermeister Peter Wilhelm Orth (1851-1892) und Frhr. von Franken (1892-1906).
Donrather Steeg
Diese Siedlung befand sich an der Stelle, an der die alte Köln-Siegener Straße die Agger überquerte, von der heutigen Aggerbrücke etwa 500 m nordwärts. An dieser Stelle befindet sich heute noch ein hölzener Steg, der zur Zeit erneuert wird. Etwa 100 m flußabwärts wurde ab 1860 eine Fähre betrieben bis zum Bau einer festen Brücke im Jahre 1878. Fährmann war damals ein Wilhelm Klein, auch „Fährwellem“ genannt. Die Bruchsteinbrücke, bestehend aus 5 Bogen, kam am 4.11.1940 infolge Hochwassers zum Einsturz. Danach wurde sie nicht wieder aufgebaut, und heute erinnern noch die Auffahrtrampen links und rechts der Agger an diese Brücke.
Eine erste Erwähnung findet der Donraidter Stegh in den Notizen Pfarrer Mohrenhofens von Altenrath, in denen aus der Zeit zwischen 1627 und 1645 der Weg einer Prozession beschrieben wird. Im Limitenbuch des Amtes Blankenberg vom 14.7.1644, das Lohmarer Kirchspiel betreffend, wird auch ein „Straßenzustandsbericht“ gegeben. Darin heißt es, daß der Doenrother Steegh je zur Hälfte vom Amt Porz (Scheiderhöhe) und vom Kirchspiel Lohmar unterhalten werden muß. Auch im Wertierund Landmaßbuch von Lohmar aus dem Jahre 1746 wird der Thonrother Stegh bzw. Thonratter Steg genannt.
Weitere Schreibweisen finden wir auf der Tranchot-Karte von 1817, hier ist der Dohnradter Steeg bereits als Brücke eingezeichnet; ferner das Ortschaftsverzeichnis von 1829 als Donrathersteg.
Ob schon vor dem 19. Jahrhundert an dieser Brücke auch eine Siedlung bestand, ist anzunehmen. 1829 wohnten dort 20 Personen an 9 Feuerstellen. Auch ein Fährhaus ist erwähnt. 1840 werden jedoch nur noch 6 Bewohner an einer Feuerstelle gezählt, und die Siedlung wird als Hof bezeichnet. Auf ihm wohnen 1843 8 Personen und 1851 17 Personen. Danach wird die Siedlung nicht mehr gesondert aufgeführt, gehört also nunmehr zu Donrath.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Ellhausen,
auf dem Höhenrücken zwischen Jabach und Agger in einer Mulde etwas abseits der alten Köln-Siegener Straße gelegen.
Wahrscheinlich kann man das Bindewort Eilvon dem Personennamenstamm „AI-“ ableiten. Im Nachbarrecht von Haiberg aus dem Jahre 1751 wird für Ellhausen mundartlich „Elßst Haußen angegeben, was so viel wie „älteste Hausen“ bedeutet. Diese Auslegung ist jedoch kaum in Einklang zu bringen mit der Bezeichnung Elhusen von 1310. Wahrscheinlicher ist die erstgenannte Deutung, da eine Umwandlung von AI in El gut vorstellbar ist.
Am 21.2.1310 verpachtet der Pastor von Lohmar Besitzungen in Haiberg einem Johann gen. von Reyngerode (Rengert) und seiner Frau, die dafür einen Teil ihres Hofes und Hauses in Elhusen zum Pfand einsetzen (Siehe Anhang Nr. 1)7 Nach dieser ältesten Urkunde taucht der Name Elhusen erst wieder auf im Birker Bruderschaftsbuch von 1503-1538, und zwar „seuriyn van elhuysen“ und „Johan van elhußen“. Im Pastoratslagerbuch von Lohmar aus dem Jahre 1582 werden die Einnahmen aus Elhausen aufgeführt, und zwar „gibt ein Jeliches hauß zeitlichen pastoren ein honn jährligs. Item 1 sester Korn geben jährligs zu Elhausen stinghes Jahn und Wilh fußen“.
Im Bericht über die Viehzucht in der Honschaft Haiberg aus dem Jahre 1644 heißt es, daß „die halberger und zu Eychen so das Elhaußen wohnende Nachparen hoeden auch eindrechtig zosammen“.
Vier abgabepflichtige Personen werden in den Heberegistern (Steuerlisten) des Amtes Blankenberg aus dem Jahre 1644 zu Elhaußen genannt: „Wilhelm, Arnolts Eytsumb, Jeörgs Arnolts Eytsumb und Johannes Huppelshaußen zu Sygbergh wegen Arnolts“.
Im Verzeichnis der Vogteien der Halberger Honschaft von 1646 tauchen zum Teil neue Namen auf, wie „Conradt Kotten Kaulen, vorhin Wilhelm zu Ehlhausen“. Aus diesem Verzeichnis geht oftmals auch die Besitzerfolge hervor, z. B. „Diederich weeßman zue grimbergh vorhin deßen Vatter Peter fruv wegen Walraven zue Kreitzen von Ehlhausen“ oder „Zeylgen Johan, vorhin Michell zue Ehlhausen, danebenvorn drieß zue grimperg“.
Als im Jahre 1666 zur Eintragung in die Erbhuldigungslisten aufgerufen wird, finden wir unter Elhaußen gleich 6 Namen von Personen, die durch ihre Eintragung den Treueid dem Landesherrn gegenüber erneuern. Im Zahlenvergleich stellen wir fest, daß die Siedlung inzwischen gewachsen ist.
Weitere Namensbelege können wir den Taufbüchern von Lohmar entnehmen, nämlich 1688/89 Elhausen und 1704 Ellhausen, ferner 1715 Elhusen (Ploennis-Karte 9). Nach dem Wertierund Landmaßbuch von Haiberg aus dem Jahre 1738 sind „Wilhelm Donken, Heinrich Ehlhusen, Johs Elhuißen, Michael Klein, Wiemer pütz, Wilhelm u. Johan stingeshohn, rörig schuhemacher u. Heinrich wester zu Elhaußen“ Besitzer einer steuerpflichtigen Hofstatt.
Am 3.4.1745 machen die Eheleute Johann Limbach und seine Frau Anna Maria Greffrath gen. Limbach eine Stiftung zur Fundation der Halberger Kapelle An den Kapitalien zu dieser Fundation sind beteiligt: „Frecher zu Elhausen mit 3 Reichstalern u. 26 Albus, sowie Joan Elhausen mit 1 Reichstaler u. 39 Albus“.
Weitere Schreibweisen für Ellhausen finden wir auf der WiebekingKarte von 1790 Ehlhusen (K 10) 1807 Elhausen (K 11), ab 1817 dann Ellhausen (Tranchot K 12).
Der Ort hatte 1829 bereits 75 Bewohner an 15 Feuerstellen und wurde als Dorf bezeichnet. 1843 zählte man 126 Einwohner und 20 Wohnhäuser. Dann aber ging die Einwohnerzahl stark zurück, bis 1851 auf 109 und 1871 sogar bis auf 56 Einwohner. Am 21.2.1872 werden 62 Personen in 16 Wohngebäuden und 17 Haushaltungen gezählt.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
In den Jahren 1825 bis 1832 fuhr man aus der Talsohle in der Umgebung der Häuser Jexmühle 18–24 auf der linken Seite des Jexmühlenbachs einen tiefen Stollen auf,
in dem man nach 490 m den dort einfallenden Gang St. Georg antraf. Bei 600 m stieß man auf den Gang Begegnung und bei 640 m auf den Gang Aurora. Die Gänge waren
ein bis zwei Meter mächtig und führten Blei- und Kupfererze, aber auch Zinkblende. Eine Wiederaufnahme der Arbeiten erfolgte in der Zeit von 1855 bis 1858 mit mäßigem Erfolg.
1856 hatte man in der Nähe des Stollens Aurora eine Aufbereitungsanlage gebaut, die mit Wasser aus dem Jexmühlenbach und Grubenwasser aus dem Stollen betrieben wurde.
Ein Umwandlungsantrag vom 24. Februar 1866 für das Längenfeld Aurora in ein Geviertfeld führte am 5. Dezember 1867 zur Verleihung an die Honrather Gewerkschaft.
Ausgenommen von dieser Verleihung waren allerdings die Längenfelder St. Georg, Begegnung und Linné. Am 15. Juni 1874 erfolgte eine Konsolidierung aus den
Einzelfeldern Aurora, Aurora Tiefstollen, Wilhelm II, Maria, Gustav I, Fortsetzung, Silberhütte I und II sowie Johanna. Bei dieser Aufzählung werden die Felder St. Georg,
Begegnung und Linné nicht mehr erwähnt, so dass anzunehmen ist, dass diese bereits zu einem früheren Zeitpunkt konsolidiert waren.
Das Grubenfeld Aurora war verliehen worden auf Blei-, Zink-, Kupfer- und Eisenerze. Eigentümer war AG für Bergbau, Blei- und Zinkfabrikation zu Stolberg und in Westfalen.
Seit 1905 wurden Versucharbeiten vorgenommen, über die Jahresberichte vorliegen. Mit 10 Arbeitern wurde 1905 der Johann-Wilhelm-Stollen auf seiner ganzen Länge aufgewältigt
und mit den Aufwältigungsarbeiten auf den St. Georgs-Gang begonnen. Die Versuchsarbeiten mit 23 Arbeitern auf den Gängen Freudige Hoffnung, St. Georg, Begegnung und Aurora
hatten 1906 keine nennenswerten Ergebnisse. Auch 1907 hatte man mit 17 Arbeitern ungünstige Ergebnisse. 1908 wurden die Aufschlussarbeiten mit zwei Arbeitern bereits im März eingestellt.
Im Jahr 1909 waren sechs Arbeiter mit der Verbesserung der Wetterführung im Johann-Wilhelm-Stollen auf 60 Meter Länge beschäftigt.
Das Ende der Arbeiten kam 1910. Letztmals hatte ein Arbeiter den Stollen um zwölf Meter verlängert. Dabei waren geringe Mengen an Zinkblende und Bleiglanz auf den letzten 4,5 Metern vorgefunden worden.
Die Gesamtförderung betrug zwischen 1855 und 1911 rund 12.000 t Blei- und 1.060 t Zinkerze. Das nördliche Feld war wirtschaftlich ergiebiger als die anderen Teile und wurde bis auf 130 Meter Teufe aufgeschlossen.
Die Grube Moritz ist ein ehemaliges Bergwerk am Holzbach und liegt in der Nähe von Lohmarhohn an dem Weg nach Heide.
Die Grube Pilot war eine der für das Bergische Land typische Kleingrube, die im 19. und 20. Jahrhundert die Mehrzahl der Bergwerke dieser Gegend ausmachten. Eine ausführliche Darstellung der Geschichte der Grube Pilot in Wahlscheid findet sich in der Publikation "Metallerz-Bergbau im unteren Aggertal. Bei der Wiederinbetriebnahme der Grube in der Mitte des 19. Jahrhunderts stieß man bei den Aufwältigungsarbeiten auf alte Stollen, Schächte und Abbaue, die hier eine Erzgewinnung bereits in früherer Zeit belegen. Von ca. 1854 bis 1866 wurden im Kirchbachsiefen die Bergwerke Schloofköpp (Eigentümer war die Aggertaler Kupferbergbaugesellschaft zu Hannover) und Hortensia (Eigentümer war die Mittelrheinische Kupferbergbaugesellschaft) betrieben. Es wurden einige Tonnen Erze gefördert. Auf beiden Bergwerken erfolgte der Abbau über der Stollensohle und im Tiefbau. Zur Förderung und Wasserhaltung waren Dampfmaschinen installiert. Das Haufwerk von Hortensia wurde in einer der Grube angegliederten Aufbereitungsanstalt verarbeitet. Wegen fallender Metallpreise und fehlender Neuaufschlüsse, kam der Betrieb schließlich zum Erliegen. Von 1906 bis 1917 fand die letzte Betriebsperiode statt. Man untersuchte das Erzvorkommen bis in eine Tiefe von 190 Meter unter der Stollensohle. Nennenswerte Erzvorkommen wurden aber nicht gefunden. Am Hortenisschacht stand ein Fördergerüst, das über eine Dampfmaschine betrieben wurde. Aus der Grube gefördertes Haufwerk wurde in einer Aufbereitungsanlage unterhalb im Kirchbachsiefen verarbeitet. Analysen aus damaliger Zeit haben ergeben, dass in 100 Kilogramm Bleiglanz bis zu 34,5 g Silber enthalten waren. Als Haupteigentümer der Grube wurde damals ein Hauptmann a. D. Hoffmann angeführt, der auf Burg Berwartstein wohnte.
Nach der Schließung der Grube Pilot diente der Hortensia-Stollen im Zweiten Weltkrieg als Luftschutzstollen für die Zivilbevölkerung. Nach dem Krieg wurden die Stollen teilweise verfüllt und die Stollenmundlöcher zugeschüttet.
Relikte der Grube Pilot sind noch heute im Kirchbachsiefen sichtbar. Hierzu gehören die in Mauerwerk gefassten Mundlöcher des Hortensia-Stollens und Schloofköpp-Stollens. Von der Aufbereitungsanlage finden sich noch Mauerreste, Maschinefundamente sowie Klärteiche. Neben zwei Gebäuden aus der letzten Betriebszeit, zeugen auch die umfangreichen Abraumhalden vom einstigen Bergbau in dieser Gegend.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Grube_Pilot
Der Ort liegt auf dem rechten Steilhang des mittleren Jabachtales, zwischen der Jabachtalstraße und der über Halberg – Kreuzhäuschen – Geber – Breidt – Krahwinkel verlaufenden alten Köln-Siegener Landstraße. Schon 1375 siegelt in einer Urkunde ein Hermann Geiber mit anderen als Geschworener des Hofes zu Lohmar, der dem Cassiusstift zu Bonn gehörte. Ob Geiber mit Geber gleichzusetzen ist? Ob eine Familie dieses Namens der Siedlung den Namen gab? Sicher ist, daß im Jahre 1503 ein „Peter van Gheber und margrit syn huysfrau“ Mitbegründer der Marienbruderschaft in Birk sind. Ferner gehören dazu „thysgyn van gheber und metze van gheber“. Am „mayndach na oysteren“ im Jahre 1562 erscheinen „Hinrich pils sonn van gheber und gutgin seyn huisfrau“ vor dem Hofgericht zu Kirchscheid. Um diese Zeit besaß die Adelsfamilie Quad zu Isengarten einen Freihof in Geber, der später an die Familie von Lüninck überging.
Nach dem Pastoratslagerbuch von Lohmar aus dem Jahre 1582 „geben Lohmar Jan, Johannes Kling, voolen henrich und Jannes Schmidt auß geber jährligs zusammen zwey höner an den zeitlichen pastor zu lohmar“.
In den Jahren 1643/44 wird ein neues Rent und Lagerbuch des Amtes Blankenberg angelegt. Dabei wirkt ein Heinrich Roerich zu Gebar als Geschworener mit. In den sog. „Limiten“ des Jahres 1644 ist das „Gebahr creutz“ für die Haiberger und die Breidter Honschaft ein gemeinsamer Grenzpunkt. Darin wird auch für das „Dorff Gebahr ein absonderlicher Weidtgangh“ beschrieben und vermerkt, daß Geber „macht und gerechtigkeit auf der Bircher houeen hat“. In den Heberegistern (Steuer-listen) von 1644 werden gleich 7 Eigentümer zu Gebähr genannt: „Peter Müllers Sohn, Johann Hoppengerdtner, Dreutgen die Schwegersche, Johann Schneider, Heinrich, Dreeß, ferner Hanß under der wagen zu Sygberg wegen gebahrs von seiner antheilgen“. Fast die gleichen Namen erscheinen 1646 im „Verzeichnis der Vogdeien der Breider hontschafft“ u.a. „Heinrich und Diederich gebrüdern zue gebahr, vorhin Johann Heumar“. Dieser Johann Heumar war Dienstmann des Amtes Blankenberg. In den „Erbhuldigungslisten“ des Jahres 1666 finden wir wiederum „zu geber“ die schon erwähnten Namen. Weitere Schreibweisen finden wir in den Taufbüchern von Lohmar: 1699 Gäbern und 1706 Gebern. Im Wertier und Landmaßbuch der Honschaft Inger aus dem Jahre 1711 werden „Heinrichß erben zu Gebar“ genannt. 1738 im Wertierund Landmaßbuch von Haiberg „Johan Kellershon zu geber“. Weitere Namensbelege: 1715 Jeber , 1790 Jeber , 1807 und 1817 Geber .
Auf einer Flurkarte von 1822 heißt es jedoch Geeber. 1829 wird Geber als Dorf mit 92 Bewohnern an 21 Feuerstellen bezeichnet. Aber schon 1840 zählte der Ort 129 Einwohner (davon 108 kath. u. 21 evang.). Daran können wir erkennen, dass sich noch bis hierhin die Reformation aus den Nachbarpfarreien Seelscheid und Wahlscheid bemerkbar machte. Im Jahre 1843 zählte Geber sogar 139 Bewohner in 28 Häusern. 1851 stieg die Zahl der Bewohner auf 150, wahrscheinlich zurückzuführen auf die Grube Noeggerath bei Salgert.
1872 wohnten 135 Personen in 33 Häusern und 34 Haushaltungen.
Das mundartliche „Jäver“ oder „Jäber“ geht nach Dittmaier auf ein altes „gavir, gabir“ zurück, dessen Bedeutung jedoch unbekannt ist.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape, April 1983
Sie liegt im Jabachtal am Schnittpunkt der Gemarkungsgrenzen von Breidt, Haiberg und Inger. Sie ist identisch mit der sog. Bichermühle oder Bachermühle.
Der Siedlungsname taucht erst 1790 auf der Wiebeking-Karte als Jebermühl auf. Auf einer Flurkarte von 1822 lautet die Schreibweise Geebermühle.
1829 wohnten dort 2 Personen an einer Feuerstelle, 1840 wurden 7 Bewohner gezählt.
Durch den Neubau der Jabachialstraße vor einigen Jahren (Ausbau zur B 507) mußte sie verlegt werden und wurde als Gaststätte „Zur Gebermühle“ neu errichtet.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Hagen
bei Birk: Die Siedlung liegt nördlich von Birk und westlich der Zeitstraße am Abhang eines kleinen Bergsporns, zu dessen Füßen flachauslaufend ein Siefen beginnt mit der Quelle eines kleinen Rinnsals zum Jabach.
Wahrscheinlich trifft die o. g. Namenserklärung für diese Siedlung voll zu. Natürlich könnte auch der Familienname Hagen namengebend gewesen sein.
Im Bruderschaftsbuch von Birk aus dem Jahre 1503, fertiggestellt 1538, wird unter den Mitgliedern dieser Marienbruderschaft ein „elyas van dem hagen“ genannt.
Bei den Grenzbeschreibungen (Limiten) der Honschaft Inger vom 14. 7.1644 heißt es, daß für eine Grenzeiche („eine Eych mit einem Creutz“) die „Hagerß Erben“ zuständig waren. In den Heberegistern (Steuerlisten), ebenfalls von 1644, wird „daß gut im Hagen“ als abgabepflichtig aufgeführt. Im Verzeichnis der Vogteien (Abgabenart) von 1646 werden „Wilhelm hermerott und Peter Wißman wegen deß hagens“ genannt5. Beide haben das 1644 neu angelegte Rentund Lagerbuch des Amtes Blankenberg, das Kirchspiel Lohmar betreffend, unterschrieben, und zwar Peter Wißmann als Schultheis von Lohmar und Wilhelm Hermeroth als Hofschulze des Fronhofes zu Lohmar6. Auf den Erbhuldigungslisten des Jahres 1666 erscheint „der Haager“, zu ergänzen „halffen“.
Weitere Schreibweisen ergeben sich aus dem Wertie rund Landmaßbuch der Honschaft Inger von 1711 mit Haeger Hoeff und Haegerguet, auf der Ploennis-Karte von 1715 und der Wiebeking-Karte von 1790 Hagen, aus derTranchot-Karte von 1817 Haagen, aus der Karte von Zimmermann 1807 Hagenhof und aus einer Flurkarte von 1822 Hagen.
Im Ortschaftsverzeichnis von 1829 wird Hagen als Höfchen mit 6 Bewohnern an 2 Feuerstellen aufgeführt, 1840 als Hof mit 10 Bewohnern und 1872 als Weiler mit 11 Einwohnern und 2 Wohnhäusern.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Hagerhof,
auf der Scheiderhöhe, zwischen Scheiderhöhe und Muchensiefen, auf dem Höhenriedel zwischen Agger und Gammersbach in unmittelbarer Nähe der Kreisstraße von Heppenberg nach Honrath gelegen:
Wahrscheinlich wurde der Hof nach dem Familiennamen Hagen benannt. Allerdings kann auch die Flurbezeichnung „Hag, Hage, Hagen = ungezäunte, eingefriedigte Wohnstätte“ namengebend gewesen sein.
In den Protokollbüchern der Kirchscheider Hofsgedinge von 1560 bis 1565 wird schon 1562 ein „Gilliß zom Seyffenn“ als abgabepflichtig aufgeführt. im Jahre 1563 erfolgt eine genauere Angabe. Hier heißt es: „Gillis zom seiffenn vann freißtenn hagers guit“. Hieraus geht hervor, daß der Hagerhof ein Freigut war, von dem lediglich der Pächter gewisse Abgaben zu entrichten hatte.
Bei der Besichtigung des Weges vom Kirchspiel Wahlscheid zur Sülzer Brücke am 10. 6.1586 ist auch ein „Michel zum Hagen“ anwesend.
Zwischen 1627 und 1645 berichtet Pfarrer Mohrenhofen von Altenrath über Verlauf und Weg einer Prozession zur Kirchscheider Jakobskapelle, die auch über Haggerhoue führte . Bei einer Vermessung des Kirchscheider Hofes und seiner Ländereien wird ein Busch erwähnt, der „obenher langß die Hager und hammershouer güter gelegen“ ist. Die Vermessung ist datiert vom Mai 1676.
Weitere Namensbelege finden wir auf der Ploennis-Karte von 1715 und der Wiebeking-Karte von 1790 als Hof Hagen. Andere Schreibweisen ergeben sich aus den Taufregistern von Lohmar im Jahre 1727 Hager Hoff auf derTranchot-Karte von 1817 Haagerhof und einer Katasterkarte von 1822 Hagerhof.
Auf dem Hof wohnten 1829 10 Personen an einer Feuerstelle. 1843 wurden 11 und 1851 9 Bewohner gezählt. 1872 wurde das Ackergut von 12 Personen in 1 Wohnhaus bewohnt.
Delvos berichtet, daß der Hof Eigentum des Grafen von Nesselrode sei und jahrelang von der Familie Weeg gepachtet sei.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
1732 vom Halberger Gemeindevorsteher Johann Bertram Gräfrath gestiftete Kapelle zu Ehren St. Isidors, eines spanischen Heiligen und Schutzpatrons der Ackersleute.
Die Kapelle St. Isidor stiftete der Schultheiß (Gemeindevorsteher) Johann Bertram Gräfrath in Halberg im Jahre 1732 - so ist es noch einer Inschrift über dem Eingang
zu entnehmen: JBG hat erbaut 1732. Es handelte sich um einen kleinen dreiseitig geschlossenen Bau mit zwei Rundbogenfenstern an jeder Langseite, rundbogiger Westtür
und barockem Dachreiter auf dem Chorende. Die Kapelle lag und liegt an einer alten Höhenstraße in das Siegerland, an der kurz zuvor eine Poststation eingerichtet worden war.
An einem Tragaltar wurde hier an Sonn- und Festtagen die Messe gefeiert, und zwar für den damals bereits 78-jährigen Herrn „Graefreth“ und seine Familie, für die Nachbarn -
aber nur für eine Person aus der Familie, wenn die anderen die Sonntagsmesse in der Pfarrkirche in Lohmar besuchten - außerdem auch für die „Reisenden und Priester“ die mit der Mülheimer Post hier ankamen.
1911 gründete sich ein Kapellenverein, der die Mittel für einen regelmäßigen Sonntagsgottesdienst und für die Ausstattung der Kapelle zur Verfügung stellte.
1930/31 wurde die Kapelle durch einen Umbau vergrößert, sie erhielt einen neuen Chor und zwei Nischen, das Dach wurde repariert und das Zwiebeltürmchen als Dachreiter in der alten Form über der Vierung erneuert.
Über die Familie des Stifters, die - auch für Lohmar - bedeutende bergische Beamtenfamilie Gräfrath, kann man sich näher informieren in einem Aufsatz von Heinz Dieter Heimig in den Lohmarer Heimatblättern 13 (1999).
St. Isidor: Patrone der Kapelle sind der hl. Isidor und die hl. Barbara. Isidor von Madrid ist ein spanischer Heiliger, der als Schutzpatron der Ackersleute gilt. Die Heiligenlegende besagt, dass Isidor Bauer war und in seiner Jugend als Knecht eines Barons arbeitete. Er zeichnete sich durch Gehorsam und fleißige Arbeit aus, ohne dabei das Gebet und Übungen der Nächstenliebe zu vernachlässigen. Seine Mitknechte waren eifersüchtig auf ihn, weshalb sie ihrem Herrn gegenüber behaupteten, er würde ständig beten und deshalb seine Arbeit vernachlässigen. Der Baron ging dem nach und fand Isidor betend, während zwei weiße Stiere, die von Engeln geleitet wurden, pflügten.
Umbau 1930/31: Die Hand- und Spanndienste wurden von den Mitgliedern des Kapellenvereins ausgeführt, die Grauwackesteine aus dem Gemeindesteinbruch im Jabachtal geliefert. Den Umbau leitete der in Haus Hollenberg in Donrath lebende Kirchenbausachverständige Prof. Joseph Prill. Er war als Priester und Religionslehrer innerhalb der Kölner Erzdiözese tätig gewesen und hatte sich – u.a. in Rom, aber auch autodidaktisch – in Architektur und Kirchenbau ausgebildet. Obwohl zunächst in Kunstkreisen nicht ganz ernst genommen hatte er sich doch zu einem Sachverständigen entwickelt, von dem u.a. die Kirchenbauten St. Joseph in Bonn-Beuel und St. Marien in Bonn stammten.
Quellenverzeichnis:
Edmund Renard, Die Kunstdenkmäler des Siegkreises (= Die Kunstdenkmäler des Rheinlandes 5.4), Düsseldorf 1907;
250 Jahre Kapelle St. Isidor in Halberg (= Dokumentation G 5 des Heimat- und Kulturvereins Lohmar), 1982;
Hans Dieter Heimig, Der Stifter der Halberger Kapelle – ein Mitglied der bedeutenden bergischen Beamtenfamilie Gräfrath, in: Lohmarer Heimatblätter 13, 1999;
Wilhelm Pape, Professor Prill und der Hollenberg (= Dokumentation G 23 des Heimat- und Geschichtsvereins Lohmar), 1993
Hammerschbüchel liegt auf halbem Weg an der Straße von Kreuznaaf nach Scheiderhöhe auf einem von Scheiderhöhe in östlicher Richtung zur Agger verlaufendem Höhenriedel. Der Name leitet sich ab von Hammersch = Personenname Hadumar und Büchel = Erhebung im Gelände. Schon sehr früh in den Protokollen der Gerichte zu Scheiderhöhe wird 1438 Hammerschbüchel als "boichell" erwähnt. Noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts trug Hammerbüchel nur den Namen Büchel. In der Tranchot-Karte von 1817 tauchgt der heutige Name zum ersten Mal auf als "Hammerscher Büchel". Die Siedlung hatte 1829 8 Bewohner an 2 Feuerstellen.
Haus Dorp,
auf dem südlichen Höhenrücken zwischen Agger und Naaf an der Straße von Kreuznaaf nach Oberstehöhe gelegen.
Die Grundbedeutung des Wortes Dorf, ob Einzeloder Haufensiedlung, ist nicht ganz geklärt. Schon sprachgeschichtlich berühren sich hier zwei Wortstämme, von dem der eine mit lat. „turba“ = Menge, Schar und der andere mit lat. „trabs“ = Balken verwandt ist. Fast alle Dorfnamen weisen auf wirkliche Dorfsiedlungen hin. Hier aber haben wir es mit einer der wenigen Ausnahmen zu tun. Haus Dorp ist als Einzelhof zu bezeichnen, aus dem zunächst ein Rittersitz hervorging, um den herum später einige Gehöfte hinzukamen.
Im Verzeichnis der Vasallen, die von Abt Wolfard I. von Siegburg zwischen 1320 und 1349 belehnt wurden, heißt es: „Item Gise van Blankenberg van eime hove zo Dorpe, ind van artlantz, dat ziende ghort der kirchen van Walscheit mit namen XXVI morgen ind eine wese vur III morgen gerechent“. Danach war Gise von Blankenberg Besitzer des Hofes zu Dorpe, sowie von 26 Morgen Ackerland und 3 Morgen Wiese, von dem er den Zehnten an die Kirche zu Wahlscheid zu entrichten hatte. In der gleichen Urkunde heißt es weiter: „Item Rorich van How hait zo leen XIII morgen artlantz ind den hoff zo Dorpe. Item Teill van Dorpe hait zo leen X morgen Artlantz ind busch zo Dorpe“. In einem weiteren Verzeichnis der Vasallen, die 1387 von Abt Pilgrim von Siegburg belehnt wurden, heißt es: „Item in den eirsten den hoff zo Dorppe haidende II morgen off daebi. Item XXX morgen ackerlantz bi Dorpe. Item XII morgen buschs“.
Am 7. April 1420 belehnt Abt Wilhelm Spieß zu Siegburg Tilmann, Tilmanns Sohn von Scheid, mit dem Hof zu Dorp.3 Dies finden wir bestätigt, als am 19. 4.1421 der Pastor Arnold von Wahlscheid bekannt macht, daß „Teill, Sohn des Kuno von Kirchscheid, nach dem Tode seines Bruders Peter als Mannlehen das Erbe und Gut, gelegen im Kirchspiel Wahlscheid, zu Dorp empfangen hat, und zwar die Hofstatt zu Dorp mit 24 Morgen Land, einem Busch gen. Hart, einem Busch gen. Naeffen sowie einem Bruch von 3 Morgen“. Am 22.9.1457 gibt Henne van Dorpe bekannt, daß ihn der Abt Wilhelm Spieß zu Siegburg mit dem Dorperhof, den früher Arnold von Rengeroede innehatte, belehnt wurde.
Bei der „Auftragung der Untersassen des Herzogtums Berg“ aus dem Jahre 1487 erklärt sich „elsse van dorp“ bereit, Herzog Wilhelm II. ein Darlehen zu geben.
Im Mitgliederverzeichnis der Birker Marienbruderschaft aus dem Jahre 1503 finden wir „Johan van dorp“ als Mitglied aufgeführt.7
Am 8.2.1514 wird Johann zum Seiffe von Dorp von Abt Gerhard von Plettenberg zu Siegburg zum Lehnsmann von Dorp gemacht. Aus dieser Urkunde geht hervor, daß Dorp vorher Johanns Vater Heime gehört hat. Die Urkunde wurde u. a. von Arnold v. Markelsbach gen. Allner gesiegelt.
Weitere Ortsnamenbelege sind 1555 Dorp,9 1644 Rittersitz Dorp, 1646 „Junker Wilhelm von guelich zue dorpe“, 1715 Zum Dorp (Ploennis-Karte 9) als Adelshof bezeichnet, 1790 H. Dorp (Wiebeking-Karte 10), 1817 Haus Dorp (Tranchot-Karte 12) und 1858 Hausdorp.
Zur weiteren Geschichte: Haus Dorp war im 15. Jahrh. bereits im Besitz der Familie von Markelsbach gen. Allner. Die Tochter Sibylla (geb. 1550) des Heinrich v. Markelsbach gen. Allner, heiratete um 1566 Wilhelm von Gülich zu Berg vor Floisdorf. Durch diese Heirat kam Haus Dorp an die Familie von Gülich, die reformiert war.
So ist es auch zu erklären, daß Haus Dorp als einziger Rittersitz im Kirchspiel Honrath/Wahlscheid nicht katholisch blieb. Nach dem am 26.4.1672 zu Cölln an der Spree abgeschlossenen Religionsvergleich wurde den Reformierten erlaubt, auf Haus Dorp „freie Religionsausübung“ zu halten, d. h. die Reformierten von Wahlscheid, Honrath, Seelscheid und Volberg konnten hier ihre Gottesdienste halten. Das galt bis 1825, als die Reformierten und Lutherischen Gemeinden den Namen einer Evangelischen Gemeinde (Union) annahmen.
Wilhelm von Gülich starb um 1601. Seine Frau überlebte ihn noch 30 Jahre und starb am 2. April 1631, wie aus dem Text der noch vorhandenen Grabplatte hervorgeht, die mit den Wappen ihrer Vorfahren heute an einem Wirtschaftsgebäude des Hauses Dorp angebracht ist.
Im Jahre 1644 hatte Wilhelm von Gülich, Sohn des Vorgenannten, an Hafer für den Landesherrn abzuführen: „vom Gut zu Dorp, vorhin Heinrich von Allner, von Meys Höfen, vorhin Heinrich zu Allner, von der Roderhöhe, von Rolands Gut zu Dorpe, von Claessens Gut zu Dorp, vorhin Heinrich von Allner, je 1 Foeder. Daraus geht hervor, daß es um diese Zeit schon mehrere Höfe auf Haus Dorp gegeben haben muß.
Im Laufe der Jahrhunderte verschuldete die Familie von Gülich auf Haus Dorp immer mehr, bis nach dem Tode von Wilhelm Ludwig von Gülich und seiner Gemahlin Charlotte Friederika Wilhelmina Ernestina von Homburg, Sayn und Wittgenstein Haus Dorp in den Besitz der „Erben von Doläus und von Cronenberg“ überging. Von diesem wird der Halbwinner (Pächter) Heinrich Schiefelbusch Haus Dorp als Gut gepachtet haben. Nun wechselte Haus Dorp sehr schnell die Besitzer. 1767 wurde das Gut an Gottlieb Ludwig Josef von Leers auf Haus Leerbach verkauft. Das Gut, 1770 mit 108 Morgen Ackerland, 150 Morgen Büsche und 20 Morgen Wiesen auf 10 600 Reichstaler geschätzt, kam nun an Anselm von Spies zu Büllesheim, der es am 14.10.1785 an Ludwig Wilhelm Wackerzapp und dessen Gemahlin Maria Elisabeth Fuchs verkaufte. Die neuen Eigentümer verkauften Haus Dorp bereits schon am 10.11.1787 an den Elberfelder Bürgermeister Johann Rüdiger Siebei, der mit Johanna Katharina Wülfing verheiratet war, für 18 300 Reichstaler. Dem Käufer wurde „auf Ehre und Gewissen versichert, daß der verkaufte Rittersitz Dorp ein freies allodiales Rittergut sei, welches weder mit einem Lehnsnoch fiedei Commihs (unveräußerliches Familiengut) weder mit einem sonstigen Band irgend an jemanden verstrickt sei“.
1858 zählte Hausdorp 34 Bewohner, 1864 37 Bewohner. Im Jahre 1871 wohnten 31 und 1875 32 Personen in 6 Wohnhäusern.
Dorpmühle, westlich von Hausdorp in einem Siefen zum Aggertal hin gelegen: Diese Mühle wird nicht im Rentund Lagerbuch von 1644 erwähnt. Trotzdem aber kann sie um diese Zeit schon bestanden haben, und zwar als eine Privatmühle zu Haus Dorp. Sie hatte 1858 7 und 1864 8 Bewohner. 1871 wohnten hier 9 und 1875 10 Personen in einem Wohnhaus.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Hausen,
auf dem südlichen Riedel zwischen Naafbach und Agger an der Straße von Kreuznaf nach Oberstehöhe gelegen:
Den ältesten Namensnachweis bringt Dittmaier aus dem Jahre 1415 als Husen.
Erst im 17. Jahrhundert erfahren wir mehr über den Ort. Nach den Heberegistern (Steuerlisten) des Amtes Blankenberg aus der Honschaft Wahlscheid aus dem Jahre 1644 sind in Haußen fünf Familien abgabepflichtig: „Steffens Peter, Heitgen, Henrich Schneider, Wilhelm Muhler und Schwetz Henrich“.
In den Huldigungslisten des Jahres 1666 erscheinen 9 Eintragungen zu haußen.
Weitere Schreibweisen finden wir 1715 (Ploennis, K 9) und 1790 (Wiebeking, K 10) als Husen und auf der Tranchot-Karte von 1817 (K 12) Hausen. Im Jahre 1858 zählte die Siedlung 45, 1864 48 Einwohner. 1871 wohnten 40 Personen und 1875 38 Personen in 8 Wohngebäuden.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Die Siedlung befindet sich auf dem Sandstreifen, der sich im Nordosten des Lohmarer Waldes vor das bei Birk und Inger beginnende Lößplateau schiebt. Die Zeithstraße (B56), die den Ort im Südosten begrenzt, bildet gleichzeitig die Grenze der Stadt Lohmar zum Stadtgebiet Siegburg/Braschoß. Ca. 500 m nordöstlich von Franzhäuschen, das zu Heide gehört, verläuft die Gemeindegrenze etwas von der Zeithstraße zurück, der Hüttenstraße folgend, am Schiefelhof einen Zipfel ausklammernd, dann wieder der Zeitstraße folgend.
Bezüglich des Siedlungsnamens handelt es sich um ein wiederbesiedeltes, schon in prähistorischer Zeit entstandenes Heidegebiet. Was sich heute als geschlossene Ortschaft ansieht, war vor etwa 250 Jahren eine ausgesprochene Streusiedlung: Im Dreieck zwischen Auelsbach und Zeithstraße liegt der Schiefelhof, südwestlich Franzhäuschen, mitten im Dreieck der Hof Heide und nahe am nördlichen Heiderand über dem Auelsbach das Gut Siefen, das wohl nach dem Auelsbachsiefen (Albachsiefen) seinen Namen erhalten hat. Der Ort verdichtete sich zuerst um den Schiefelhof. In den Heberegistern von 1644 werden „Johan Schneider auf dem Scheiffelshof, Greitgen Thomas Tochter aufm Scheiffelhoff“ und „Haagens Erben zu Waahn wegen Scheiffelhoffs und Breiddenbachs“ genannt. Im Wertier- und Landmaßbuch von Inger aus dem Jahre 1711 werden „Braunß erben zum Schieffelhoef, Catharina auff dem Schiefelhoef, Dietherich Rötgen auf dem Schieffelhoef, Gretha Haußmanß auff dem Schieffelhoef, Johanneß Rechtman auff dem Schieffelshoeff, Peter Haußman auff dem Schiefelhoff, Schrick Johanß erben auffm Schiffelhoff, Wymar Fuchs auffm Schiffelhoff und Wilhelm Haußman auffm Schieffelhoeff“ genannt. Von den genannten Personen besitzen mindestens 5 eine Hoflage „auf dem Schiefelhof“ (genau ist die Anzahl nicht zu ermitteln, da einige Seiten im Wertierbuch fehlen). Aus dem Schiefelhof ist also fast eine Ortschaft für sich geworden, die gegenüber von Schreck lag.
Im Wertier- und Landmaßbuch der Honschaft Inger finden wir die Flurbezeichnung „Auff der alten Landwehr hinter dem Schieffelhoff“. Dies läßt vermuten, dass beim Schiefelhof eine solche Wehranlage, deren es entlang der Zeitstraße mehrere gab, vorhanden war. Sie sollten vor Wegela-gerern, fahrendem Volk und Plünderern schützen. An der Kapellenstraße/Am Schiefelhof in Heide befindet sich die kath. Kapelle St. Franziskus Xaverius. Anlässlich einer Volksmission errichteten die Nachbarn vom Schiefelhof 1734 ein Holzkreuz, zu dessen Schutz man schon 1735 eine kleine Holzkapelle baute.
Im Birker Bruderschaftsbuch aus der Zeit von 1503 bis 1538 wird im Mitgliederverzeichnis ein „lambert up der heyden“ genannt. Urkundliche Nennungen liegen aus dem Jahre 1644 mehrfach vor. In den Heberegistern des Amtes Blankenberg aus dem Jahre 1644 werden in der Honschaft Inger „Reinhart Haußman uf der Heiden“ und „Reinhard und sein Schwager Peter auf der Heiden“ als abgabepflichtige Bürger genannt. Im Verzeichnis der Vogteien (Steuerliste) von 1646 finden wir „Kiefferdops erben zu bierck, vorhin Johan Spelman, dabevorm Simon auff den Heiden“. Im Jahre 1666 leisten „die heyden“, d. h. folgende Familienvorstände aus Heide, den Erbhuldigungseid, nämlich „reinhart haußman, jung reinhart, alflaisß(?) daselbst“. Weitere Schreibweisen ergeben sich aus den Taufbüchern von Lohmar, und zwar 1689 Heiden, 1702 und 1727 von der Heyden89, aus der Ploennis-Karte von 1715 wieder Helden (K 9). Im Wertier- und Landmaßbuch von Inger aus dem Jahre 1711 finden wir als Hofbesitzer „Gerharts Wittib, Heinrich Schuemacher Wittib, Johanneß Peter Spielman und Jung Reinhardt auff der Helden“. Weitere Schreibweisen finden wir auf der Karte von Zimmermann aus dem Jahre 1807 Heyd, das hier außerhalb der Kirchspielsgrenze eingetragen ist, und auf der Tranchot-Karte von 1817 Heide.
Der schnell wachsende Ort Heide war 1829 bereits ein Dorf mit 112 Bewohnern an 24 Feuerstellen. Im Jahre 1843 wohnten hier 132 Personen (davon 124 kath. und 8 Juden) in 26 Häusern. 1872 wohnten 120 Personen in 22 Wohnhäusern und 25 Haushaltungen. 2023 leben in Heide ca. 2.000 Einwohner.
Quelle: Wilhelm Pape, Siedlungs- und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar, 1983
Hitzhof,
bei Wahlscheid: Dieser Hof liegt ebenfalls rechts der Agger in unmittelbarer Nähe des oben genannten Brückerhofes.
Die Bedeutung des Bestimmungswortes „Hitz“ könnte über das ahd. „hiruz, hirz“ und das mhd. „hirz“ und „herte, harte“ für das Wort Hirsch zu finden sein. Dittmaier bringt „Hirtz“ aber auch mit „Herz“ in Verbindung und meint damit ein herzförmiges Grundstück.
Als ältesten Namensbeleg können wir Hitzhof auf der Ploennis-Karte von 1715 ausfindig machen. Der Name erscheint mehrfach in den Taufregistern der Pfarre Lohmar: 1723 Hitsauel, 1729 Hitzauei, 1742 Hirtzhoff. Wiebeking übernimmt 1790 die Schreibweise Hitzhoff . Die gleiche Bezeichnung finden wir auf einer Flurkarte von 1822.
1829 wohnten hier 7 Personen an einer Feuerstelle, 1843 9 Personen (interessant, daß alle 9 Personen trotz des nur wenig entfernten Brückerhofes katholisch sind). 1872 werden auf dem Ackergut 11 Bewohner gezählt.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Höffen,
bei Wahlscheid, auf dem Höhenrücken zwischen Naafbach und Agger an der Höhenstraße von Kreuznaaf nach Oberstehöhe gelegen. Unterhalb dieser Ortschaft entspringt der Maarbach, der zwischen Bachermühle und Wahlscheid in die Agger mündet.
Die Vermutung liegt nahe, daß diese Siedlung von Anfang an aus mehreren Höfen bestand. Möglich wäre auch eine Ableitung vom Familiennamen Hoyff. Wahrscheinlich ist das Letztere zutreffend; denn bei den Erhebungen gegen Mitte des 17. Jahrh. wird nur immer ein Hof bzw. ein Name genannt. So in den Steuerlisten des Jahres 1644: „Severin Schuehmacher Uff den hoeffen der Pechter uff gewin“. Auch in den Erbhuldigungslisten des Jahres 1666 erscheint nur ein Name: „Wiedib auf den Hoffen krank“. Auf der Ploennis-Karte von 1715 erscheint er als Freihof unter dem Namen Höfen. Bei Wiebeking finden wir bereits die heutige Schreibwseise Höffen.
Erst im 19. Jahrh. müssen weitere Siedlungen dazu gekommen sein. Höffen hatte 1858 22 und 1864 sogar 35 Bewohner. 1871 wurden 23 Personen und 6 Wohngebäude, 1875 24 Personen und 5 Wohnhäuser gezählt.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Hohn
diese Siedlung liegt zwischen Münchhof und dem Südhang des oberen Quellsiefens des Em-mersbaches.
Im Jahre 1644 wurden im Amte Blankenberg neue Heberegister (Steuerlisten) angelegt. Dabei erscheinen in der Honschaft Wahlscheid „Drieß Erben vom Haen, der halbman uff gewin und Wilhelm Koll zum Haen“ als abgabepflichtig15. „Klein Drieß erben zum Haan“ erscheinen 1646 im Verzeichnis der Vogteien, einer besonderen Abgabe.
Im Jahre 1666 leistet ein „Johan zum haan“ den Erbhuldigungseid.
Auf der Ploennis-Karte von 1715, auf der Wiebeking-Karte von 1790 wie auch auf der Tranchot-Karte von 1817 finden wir die Schreibweise Hohn.
1858 zählte Hohn 19 Einwohner, 1864 sogar 30. 1871 wohnten 27 Personen in 8 Häusern und 1875 ebenfalls 27 Personen, aber in 6 Wohnhäusern.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Höhnchen
bei Neuhonrath: Fahren wir von Bachermühle (B 484) nach Neuhonrath und weiter einen kleinen Siefen aufwärts, gelangen wir sehr bald an eine scharfe Kehre. Kurz dahinter, am Wege nach Oberstehöhe, liegt Hähngen am sanften Abhang zu einem weiteren kleinen Siefen, nach Norden und Osten durch einen Waldstreifen geschützt.
Bei diesem Siedlungsnamen haben wir eine der o. g. Verkleinerungsformen vorliegen. Heute noch handelt es sich hier um eine der vielen Kleinsiedlungen in unserer Gemeinde.
In den Heberegistern (Steuerlisten) des Amtes Blankenberg von 1644 wird in der Honschaft Honrath der Hof „Zum Häntgen“ mit den üblichen Abgaben jener Zeit belegt. Im Jahre 1666 leistet ein „Wellhem zum hengen“ den Erbhuldigungseid in den sog. Erbhuldigungslisten der Honschaft Honrath.
Auf der Ploennis-Karte von 1715 erscheint der Hof Höngen, die Wiebeking-Karte von 1790 verzeichnet Hagen, Tranchot 1817 Hähnchen. Die letzte Schreibweise findet sich auch in den Ortschaftsverzeichnissen ab 1858. Erst 1875 lautet die Schreibweise Hänchen.
1858 hatte die Siedlung 10 Bewohner. 1875 wohnten 9 Personen in 3 Wohngebäuden13.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Honrath:
Von Honrath, auch Althonrath genannt, sehen wir – von Overath kommend – rechts der Agger über dem Ort Agger und Naafshäuschen auf einem Bergvorsprung weithin sichtbar die Honrather Kirche. Wir erreichen den Ort entweder von der B 484 über Agger und Jexmühle oder von Wahlscheid vor Schloß Auel links bergan bis zur Höhenstraße Scheiderhöhe Heiligenhaus, dann rechts etwas bergab bis zur Kirche und Burg.
Der Name Honrath wird abgeleitet vom ahd. „hagan“ = eingefriedigtes Gut. Aus dieser Bezeichnung geht hervor, daß Honrath ursprünglich eine Einzelhofsiedlung war, aus der sich ein Rittersitz und allmählich um ihn herum eine Ortschaft entwickelte, die sich bis zu einem Dorf ausweitete.
Den ältesten Namensbeleg finden wir bei Fahne: Im Jahre 1102 werden Rorich und sein Sohn Ludwig aus dem Geschlecht derer von Trostorp bei der Schenkung von Hagenraed an die Abtei Siegburg genannt. Diese Schenkung wird mit einer Urkunde vom 29.3.1117 durch Erzbischof Friedrich I. von Köln bestätigt. Gottfried, der Sohn Brunos, habe sein Allod zu Hagenroth dem Kloster Siegburg zu seiner Momorie für sich und seine Vorfahren übertragen.
Auch im Siegburger Mirakelbuch von 1183 wird Honrath erwähnt. „In proxima nobis villa, Hagenrode dicta,...“, heißt es dort. Hier wird erzählt, daß ein Knabe aus Honrath, von Krankheit erschöpft, im Sterben lag. Die Eltern flehten zum hl. Anno und gelobten, den Knaben in Korn aufzuwiegen und den Erlös zu opfern. Unverzüglich wurde der Knabe gesund, und die Eltern schickten den Kornerlös zum Grabe des Heiligen.
Im Jahre 1203 bestätigt Erzbischof Adolf I. von Köln die von Probst Godfried zu St. Gereon und von dessen Erben Dietrich von Hengsbach genehmigte Schenkung des Zehnten von verschiedenen Gütern zu Hanrode an das Kloster Gräfrath.
Im Jahre 1209 schenken Graf Arnold von Hückeswagen und seine Frau Adela das Patronat der Kirche zu Hahnrode mit allen Appertinentien (Zubehör) – außer des Hauses, das an den Turm stößt – dem Kloster Gräfrath. In dieser Urkunde wird zum ersten mal eine Honrather Kirche erwähnt, die nach Dehio und Delvos der hl. Margaretha geweiht ist, wogegen Rosenkranz von einem Patronat des hl. Georg spricht. Um diese Zeit war der Kirchturm ein Wehr und Wohnturm und wurde später als freistehender Bergfried durch einen Gang im 1. Obergeschoß mit der „Burg“ verbunden.
1259 wurde die „Burg zu Hainrode“ an die Grafen von Sayn verkauft, von denen sie die Herren von Loen-Heinsberg erbten. Diese verkauften die Burg 1363 mit dem Kirchspiel Honrath an die Grafen von Berg, welche zunächst die von Wachtendonk damit belehnten. Im Jahre 1393 aber war Haus Honrath schon im Besitz des Düsseldorfer Kollegiatstifts.
Unter Bergischer Herrschaft gehörte Honrath zum Amte Blankenberg und bildete mit Wahlscheid einen Dingstuhl für die Honschaften Durbusch, Kern, Hoe, Ober-, Mittel und Niederhonschaft.
1482 bestimmten Dechant und Capitel der Christianität Siegburg, in welchem Umfang die Abtei Gräfrath, die das Patronat innehatte, zum Neubau der Kirche zu Honrath verpflichtet sei.
Nach einer Erbteilung des Jahres 1541 ist Haus Honrath im Besitz derer von Lüninck. Dieser Joist Lüninck (auch Lüning = Sperling geschrieben) ist 1575 Schöffe zu Siegburg. Der humorvolle Aufsatz „Joist Lünincks Braut-fahrt“ von Ludwig Traude, erschienen in Heimatblätter, Sept. 1939, Heft 3, Seite 173. Joist heiratete Giesel von Etzbach. Aus dieser Ehe ging Henrich hervor, der am 30. 9. 1578 zu den Anerben des Altenforstes gehörte. Henrich heiratete am 15.11. 1581 Elisabeth von Eller. Aus dieser Ehe ging Gertrud Erbin zu Honrath, hervor, die 1610 Christian von Hammerstein ehelichte (So bei Fahne I, 263). Nach R. Steimel kam nach Heinrich Lüninck Haus Honrath durch Heirat zunächst an die Familie Neuhoff gen. Ley (spätere Schultheißen von Honrath und Wahlscheid), und um 1600, wieder durch Heirat, an die Familie von Hammerstein.
Namensbelege aus dieser Zeit ergeben sich aus dem „Erkundigungsbuch über die Gerichtsverfassung im Herzogtum Berg“ aus dem Jahre 1555 Honrod, aus einer Karte von Hondius um 1600 Harnrad und einer Hexenprozeßakte von 1637 Hunerot.
Nach dem Rent und Lagerbuch des Amtes Blankenberg aus dem Jahre 1644 wurden in Schachenauel die Gemeindegenossen von Honrodt und Wahlscheid bezüglich des Futter und Hühnerzehnts befragt. Diese und weitere Abgaben, sowie Rechte wurden genau festgelegt und vom damaligen Schultheißen zu Honerott und Wahlscheid Wirmar Ley unterschrieben.
Aus dem gleichen Jahre stammen die Heberegister des Amtes Blankenberg. Auch sie tragen die Unterschrift des „Weymar Ley, Scholtheiß zu Hanrodt und Walscheit“.
1646 werden die „Vogdeien der hondschafft Honraedt und Walscheidt“ neu gelistet. Hier erscheint auch ein „Joest von Hammerstein zum Hanradt von Hoenerßberg“.1666 werden auch im Kirchspiel Hanrat die sog. Erbhuldigungslisten ausgelegt.
Durch Erbteilung kam Haus Honrath 1716 über die von der Reven an die Stael von Holstein zu Eulenbroich. Von diesen erwarben es mit Haus Auel die von Proff zu Menden, von denen es durch Heirat 1766 an die Familie von Doetsch zu Firmenich kam. Um 1800 erwarben es die von Broe, um 1825 die Freiherren von Lavalette St. George mit 198 Morgen Land.
1860 wurde Generalleutnant von Niesewand Besitzer der Honrather Burg, die von dessen Erben 1919 an den Gutsbesitzer Schlenkhoff zu Gut Plantage zu Ostheim überging. 1930 wurden die Geschwister Otto zu Honrath Besitzer der Burg.
An weiteren Schreibweisen für Honrath finden wir 1673 und 1690 Harnrad, auf der Ploennis-Karte von 1715 Honrath.
Auch der 7-jährige Krieg ging an Honrath nicht spurlos vorüber. Im Jahre 1759 hat das „Kirspel Honrath“ als Kontribution 480 Pfund Heu, 2754 Pfund Hafer und 108 Pfund Stroh liefern müssen.
Auf der Wiebeking-Karte von 1790 lautet die Schreibweise Hohnrath, auf der Tranchot-Karte von 1817 Alt-Honerath.
1858 hatte Honrath 79 Bewohner, 1864 54 Bewohner. 1871 wurden 52 Personen in 9 Wohnhäusern gezählt, 1875 sogar nur noch 44.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Hoven bei Honrath,
auf halber Höhe nördlich der Bundesbahnlinie Overath – Köln gelegen: Da dieser Siedlungsname nicht mit einem Personennamen gebildet wurde, ist anzunehmen, daß er jüngeren Datums ist. Vielleicht geht der Name aber auch auf „Hufe“ = Stück Land von bestimmter Größe zurück.
Den ältesten Namensbeleg finden wir in den Heberegistern (Steuerlisten) des Amtes Blankenberg aus dem Jahre 1644. Hier werden „Metha, Billes Erben und Hammersteins pechter zur Houen“ als abgabepflichtig geführt.
Ein „freiz zur hauffen“ leistet 1566 den Erbhuldigungseid.
Auf der Ploennis-Karte von 1715 finden wir die Schreibweise Z. Hufen (K 9). Die gleiche Bezeichnung entdecken wir auf der Wiebeking-Karte von 1790 (K 10). Ab dem 19. Jahrh. wird der Name als Hoven geschrieben.
1858 hatte Hoven 56 Einwohner, 1861 sogar 62. Dann aber sinkt die Einwohnerzahl bis 1871 auf 53 und 1875 auf 48 Personen in 8 Wohngebäuden.Das Anwachsen der Bevölkerungszahl um die Mitte des 19. Jahrhunderts könnte auf die rege Bergwerkstätigkeit in diesem Raum zurückzuführen sein.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Der Ort liegt westlich von Birk auf einem von West nach Ost verlaufenden Bergriedel. Trotz der vielen Abwandlungen des Siedlungsnamens und der sehr frühen Namensbelege ist die Bedeutung des Wortes Inger unbekannt.
In einer Urkunde vor dem 4. Dez. 1075 (1075 vor Dezember 4) bekundet Erzbischof Anno II. von Köln die Gründung des Klosters Siegburg, legt dessen Rechtsstellung fest und führt dessen Besitz auf. Darunter befinden sich 9 Mansen oder Hufen Land zu Inger. In der Urkunde heißt es: „De beneficio Regimari in Mulindorf, Truhtesdorf et in Inere Vllll mansi et in Kazbach...“ = Vom Lehen des Regimar in Mülldorf, Troisdorf und in Inger 9 Mansus und in Katzbach... In der gleichen Urkunde wurde bestimmt, daß die Bewohner von Inger am zweiten von drei festgesetzten Tagen vor dem abteilichen Gericht zu Siegburg erscheinen mußten. Ähnliches finden wir in weiteren Urkunden von 1076-1078 und um 1105. Am 28. Nov. 1109 bestätigt Papst Paschalis II. die Besitzungen des Klosters Siegburg, darunter auch die Besitzung in Inere. In einer Urkunde vom 9. Mai 1174, nach der Kaiser Friedrich I. das Kloster Siegburg und seine Besitzungen in seinen Schutz nimmt, lautet die Schreibweise Inre.
Auch im Siegburger Mirakelbuch von 1183 befindet sich die gleiche Bezeichnung: „Puella de villa, cui Inre vocabulum est,...„ Hier wird erzählt, daß ein Mädchen aus Inger durch eine verborgene und den Frauen eigene Krankheit, die es nur unwillig eingestand, befallen war. Als es sein Gelübde und sein Gebet zum hl. Anno vollendet hatte, kehrte es gesund und froh nach Hause zurück.
Nach 40 Jahren taucht in einer Urkunde von 1223 für Inger die Schreibweise Ynre auf. Erzbischof Engelbert I. von Köln bestätigt hier abermals die Besitzungen des Klosters Siegburg. Die gleiche Bezeichnung Ynre enthält eine Urkunde vom 16. Mai 1395, nach der Kunigunde, die Witwe Heinrichs von Aldenach, Ländereien im Kirchspiel Lohmar in Erbpacht nimmt: einen Morgen Ackerland, gelegen „bi Erve Eilges van Ynre“.
Zu den Mitbegründern der Birker Marienbruderschaft im Jahre 1503 zählen „hennes tzilgen eidom van Ynger, moen tzilge van Ynger, hennes van Ynger, der son (wahrscheinlich der Sohn des Druyck van Aldenach) van Ynger und greitgyn greten dochter van Ynger“. Ein am 1.8.1538 aufgestelltes Register der Mitglieder der Birker Marienbruderschaft ist u. a. auch von einem „Johannes am Pütz zu Ingeren“ unterzeichnet.
Bei der „Auftragung der Untersassen des Herzogtums Berg“ aus dem Jahre 1487 erklärt sich ein „koen van ynnere“ bereit, seinem Herzog mit einem Darlehen auszuhelfen.
Nach der „Erkundigung über die Gerichtsverhältnisse im Herzogtum Berg“, hier Amt Blankenberg, vom 15. 5.1555 bestand zu Engern ein Hofgericht der Minoriten zu Seligenthal.
Aus dem Pastoratslagerbuch von Lohmar aus dem Jahre 1582 erfahren wir, daß die Pfarre Lohmar zu Inger einen Hof besaß, für den der jeweilige Pächter an den „zeitlichen pastor“ zu Lohmar die Pacht in Form von Naturalien, Geld und Diensten zu entrichten hatte. Es heißt: „Villa in Inger: Der Inger hoff gebe jahrligst wie folgt: septemdecim maldera siliginis (Weizenmehl), 10 maldera avena (Hafer), 1 sester erbsen oder weitze, 100 eyer, 3 par höner, 8 pfund wohlgehechelten flachst, 4 maßen butter mit der uettmaßen gemeßen, und zwey gute Käse, ein pfund pfeffer und ein pfund genyber, einen golt gl zum newen Jahr, ein fett Kalb, sonder buschen schoeff zu behueff des Widenhoffß, ein Viertel holtz auf die sieg auf sein Kosten fahren oder ein halb Viertel auf sundorff; Item soll er alle Jahr drey tag mit dem pferd dinen auf seine Kosten, nur daß ich den Knecht soll beköstigen; 2 die beste säw“. An anderer Stelle heißt es: „Auß Inger gibt Jahnnes auf dem heufei gegen dem pütz über also beßgen seelig gewohnt hatt jährligs zwey höner“.
Aus dem Rent und Lagerbuch des Amtes Blankenberg aus dem Jahre 1644 erfahren wir, daß die Honschaften „Haiberich und Ingern“ auf der Bicher Mühle (Siehe Seite 272) ihr Getreide mahlen lassen mußten. Bei der Auflistung der Adelshöfe im Kirchspiel Lohmar heißt es: „Junker Schenkern zu Unterbach hat auch alhir einen Hof zu Ingern, so frey ist. Woraufer zu Feit ziehen 3 Pfert“. Auch ein geistlicher Hof wird genannt: „Item mehrgenannter Herr Pastor hat auch noch ein Hofgen alhir in Ingeren Hontschaft. Woraufer zum Ackerbaw gehet... 1 Pfert“. Grundbesitz, der zu diesem Pastoratshof gehörte, ist heute noch im Besitz der Lohmarer Pfarrei.
Auch die Limiten (Grenzen) der „Innger Hondtschafft“ werden 1644 neu beschrieben (Siehe Anhang Nr. 20). Sie sind mit Datum vom 14. 7.1644 unterschrieben von „Peter Wißman Ambtknecht deß Kyrßpelß Lohmar und heinrich hermerott scheffen deß Landtgerichtes Neunkirchen“. Diese Unterschriften sowie die eines Conradt Putz und und Heinrich Roerich finden wir auf allen Erhebungen jener Zeit.
Mindestens 16 Namen von Grundbesitzern erfahren wir aus den Heberegistern des Amtes Blankenberg aus dem Jahre 1644: „Peter am dohr, Gotthart Putz, Conradt Putz (siehe oben), Johan Schmit, Heinrich Hermerot (siehe oben), Heinrich am Putz, Geörgh Kornhauß“, um nur einige zu nenen. Gleiche und auch weitere Namen finden wir in der Auflistung der Vogteien in der Honschaft Inger aus dem Jahre 1646, außerdem die Namen der Güter: „Wießmans guett, das Pastor guett, Schinkernshoff, heitges hoff“, ebenfalls in der „Erbhuldigungsliste“ von 1666. Aus dieser Liste geht hervor, daß damals 14 Haushaltsvorstände aus Inger und 43 aus der gesamten Honschaft den Erbhuldigungseid leisteten.
Fassen wir alle diese Einzelheiten zusammen, müssen wir erkennen, daß Inger nicht nur für die gleichnamige Honschaft, sondern auch für das Kirchspiel Lohmar eine überaus wichtige Rolle spielte. Vielleicht liegt hierin auch der Grund, daß Inger bis in unser Jahrhundert hinein nach Lohmar und Altenrath der drittgrößte Ort in der Bürgermeisterei Lohmar wurde. 1829 wohnten in Inger 160 Personen an 37 Feuerstellen. 1840 zählte der Ort 193 und 1843 sogar 225 Einwohner. Dann ging die Einwohnerzahl geringfügig zurück: 1851 wurden 214 und 1872 216 Bewohner in 38 Häusern gezählt Weitere Schreibweisen für Inger finden wir in den Taufbüchern von Lohmar, und zwar 1699 und 1702 Ingerrn, ferner auf der Ploennis-Karte von 1715 (9) wie auch auf der Wiebeking-Karte von 1790 (10) Enger. In den Wertieru. Landmaßbüchern von Inger aus dem Jahre 1711 und von Lohmar aus dem Jahre 1746 lautet die Schreibweise bereits Inger.
Der Ort hat seine große Bedeutung als Bauerndorf und als Verwaltungssitz der ehemaligen Gemeinde Inger 1969 mit der kommunalen Neuordnung verloren.
Schauen wir jedoch zurück in die Zeit um 1900, so stellen wir fest, dass Inger nach Altenrath (ca. 570 Einwohner) und Lohmar (ca. 500 Einwohner) mit ca 220 Einwohnern der drittgrößte Ort in der Bürgermeisterei Lohmar war. Das erklärt auch den hohen Anteil an alter Bausubstanz, der bis heute erhalten blieb. Die vielen, meist gut gepflegten und restaurierten Fachwerkhäuser sind charakteristisch für Inger.
Ingerberg (Wüstung)
Wahrscheinlich hat die Ortschaft Inger dem waldbedeckten Höhenrücken zwischen Jabach und Auelsbach den Namen Ingerberg gegeben. Danach wurde dann der Hof benannt, der am Abhang zum Jabach ungefähr gegenüber der Einmündung der Haiberger Straße auf die Jabachtalstraße lag. „Hennes up ynerberch“ zählte zu den Mitgliedern der Birker Marienbruderschaft, die 1503 gegründet wurde.
Im Jahre 1563 wird im Protokollbuch der Kirchscheider Hofgedinge ein „Hennes am ingerberch“ genannt, der wegen eines Besitztums zu Pützrath an das Hofgericht zu Kirchscheid Abgaben zu leisten hatte.
Spätestens 1644 ist der Freihof „ufm Ingerberg“ im Besitz der Familie von Reven; denn im Rentund Lagerbuch des Amtes Blankenberg von 1644 heißt es: „Item Junker Reven hat noch ein Hof ufm Ingerberg gelegen, so frey ist und in die Hontschaft Lhoemar gehörich. Woraufer zu Feit gehet 1 Pfert“.
Im Limitenbuch des Amtes Blankenberg, hier Kirchspiel Lohmar (Siehe Anhang 20), vom 14. 7.1644 wird der Ingerberger Hof, und zwar der Ingerbergerß Bornen (Brunnen) bzw. der Ingerberger Poell (Wasserloch) als gemeinsamer Grenzpunkt der Honschaften Lohmar, Haiberg und Inger genannt.
Auch in den „Erbhuldigungslisten“ des Jahres 1666 wird der „halft ufm Ingerbergh“ genannt.
In den sog. „Pele-mêle Notizen“ zur Chronik von Lohmar bekundet Max von Reven (Siehe Burg Lohmar, Seite 144), daß er 1672 Besitzer von Haus und Hof Ingerberg ist, zu dem 20 Morgen Land, 4 Morgen Wiese, 42 Morgen Busch und 17 Morgen Biesen (Biesen = Binsen, riedartige Grasfläche; hier vielleicht Wiesen in der Lohmarer Buchbitze oder/und im Jabachtal) gehören.
Ein altes Grabkreuz an der Südseite der Lohmarer Leichenhalle trägt die Inschrift: „J.H.S. AD 1694 den 11. August starb die dugendsame Anna auf dem Ingerberg ggD“.
Im Wertierund Lagerbuch von Inger aus dem Jahre 1711 ist der Ingerberger Halffen als Grenznachbar zur Honschaft Inger vermerkt.
Ein solches Buch aus der Honschaft Haiberg von 1738 bringt als Grenzbezeichnung „die underste mahr wieß vorg. Ingerbergerhoff“.
Aus dem Wertierbuch von Lohmar aus dem Jahre 1746 geht hervor, daß ein „Adolf Hagen aufem Ingerberg“ den Hof besaß, und daß „auß diesem gut die Korfs Erben gekauft haben ein Viert, busch in Ingerbergh“.46 Ferner wird ein Joes adolf Ingerberg als Nachfolger der Peter Rötgen Erben genannt.
Weitere Namensbelege finden wir 1715 auf der Ploennis-Karte als Freyhof Engerberg (K 9) und 1790 auf der Wiebeking-Karte (K 10). Danach tritt der Hof nicht mehr in Erscheinung. Folglich muß er um die Wende zum 19. Jahrhundert aufgegeben worden sein. Von diesem Hof sind heute lediglich Reste der Fundamente des sog. Ingerbergskeller und -bornen erhalten. Wahrscheinlich hat dieser Hof auch einer Familie den Namen gegeben (siehe oben Joes adolf Ingerberg). In Troisdorf sind 1757 ein Peter Ingerberg und 1822 zwei Landwirte mit dem Namen Johann Ingerberg ansässig.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Zur Siedlung Ingerbergshof schreibt Wilhelm Pape in „Siedlungs- und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar“, 1983:
Wahrscheinlich hat die Ortschaft Inger dem waldbedeckten Höhenrücken zwischen Jabach und Auelsbach den Namen Ingerberg gegeben. Danach wurde dann der Hof benannt, der am Abhang zum Jabach ungefähr gegenüber der Einmündung der Haiberger Straße auf die Jabachtalstraße lag.
„Hennes up ynerberch“ zählte zu den Mitgliedern der Birker Marienbruderschaft, die 1503 gegründet wurde. Im Jahre 1563 wird im Protokollbuch der Kirchscheider Hofgedinge ein „Hennes am ingerberch“ genannt, der wegen eines Besitztums zu Pützrath an das Hofgericht zu Kirchscheid Abgaben zu leisten hatte. Spätestens 1644 ist der Freihof „ufm Ingerberg“ im Besitz der Familie von Reven; denn im Rent- und Lagerbuch des Amtes Blankenberg von 1644 heißt es: „Item Junker Reven hat noch ein Hof ufm Ingerberg gelegen, so frey ist und in die Hontschaft Lhoemar gehörich. Woraufer zu Feit gehet 1 Pfert“. Im Limitenbuch des Amtes Blankenberg, hier Kirchspiel Lohmar, vom 14. 7.1644 wird der Ingerberger Hof, und zwar der Ingerbergerß Bornen (Brunnen) bzw. der Ingerberger Poell (Wasserloch) als gemeinsamer Grenzpunkt der Honschaften Lohmar, Haiberg und Inger genannt. Auch in den „Erbhuldigungslisten“ des Jahres 1666 wird der „halft ufm Ingerbergh“ genannt. In den sog. „Pele-mêle Notizen“ zur Chronik von Lohmar bekundet Max von Reven, daß er 1672 Besitzer von Haus und Hof Ingerberg ist, zu dem 20 Morgen Land, 4 Morgen Wiese, 42 Morgen Busch und 17 Morgen Biesen (Biesen = Binsen, riedartige Grasfläche; hier vielleicht Wiesen in der Lohmarer Buchbitze oder/und im Jabachtal) gehören. Ein altes Grabkreuz an der Südseite der Lohmarer Leichenhalle trägt die Inschrift: „J.H.S. AD 1694 den 11. August starb die dugendsame Anna auf dem Ingerberg ggD“. Im Wertier- und Lagerbuch von Inger aus dem Jahre 1711 ist der Ingerberger Halffen als Grenznachbar zur Honschaft Inger vermerkt. Ein solches Buch aus der Honschaft Haiberg von 1738 bringt als Grenzbezeichnung „die underste mahr wieß vorg. Ingerbergerhoff“. Aus dem Wertierbuch von Lohmar aus dem Jahre 1746 geht hervor, daß ein „Adolf Hagen aufem Ingerberg“ den Hof besaß, und daß „auß diesem gut die Korfs Erben gekauft haben ein Viert, busch in Ingerbergh“. Ferner wird ein Joes adolf Ingerberg als Nachfolger der Peter Rötgen Erben genannt.
Weitere Namensbelege finden wir 1715 auf der Ploennis-Karte als Freyhof Engerberg (K 9) und 1790 auf der Wiebeking-Karte (K 10). Danach tritt der Hof nicht mehr in Erscheinung. Folglich muß er um die Wende zum 19. Jahrhundert aufgegeben worden sein. Von diesem Hof sind heute lediglich Reste der Fundamente des sog. Ingerbergskeller und -bornen erhalten. Wahrscheinlich hat dieser Hof auch einer Familie den Namen gegeben (siehe oben Joes adolf Ingerberg). In Troisdorf sind 1757 ein Peter Ingerberg und 1822 zwei Landwirte mit dem Namen Johann Ingerberg ansässig.
Jecksmühle,
am Jecksmühlenbach oberhalb des Bahnhofes Honrath bei Agger gelegen:
Auch diese Mühle ist bereits im Rent und Lagerbuch des Amtes Blanken-berg aus dem Jahre 1644 genannt. Die Familie von Lüninck zu Honrath soll die im Stockbuschauf dem Gecksbach gelegene Wasser-Kornmühle, Gecksmühle genannt, durch Kauf von denen von Ley zu Overath erworben haben. Hans Christoffel von Hammerstein, der 1610 Gertrud von Lüninck, Erbin zu Honrath, heiratete, geriet wegen dieser Mühle in Streit mit denen von Ley und prozessierte mit ihnen viele Jahre lang. Während dieser Zeit lag die Mühle still und wurde baufällig. Oberhalb dieser Kornmühle hatte der Herr von Hammerstein eine Ölmühle bauen und diese nachher in eine Kornmühle umändern lassen. Sie stand auf seinem Grund und Boden und mahlte nur für seine eigene Haushaltung.
Weitere Schreibweisen finden wir auf der Ploennis-Karte von 1715 Geeksmühle, auf einer Flurkarte von 1822 Jecksmühle und auf dem Ortsplan von Lohmar 1975 Jexmühle.
Sie zählte 1858 6 Bewohner. 1871 und 1875 wohnen dort 4 Personen28. Siehe hierzu auch Grube Aurora.
Am Jexmühlenbach, unweit der Jexmühle, lag die Grube Aurora. Sie wird bereits im Ortschaftsverzeichnis von 1858 mit 3 Bewohnern genannt. 1864 werden 4 Personen gezählt. Bei der Zählung von 1871 ist 1 männliche Person und 1 Wohngebäude aufgeführt. 1875 wurde nur noch ein verlasse-nes Gebäude registriert13. Sie muß jedoch später wieder in Betrieb genommen worden sein; denn im Personenverzeichnis von 1909 werden unter Jexmühle 22 Personen aufgeführt, darunter mehrere Bergleute, Maschinisten und ein Kantinenwirt. Sehr bald jedoch gilt sie wieder als verlassen.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Kirchscheid
bei Scheiderhöhe: Der Hof liegt ca. 800 m westlich von Scheiderhöhe an einem Verbindungsweg von Scheiderhöhe über Feienberg zum Sülztal auf der Lößfläche des Agger-Sülz-Höhenrückens.
Die Siedlung trug zunächst einmal den einfachen Namen Scheid. Nachdem hier eine Jakobskapelle errichtet worden war, wahrscheinlich noch vor 1276, erhielt die Siedlung später den Namen Kirchscheid, urkundlich nachgewiesen im Jahre 1526. Das im Jahre 1166 genannte Kerich und 1181 erwähnte Kerchich, das Delvos irrtümlich für Kirchscheid angesehen hat, bezeichnet ein Gut bei Obergartzem-Mersch, Kreis Euskirchen.
Zum erstenmal wird Kirchscheid in einer Urkunde aus der Zeit zwischen dem 8. 8. 1065 und dem 4.12.1075 als Sceida genannt. Erzbischof Anno II. von Köln überträgt mit Zustimmung des Abtes Erpho von Siegburg dem Edelmann Dietrich die Güter der Abtei Siegburg zu Sülz auf seine und seiner Gattin Lebenszeit, worauf sie ihren Besitz zu Kirchscheid dem Kloster überlassen. In der Urkunde heißt es: „...proprietatem, quam habuit in ioco Sceida, cum XXX mancipiis et omni usu, ...tradidit“ = er übergab den Besitz, den er in Kirchscheid hatte, mit 30 Leibeigenen und allen Rechten. So kam praktisch Kirchscheid im Tauschhandel gegen Haus Sülz an die Abtei Siegburg. Um 1105 bestätigt Erzbischof Friedrich I. von Köln die Rechte und Besitzungen des Klosters Siegburg, darunter auch die Besitzung in Scheida „Scheida, quod a quodam Theoderico et eius uxore Meinlinde per precariam acquisitum est“ = Scheid, welches von einem ge-wissen Theoderich und dessen Gemahlin Meinlinde auf Widerruf (zu Lehen gegeben) erworben worden war.
Die gleiche Schreibweise ergibt sich aus einer Urkunde von 1116.
Am 6. 1.1121 bestätigt Erzbischof Friedrich I. von Köln die schriftlich vorliegenden und wörtlich eingerückten Verfügungen Abt Kunos I., die dieser zum besseren Unterhalt der sich vergrößernden Zahl der Mönche getroffen hatte. Hierbei wird auch Scheyde genannt, das 4 Mark an die Abtei zu zahlen hatte, ferner Weizen und Gerste liefern mußte. In einer Urkunde aus dem Jahre 1140 bestätigt Erzbischof Arnold I. von Köln dem Kloster Siegburg die von Bruno II. vorgenommene Aufteilung der Kircheneinkünfte, ferner den Besitz und die Einkünfte des Klosters. Danach belaufen sich die Einkünfte aus Scheide auf 10 und 8 denarios.
Am 25.12.1275 weist Abt Adolf von Siegburg seinem Konvent für die geliehenen 100 Mark, mit denen er eine Schuld bei dem Juden Caleman bezahlt hat, Einkünfte des Hofes Kirchscheid – hier Scheida genannt – in Form von jährlich 30 Malter Weizen bis zur Abzahlung der 100 Mark an. Am 13.12.1276 verleiht Abt Adolf seinem Konvent den Abtshof zu Kirch-scheid – curtem abbatie in Scheyde mit näher bezeichneten Einkünften, behält sich aber die Wachszinsigen (Wachszinsiger = Person, die sich unter den Schutz des Klosters stellte und dafür reinen Wachs zu liefern hatte) des Jakobsaltares des dortigen Hofes – altaris beati Jacobi in ipsa curte – vor. Ein Kämmerer hat für die Instandhaltung der Fensterläden der Kapelle – luminaria ad capellam beati Jacobi – zu sorgen. Hier ist zum erstenmal auch von der Jakobskapelle zu Kirchscheid die Rede. Wir wissen nicht, wann sie errichtet wurde. Jedoch kann das nur zwischen 1100 und 1276 gewesen sein. Die Patroziniumforscher geben für die Gründung von Kir-chen und Kapellen mit diesem Schutzpatron die Zeit um 1200 an. Damit dürfte auch ungefähr der Zeitpunkt der Errichtung der Jakobskapelle gege-ben sein. Die Siedlung trägt jedoch immer noch den Namen Scheid. Das geht auch aus einer weiteren Urkunde um 1287 hervor, einem Verzeichnis der Geldeinkünfte der Abtei aus westfäli-schen und rheinischen Besitzungen. Hier heißt es, daß in Kirchscheid 7 ½ Mark gezahlt wurden – Ipso die in Scheide VII ½ marce. Der Siedlungsname war auch 1367 noch nicht geändert. In einer Urkunde vom 16.11.1367 ist die Rede von einer Wiese, für die an den Hof zu Scheide für die Kämmerei des Klosters 2 Pfennige Zins zu zahlen sind.
Im Jahre 1387 wird ein „Teilmann van Scheide“ mit einem Gut „Henkins“ belehnt.
Am 19.4.1421 wird in einer Urkunde ein gewisser „Teil, Sohn des Kuno“ zu Kirchscheid genannt, der Haus Dorp als Mannlehen erhalten hat. Bei der Verlehnung des Aulshofes wird am 22. 2. 1513 ein „Jorgens“ von Kirchscheid als Zeuge genannt.
Erst am 12.4.1526 hören wir von einem Hof zu Kerenscheide auf der Scheiderhöhe im Kirchspiel Lohmar. Abt Johann von Fürstenberg, Prior und Konvent zu Siegburg machen bekannt, daß sie für 400 Gulden den Hof zu Kirchscheid an den Probst und Dr. Antonius Fürstenberg auf Lebenszeit zu seinem Nutzen verkauft haben. Nach seinem Tode aber fällt der Hof wieder an die Abtei zurück.
Am 18.3.1560 kam es zum Weistum des Hofes zu Kyrschiedt, das in seinen wesentlichen Punkten im „Kyrchschiedt er hoffs Gedings Buch de 1560 bis 1565“ wiedergegeben ist. Auf diesem Gericht wurden alle dieses Gut betreffenden Streitigkeiten und Regelungen geschlichtet und ausgehandelt. Um diese Zeit war „Johann Wydenest rent-meyster und dener des gotzhuis Sybergh zo Kyrchschiedt“. An den Ge-richtsverhandlungen nahmen teil „Jannes zo Halbergh als scholtis, als Scheffenn peter zom eygenn, gillis zom scharrennbrogh, Jann zom siffenn, girret ynn der mullenn, Dreys zo Hammershouen, peter zo scherff, theyll zo lomer ym Haue, Kerstgen zom neuwenhuis u. Jarus zoe baich“55. Das o. g. Weistum war notwendig geworden, weil sich die Bergischen Her-zoge immer mehr in Privatangelegenheiten einmischten, dem sich der Siegburger Abt widersetzte. Solches geht auch aus einer Bittschrift vom 8. 8.1566 hervor, in der ein Bürger von Altenrath dem Herzog von Jülich-Kleve-Berg mitteilt, daß ihm ein gewisser Peter Bitter am Hofgeding des Siegburger Abtes zu Kirchscheid wegen 7 Viertel Land verklagt habe, daß Schultheiß und Schöffen zu Kirchscheid ihr Urteil bereits am 22. 4. zugunsten Bitters gefällt hätten, und daß dieses Urteil erst am nächsten Ge-richtstag zu Kirchscheid bekannt gegeben werde. Der Herzog wird um Vermittlung gebeten. Aus einer Urkunde vom 6.1.1582 erfahren wir, daß es Streitigkeiten zwischen dem Kloster Siegburg und Adolf von Bellinghausen, Herr zu Haus Sülz, wegen Haferlieferungen und Geldverpflichtungen an den abteilichen Hof zu Kirchscheid gegeben hat. Diese Streitig-keiten werden zwischen Abt Gottfried von Eyll und Adolfs Witwe, Gertrud von Elverfeld, beigelegt.
Am 10. 6.1586 ist auch ein „Braun zu Kirchscheidt“ Zeuge bei der Beschreibung des Weges von Wahlscheid zur Sülzer Brücke.
Weitere Schreibweisen finden wir auf einer Karte von Hondius um 1600 Kirchsei, in der Notiz Pfarrer Mohrenhofens aus der Zeit zwischen 1627 und 1645 Kirchscheidt, auf der Mercator-Karte von 1645 Kirchsey, in den Taufbüchern von Lohmar 1662 Kirchscheid und 1689 Kirchscheit, ferner auf einer Karte von Sanson aus dem Jahre 1673 Kirchsei.
In einer „designatio redituum“ (Erhebung kirchlicher Einkünfte) aus dem Jahre 1676 wird die Kapelle mit einer Bewertung unter der Pfarre Lohmar erwähnt: Kirchscheide capella gehöret quoad curam animarum nach lohmar, davon collator abbas (als Beisteuernder der Abt) in Sybergh61. Am 4. und 5. Mai 1676 wird der „hof zu Kirscheidt“, der „allerseits zwischen des godeshauß Sygberg güter gelegen“, neu vermessen. Wir erfahren, daß zum Kirchscheider Hof auch das Höfchen Oberstorf gehört.
Um diese Zeit hat also die Jakobskapelle noch bestanden. Delvos berichtet weiter, daß sie im 18. Jh. baufällig wurde und viel Material von ihr zum Neubau einer Kapelle auf der Scheiderhöhe im Jahre 1803 verwandt wurde.
Bis zu diesem Zeitpunkt, 1803, blieb Kirchscheid im Besitz der Abtei Siegburg. Dann wurde der Hof säkularisiert. Um 1820 ging er über an die Familie von Hymmen, die bei Fahne II, bereits im 18. Jahrh. als eine blühende rheinische Familie bezeichnet wird.
Weitere Schreibweisen für Kirchscheid finden wir auf einer Karte von N. Visscher aus dem Jahre 1690 Kirchsei , auf der Ploennis-Karte von 1715 Kirchscheiderhof, auf der Wiebeking-Karte von 1790 Kirch-scheid und auf der Hartmann-Karte von 1845 Kirscheiderhof.
1829 wohnten in Kirchscheid 10 Personen an 1 Feuerstelle; 1843 wurden 7 Bewohner gezählt. 1872 wurde das Ackergut von 12 Personen bewirtschaftet.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Der Weiler Knipscherhof liegt im Nordwesten der Stadt Lohmar an der Rösrather Straße (K 39) in der Nähe von Oberschönrath.
Kreuzhäuschen,
bei Ellhausen: Die Siedlung liegt frei auf der Höhe des Bergriedels zwischen Agger und Jabach an der alten Köln-Siegener Straße. Heute noch steht hier ein Wegekreuz, ungefähr an der Einmündung der Straße von Grimberg. Auf dieses Wegekreuz könnte die Entstehung des Ortsnamens zurückgehen Aber auch eine Wegekreuzung könnte namengebend gewesen sein.
Dieses Kreuz ist die einzige Eintragung auf einer Karte des Kirchspiels Lohmar aus dem Jahre 1807 an der Stelle, an der sich heute Kreuzhäuschen befindet.
Als Siedlung wird Kreutzhäuchen erstmals auf der Tranchot-Karte von 1817 genannt. Eine weitere Schreibweise finden wir auf einer Flurkarte von 1822 Kreutzhäusgen.
Wahrscheinlich aber ist diese Siedlung doch schon älter, denn Hirtsiefer erwähnt in seinem Artikel über „Alte Mühlen“ (siehe unter Kreuznaaf) ein Kreizenhohn, dass durchaus unser Kreuzhäuschen sein dürfte.
Im Ortsverzeichnis von 1829 werden in Kreuzhäuschen 4 Bewohner an einer Feuerstelle gezählt. Zu dieser Zeit besteht die Siedlung aus einem Haus. Bei den Zählungen von 1840, 1841, 1843 und 1851 werden überhaupt keine Angaben über Kreuzhäuschen gemacht. Erst 1871 werden 19 Bewohner gezählt. 1872 wohnen dort 13 Personen in 2 Wohnhäusern, von denen eines zum Schulverband Lohmar und das andere zum Schulverband Breidt gehört.
Während also die Kinder aus dem einen Hause die Schule in Ellhausen besuchen konnten, mußten die aus dem Nachbarhaus nach Birk marschieren.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Kreuznaaf liegt in der Mitte des Stadtgebietes, wo die Kreisstraße 34 von der Bundesstraße 484 abzweigt. Der Ort gehörte bis 1969 zur eigenständigen Gemeinde Wahlscheid.
An einer Gabelung des Talweges im Lohmarer Wald steht die markante Baumgruppe "Zwölf Apostel-Buche".
"Et Hubbelsbähnche" war eine beliebte Rodelstrecke in der Nähe des Parks Lohmarhöhe.
Der Ort Münchhof mit knapp 100 Einwohner liegt mittig im nördlichen Stadtgebiet und gehörte bis zur kommunalen Neuordnung 1969 zur selbstständigen Gemeinde Wahlscheid. Er liegt auf einer Höhe von ca 160 m NHN, 500 m südöstlich von der evangelischen Kirche Sankt Bartholomäus auf dem Berg entfernt in Richtung Maylahn am sanft ansteigenden Höhenrücken, der bei Maylahn erst die volle Höhe erreicht.
Im Jahre 1166 stattet die Gräfin Hildegund von Meer das von ihr gestiftete Kloster Meer mit Gütern aus, zu denen ein Freigut zu Wahlscheid (der Münchhof) und das Patronat der Kirche zu Wahlscheid gehörten. Dieser Hof wird auch erwähnt in einer Urkunde vom Sept. 1244, in der Abt Gottfried von Siegburg bekannt gibt, daß laut eines Vergleichs mit dem Kloster Meer wegen der Güter zu Klefhaus und Schönenberg der Verwalter des Meerer Hofs zu Wahlscheid dem Kustos von Siegburg jährlich 8 Schilling zahlen soll. Diese Urkunden sprechen zwar nur von einem Gut zu Wahlscheid (bona ecclesia de Mere in parrochia Walscheit), jedoch der Name Münchhof, der erst später auftritt, läßt den Schluß zu, daß er mit dem 1166 und 1244 genannten Hof identisch ist. Nach Dittmaier weisen „Mönch, Münch und Monich“ in der Regel auf Höfe in Klosterbesitz hin, die bis ins 11. Jahrh. zurückverfolgt werden können. Alle drei Schreibweisen treffen wir in der weiteren Geschichte dieses Hofes auch an. So ist am 10.6.1586 auch der „Munchhalffen“, also der Pächter des Münchhofes, Zeuge bei der Besichtigung des Weges von Wahlscheid zur Sülzer Brücke. Dieser Munch haiffen wird 1666 auch in den Erbhuldigungslisten des Herzogtums Berg genannt. Weitere Schreibweisen finden wir auf der Ploennis-Karte von 1715 Mönichenhof, als Freihof eingetragen, auf der Wiebeking-Karte von 1790 Münchenhof und auf der Tranchot-Karte von 1817 mit Mönchhof . Eine Flurkarte von 1822 bringt die heutige Bezeichnung Münchhof. Delvos und Rosenkranz berichten beide, daß viele Jahre hindurch der Münchhof von Steinfelder Prämonstratenser-Mönchen verwaltet wurde, die gleichzeitig Pfarrer von Wahlscheid waren.
1858 hatte Münchhof 54 Bewohner. 1871 wurden 41 und 1875 nur noch 38 Einwohner in 7 Wohnhäusern gezählt. Bis 1924 befand sich hier das Bürgermeisteramt der Bürgermeisterei Wahlscheid.
Quelle: Wilhelm Pape, Siedlings- und Heimatgeschichte der gemeinde Lohmar, April 1983
Naaferberg liegt in der Mitte der Stadt Lohmar. Umliegende Ortschaften und Weiler sind Kreuznaaf im Norden, Grimberg im Osten, Ellhausen im Süden und Ungertz im Westen. Die Siedlung erhielt ihren Namen von der unterhalb fließenden Naaf. In den Limitenbüchern (Grenzbeschreibungen) des Amtes Blankenberg von 1644 heißt es unter den Weiderechten: " die zu Grimpergh und uf dem Naafferberg hoeden auch in den Velderen miteinander". Weitere Schreibweisen in Heberegistern, Taufbüchern und Karten lauteten Naeferberg, Noverberg, Nofferberg, etc.. 1829 hatte Naaferberg 17 Bewohner an 4 Feuerstellen (Quelle W. Pape Siedlungs- und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar, 1983 S.165). 2017 wurden hier 74 Einwohner gezählt.
Naafshäuschen,
westlich der B 484 in Richtung Overath kurz vor Agger gelegen. Die Siedlung ist mit Turnisauel identisch. Eine Familie Naaf war lange Zeit Besitzer dieser Gaststätte zu Turnisauel, und gab ihr den o. Namen, der mittlerweile so bekannt ist, daß er den Siedlungsnamen Turnisauel fast ganz verdrängt hat.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Neuenhof
bei Scheid, am Oberlauf des Gammersbaches gelegen, und zwar da, wo der Gammersbach die ersten Quellbäche aufnimmt. Zu erreichen ist die Siedlung nur auf schmalen Wegen, die von den Höhen (Dachskuhl, Oberscheid) in den Siefen des Gammersbaches hinabführen oder auf gleich schmalem Weg vom mittleren Gammersbach (Straße Muchensiefen – Schönrath) ca. 1 km bachaufwärts.
Auch hier scheint es sich um eine jüngere Hof-Siedlung zu handeln, was allein schon aus der Lage hervorgeht. Die oberen Bachläufe und Siefen wurden zuletzt besiedelt. Oder sollte es sich bei „Kerstgen zom neuwenhuis“, der in den Protokollen der Kirchscheider Hofgedinge 1560 als Schöffe genannt wird, um Neuenhof handeln?
Den Namen der Siedlung finden wir auch nicht in den Steuerund Erbhuldigungslisten des 17. Jahrhunderts. Erst 1822 finden wir den Hof auf einer Flurkarte vermerkt.
1858 wird Neuenhof im Ortsverzeichnis mit 5 Bewohnern, 1861 mit 6 und 1875 mit 8 Bewohnern und 1 Wohngebäude aufgeführt.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Neuhonrath
liegt links der Agger, die wir bei Bachermühle überqueren. Sofort sehen wir am sanft ansteigenden Hang des Höhenrückens zwischen Naaf und Agger die Pfarrkirche von Neuhonrath.
Absichtlich haben wir die Zeit der Reformation bis hierhin aufgeschoben; denn mit ihr beginnt die Entstehung Neuhonraths:
Nach Delvos war Honrath noch bis 1612 katholisch. Vom Kloster Gräfrath war Andreas Gummersbach als Pfarrer präsentiert worden, der aber ein ausschweifendes Leben führte und vom Glauben abfiel. Sein Nachfolger soll ein Prediger namens Peter Lemmer gewesen sein, der eine Zeitlang auf „ Pfaffenmütze“ sitzen mußte. Währenddessen präsentierte das Kloster Gräfrath als Pfarrer Prätorius von Bensberg, der aber nach der Rückkehr Lemmers von diesem verdrängt wurde. Als schließlich das Kloster nochmals einen katholischen Geistlichen vorschlagen wollte, bestimmte die Regierung, daß ein Notar die ältesten Leute der Gemeinde befragen sollte. Diese sagten aus, daß Zeit ihres Lebens das lutherische Religions-Exercitium eingeführt gewesen sei. Damit war die Pfarrei Honrath endgültig protestantisch geworden.
Die Katholiken von Honrath und Wahlscheid blieben bis 1710 eine hirtenlose Schar. Um ihnen die Möglichkeit zu geben, eigene kath. Gottesdienste zu halten, stellte Maximillian Adam von Ley, Besitzer des Hauses Honsbach, einen Raum zur Verfügung, in dem nach der Erlaubnis des Kölber Erzbischofs Joseph Clemens zu Weihnachten 1710 zum ersten Male wieder das hl. Meßopfer gefeiert wurde. Die Seelsorge übernahmen die Minoriten aus Seligenthal. Da die Kapelle aber bald zu klein war, stellte Johannes Kaspar von Proff seine Hauskapelle zu Haus Auel zur Verfügung. Diese wurde bis zum 21.9.1738 von den Katholiken benutzt. Doch auch sie wurde bald zu klein. Unterstützt von den Herrn von Ley und von Proff, mittels Kollekten im Herzogtum Berg und im Erzstifte Bonn, ferner durch eine Schenkung des Grundstücks von Wilhelm Balthasar Meyer zu Weeg, konnte am 23.7.1732 der Grundstein zur Pfarrkirche von Neuhonrath „obig dem untersten bacher hoff“ gelegt werden. Sie wurde am 21.9.1738 vom Lohmarer Pastor Delhaes mit erzbischöflicher Erlaubnis benediziert. Franz von Ley berichtete in einem Brief an seinen Vater über die Feierlichkeiten. Die neue Pfarrkirche wurde der Jungfrau Maria geweiht. Bald sammelten sich um diese Kirche Katholiken aus Honrath und Wahlscheid, so daß eine neue Siedlung entstand.
Auf der Wiebeking-Karte von 1790 finden wir die Schreibweise Neu-Hohnrath und auf der Tranchot-Karte von 1817 Neu-Honerath.
1858 zählte Neuhonrath 40, 1864 37 Bewohner. 1871 wohnten noch 31 Personen in 5 Häusern, 1875 wurden nur noch 17 Einwohner in 4 Gebäu-den gezählt.
Bachermühle bei Neuhonrath,
heute unmittelbar an der B 484 bei der Einmündung der Straße von Neu-honrath, also zwischen Agger und der B 484, gelegen:
Bachermühle war eine Wasserkornmühle, die im Mühlenverzeichnis des Amtes Blankenberg von 1644 bereits genannt wird. Die Erben Zur Bach, die der Mühle wohl auch den Namen gaben (Die Bachermühle wurde durch Wasser aus der Agger, durch einen künstlich angelegten Mühlbach herbei-geführt, betrieben), und Heinrich Leyen Erben, waren die Besitzer dieser Mühle. Die nahegelegenen Höfe Schachenauel, Zur Bach, Honsbach, Stieß, Mauwell, Hähngen, Grünenborn und Rosauel ließen hier in der Regel mahlen. Es handelte sich nicht um eine Zwangsmühle. Jedoch waren drei Teile der Mühle dem Landesherrn schatzbar, der vierte Teil gehörte zum Dienst-Sattelfreigut Honsbach.
Namensbelege liefern uns weiter die Ploennis-Karte von 1715 Bachermühl, die Wiebeking-Karte von 1790 Bach und die TranchotKarte von 1817 Bachermühle. Die Mühle hatte 1858 11 Bewohner. 1871 wohnten hier 9 und 1875 15 Personen.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Oberscheid,
in der früheren Bürgermeisterei Lohmar gelegen und zum Kirchspiel Lohmar, später Scheiderhöhe, gehörig: Die erste urkundliche Nennung erfolgt in den Aufzeichnungen der „ungebotenen Gedinge zu Altenrath“ ab 1432, für die ab 1438 Scheiderhöhe zuständig war. Mehrfach finden wir den Namen ouerscheide.
Am 10.6.1586 ist auch ein „Peter zu Ouenscheydt“ Zeuge bei der Besichtigung und Beschreibung des Weges von Wahlscheid zur Sülzer Brücke.
In den Taufbüchern von Lohmar finden wir 1675 Offerschiedt, 1688 Oberscheidt und 1689 Oberschiedt sowie Obberscheidt.
Am 30. und 31.8.1700 werden zwei Schreiben, in denen es um die Reparatur der Sülzer Brücke geht, die baufällig geworden ist, und nun die Nachbarn an ihre Pflichten erinnert werden, von „Henricus Opperscheit bzw. oberscheit“ unterschrieben. Die Pflichten ergeben sich aus dem o. g. Schreiben vom 10. 6.1586.
Die Ploennis-Karte von 1715 verzeichnet einen Hof Ober Scheid. Andere Schreibweisen finden wir auf der Tranchot-Karte von 1817 Oberste Scheid und auf einer Flurkarte von 1822 sowie auf der Hartmann-Karte von 1845 Oberscheid.
Oberscheid hatte 1829 29 Bewohner an 7 Feuerstellen. 1843 werden 56 Personen (davon 49 kath. und 7 evang.) in 10 Gebäuden gezählt. 1851 zählte der Ort 68 und 1872 51 Personen in 9 Häusern und Haushaltungen.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Schönrath
bei Muchensiefen, in einer Mulde zwischen dem Gammersbach und der von Münchenberg nach Honrath verlaufenden Straße gelegen. Fahren wir von Muchensiefen hinab ins Tal des Gammersbaches und dann wieder bergauf, so finden wir rechts dieser Verbindungsstraße, kurz bevor diese auf die o.g. Straße nach Honrath mündet, Schönrath. Der Hof besteht heute aus der sog. Vorburg (Wohnhaus und Wirtschaftsgebäude), während die Hauptburg nur noch eine Ruine darstellt.
Das Beiwort „Schön“ ist wohl zweifellos mit dem nhd. schön gleichzusetzen. In seiner Bedeutung für Schönrath könnte es auf eine besonders „gründlich und sauber gerodete Siedlung“ hinweisen.
Nach dieser Siedlung ist das Geschlecht derer von Schönroide benannt, das wohl seinen Ursprung mit denen von Bernsau bei Overath hat. Als erster dieses Namens wird Henrich von Schönroide genannt, der 1218 mit dem Graten von Berg vor Damiette lag. Es ist durchaus möglich, daß der um 1280 im Verzeichnis der Geldeinkünfte des Klosters Siegburg zu Overath und Umgebung genannte Th. de Sconenrode de Breyscheit119 ein Sproß dieses Geschlechtes ist. Eine ähnliche Schreibweise aus dem 13. Jahrh. lautet Sconerode.
Aus einer Urkunde vom 12.8.1313 erfahren wir, daß sich ein Heinrich von Schoynrode mit noch anderen Rittern und Edlen für Heinrich von Löwenberg wegen einer Schuld verbürgt hat. Wahrscheinlich ist dieser Ritter Heinrich von Schoynrode zu Kloster Seligenthal begraben. 1326 ist ein Johann von Schönroide Herr zu Idelsfeld.
Laut Urkunde vom 7.1.1342 wenden sich Abt Wolfard und der Konvent von Siegburg wegen Streitigkeiten in der Verwaltung und Vermögenstrennung um Rat und Hilfe an vertrauenswürdige Freunde, u.a. auch an Heinrich von Schoenroyde. Dieser Ritter Heinrich von Schoenroyde gibt am 24.2.1353 bekannt, daß Abt Reinhard von Siegburg ihn gegen eine Jahresrente von 10 Mark Pfennigen gängiger Kölnischer Münze zu seinem Lehnsmann gemacht hat, wofür er und seine Erben dem Abt und seinen Nachfolgern den Lehnseid leisten werden.
Im Jahre 1363 besiegelt Heinrich die Verkaufsurkunde des Frohnhofes zu Solingen.
Mit Wirkung vom 17.12.1382 setzt der Abt von Siegburg den Ritter Reinhard von Schoenrode zum Schultheißen in Siegburg ein. Dabei wird die Aufteilung der Einkünfte und Gebühren zwischen Abt und Ritter Reinhard genau festgelegt. Aus einem Brief vom 12.12.1388 geht hervor, daß Ritter Reinhard auch mit dem Herzog von Berg auf gutem Fuße steht. Zu dieser Zeit ist der Herzog in finanzieller Not und bedient sich des Ritters Reinhard als Bittsteller, um 600 Gulden zu erhalten. Ein paar Jahre später, nämlich am 11.11.1393, nimmt Reinhard von Schönrath sogar eine Art Vermittlerrolle zwischen dem Abt von Siegburg und dem Herzog von Berg ein, wie aus einem Briefwechsel zwischen Abt Pilgrim und Adolf von Berg, Graf von Ravensberg, hervorgeht.
Im Jahre 1395 wird einem Ritter Henrich von Schönroide in einer Sühne zwischen Johann von Loen und Ritter Johann von Stein die Burg Löwenburg im Siebengebirge so lange zum Verwahr übergeben, bis Johann von Loen dem Joh. von Stein die schuldigen 1200 Mark halb gezahlt haben würde. Wir würden heute sagen, daß Heinrich zum Treuhänder eingesetzt wurde.
1419 heiratet Wilhelm von Nesselrode Swana von Landsberg, Tochter Johanns und Swenolts von Schönrode, und kam 1466 in den Besitz Schönraths. Der Rittersitz geht aber noch im 15. Jahrh. durch Heirat der Irmgard von Nesselrode mit Bertold von Plettenberg an diese Familie über.
Nach Delvos sind 1522 Wilhelm von Plettenberg und Barbara von Merode, seine Frau, Besitzer von Schönrade. Sie schenken der Kirche zu Altenrath ein Stück Land von 7 Morgen. Danach gelangt Haus Schönrath in den Besitz der Familie von Heyden. Ein Wennemar von Heyden, gestorben 1552, heiratet Elisabeth von Plettenberg, Erbin zu Schönrath. Sein Sohn Diederich besaß Schönrad bis 1579. Er ist es, der in den Protokollen des Kirchscheider Hofgerichts von 1560-1565 mehrmals als „junker zo schon-radt“ vom „huis schonraedt“ bzw. „schoinrait“ genannt wird. Aus seiner Ehe mit Hermanna von Hoerde ging Georg von Heyden hervor, der in den Reichsfreiherrenstand erhoben wurde. Aus seiner Ehe mit Anna Cath. Kett-ler ging Gotfried, Freiherr von Heyden, Herr zu Schönrad, hervor, der 1650 Oberstleutnant war. Aus dessen Ehe mit Odilia Kettler entstammt Goswin Adolf von Heyden, der 1678 Anna Joh. Cath. von WylichLottum heiratet.
„Goswin Adolph Freiherr von Heyden, Seiner Churfürstlichen Durchlaucht zu Brandenburg Rath und Drost des Ambts Wetter“, verkauft am 4. Okt. 1695 den freiadeligen Rittersitz „Schonrad“ und dessen Appertinentien (Zube-hör) an „Ernst Freiherrn von Erlenkamp, Fürstlich Mecklenburgischer Gustrauischer Rath, Ambts Haubtmann und Pfandts-Herrn zu Plaue, Herren zu Neuendorff, Wombach pp.“ für 29.600 Reichstaler Kaufschilling und 400 Reichstaler Verzigspfennigen. Zu den Appertinentien gehören: Eine „Fischerey in der Acher, auf der Sültzen und Bächen, der Jörges-Hof, der Körffer-Hof, der Lughauser Hof, der Dalhauser Hof, der Buxhorner Hof, der Gammersbacher Hof, der Knipscheren Hof, der Schlehecker Hof, Steingütchen, Busch Johans Gütgen, Rambrücker Mühle, Gammersbacher-Mühle, Grundpfacht von zweyen Häusern, eine Gerechtigkeit im Lohmer Walde“.
Die Familie von Erlenkamp verkauften Schönrath später an die Familie Schall von Bell zu Wahn. Ein Ferdinand Freiherr Schall von Bell wird um 1750 Herr zu Haaren, Macharen, Wahn und Schönrath genannt.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gingen die einzelnen Güter an verschiedene Besitzer über.
Nach einem Sendgerichtsprotokoll von Altenrath aus dem Jahre 1619 ist Schönrath eine der vier Honschaften des Kirchspiels Altenrath. Im Protokollbuch heißt es: „Auff d Schönradter ahngesetzt hermann zu Pliersbach ond befohlen bey seiner trewen achtungh zu haben auff alle die Jenigen, so in unser kirspell gehorren der seyten des wassers (Sülz)“. Hieraus geht hervor, daß Schönrath zwischenzeitlich verpachtet war; denn Besitzer des Ritterguts war um diese Zeit Georg von Heyden.
Weitere Schreibweisen finden wir auf einer Karte von Hondius aus der Zeit um 1600 Schonrad, nach 1614 Hauß Schoinradt, auf einer Karte von Visscher aus dem Jahre 1690 wieder Schonrad. Bei Ploen-nis 1715 und Wiebeking 1790 finden wir Schönrath als adeliges Haus eingetragen.
1829 ist Schönrath ein Hof mit 17 Bewohnern an 2 Feuerstellen. 1843 werden 15 und 1851 nur noch 10 Bewohner gezählt. 1872 wohnen 12 Personen in 2 Wohnhäusern und 2 Haushaltungen auf Schönrath.
1866 kam Schönrath zur Pfarre Scheiderhöhe.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Pützrath,
unmittelbar an der Sülztalstraße im Dreieck zwischen eben dieser Straße, der Sülz und der Agger gelegen:
Der Name Pützrath leitet sich ab vom rheinischen Wort „Pütz“ = Brunnen, entlehnt dem lat. puteus. Pützrath ist somit eine Rodesiedlung mit Brunnen, die auf einer kleinen hochwasserfreien Anhöhe der Niederterrasse zwischen Agger, Sülz und Heppenberg liegt.
Die älteste urkundliche Erwähnung von potzeraede finden wir bei Delvos in den Protokollen der ungebotenen Gedinge (Gerichtsverhandlungen) in Altenrath ab dem Jahre 1432.
Eine weitere Schreibweise aus der Zeit von 1503 bis 1538 finden wir im Birker Bruderschaftsbuch als putzenrade und zwar „herman putzenra-de“.
Nach den Protokollen der Kirchscheider Hofsgedinge mußte 1561 „goddert van lomer van mackenberghs ghade und putzgeraetz ghade“ Zins und Pacht zahlen, ebenfalls „gyrret im haue van putzeraitz ghade“. 1563 wird „Gottertz frauw vann lomer, vann putzeratz guit“ unter den Abgabepflichtigen genannt.
Am 14.7.1644 werden die Limiten (Grenzen) des „Kirspeis Lohmar“ neu beschrieben: „daß Kirspell nimbt seinen anfangh gegen Putzert in die Aacher“. In dieser Beschreibung heißt es, daß die Hon-schaft Lohmar nicht mit den Grenzen des Kirchspiels Lohmar übereinstimmt. Für die Honschaften bildet die Agger die Grenze. Zum Kirchspiel aber gehören auch die Ortschaften jenseits der Agger: Pützrath, Heppenberg, Süttenbach.
Die Ploennis-Karte von 1715 verzeichnet einen Hof Pützet. In den Taufbüchern von Lohmar wird 1736 putzroth genannt. Im 19. Jahrh. schwankt die Schreibweise zwischen 1817 Pützrath und 1829 Pützerath.
Die Ortschaft zählt 1829 27 Bewohner an 5 Feuerstellen, 1843 31 Bewohner in 7 Gebäuden. Im Jahre 1851 meldet die Statistik 33 Einwohner. Die gleiche Zahl wird 1871 in 5 Häusern und Haushaltungen gemeldet117. Heute ist die Siedlung als „Pützrather Weg“ Ortsteil von Heppenberg.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Rodderhof
bei Muchsiefen: Dieser Hof liegt westlich von Muchensiefen auf dem südlichen Höhenzug zwischen dem Gammersbach und der Sülz an der Straße von Rambrücken (Sülztal) nach Honrath. Der Name deutet auf eine „Hofsiedlung auf einer gerodeten Fläche“ hin.
Am 4. und 5. Mai 1676 wurde der Kirchscheider Hof mit seinen Ländereien neu vermessen und beschrieben. Dabei wird ein Busch erwähnt, der an die „rodder Wiese“ angrenzt.
Sicherlich ist hiermit eine zum Rodderhof gehörige Wiese gemeint. An Schreibweisen finden wir auf der Ploennis-Karte von 1715 Rodderhof , auf der TranchotKarte von 1817 Rödderhof und auf einer Flurkarte von 1822 Rotherhof.
1829 zählte die Siedlung 29 Seelen an 4 Feuerstellen. Im Jahre 1840 hatte der Rodderhof 43 Bewohner (davon 2 kath., 41 evangl.) an 6 Feuer-stellen. 1843 werden 46 Personen (alle evangl.) in 4 Wohngebäuden gezählt. Weiter hielt sich die Einwohnerzahl konstant: 1851 42, 1871 40 und 1872 41 Personen und 7 Wohnhäuser. 1829 noch als Hof bezeichnet, wurde die Siedlung 1871 zum Weiler erklärt.
Interessant ist, daß hier – weit entfernt von Honrath und Wahlscheid – eine evangelische Insel entstand. In der gesamten Pfarrei Altenrath gab es nur noch in Gammersbach, Klasberg und Muchensiefen wenige Protestanten. Denkbar wäre es, daß sich zum Rodderhof, der weder von Haus Sülz noch von Haus Schönrath abhängig war, nach den Wirren der Reformation die Protestanten der Pfarre Altenrath zurückgezogen haben. In Altenrath selbst, wo nach Delvos die Zahl der Calvinisten und Lutheraner groß war, wohnte bis 1843 keine evangelische Familie.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Saal,
südlich von Oberstehöhe am Abhang zum Siefenbach, der in die Naaf mündet, gelegen:
Der Siedlungsname bedeutet tatsächlich soviel wie Saal in seiner heutigen Bedeutung. Dittmaier leitet ihn ab von „sei“, ahd. „sal“, abgewandelt zu „seli, selida, selde“, in seiner Bedeutung „Wohnung, Haus“ oder noch spezieller „das nur aus einem Raum bestehende Gebäude“. Das mhd. „sal“ kann aber auch „Kotlache, Schmutz“ bedeuten.
In den Heberegistern des Amtes Blankenberg aus dem Jahre 1644 werden gleich 3 Güter zu Saal genannt: „Michaels gut, Kerstgens gut und Ohmen (?) gut zum Saal bzw. Saall “.
In den Erbhuldigungslisten von 1666 erscheinen jedoch nur noch zwei Namen: „Adolf zum Saall“ und „pitter daselbst krank“.
Weitere Schreibweisen finden wir auf der Wiebeking-Karte von 1790 Sahl und auf der Tranchot-Karte von 1817 Saal.
Die Siedlung zählte 1858 17 und 1861 19 Bewohner. 1871 wohnten 23 Personen in 5 Wohnhäusern, 1875 wurden 26 Personen in 4 Gebäuden gezählt.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Salgert
bei Geber: Die Siedlung liegt unmittelbar im Westen von Geber am Ab-hang des Hochplateaus zwischen Jabach, Agger und Naaf oberhalb der Gebermühle.
Zur Namensdeutung gilt Ähnliches wie bei Algert. Die Bedeutung des Bestimmungswortes „Sal“ kann vielleicht auf mhd. „sal(guot)“ = „freies, nicht zinsbares erbliches Grundeigentum, Herrengut“ zurückgehen. Von einem solchen Gut ist jedoch in der Geschichte dieser Siedlung nichts zu finden. Deshalb scheint eher die Erklärung zuzutreffen, dass hier das ahd. „sal“ in der Bedeutung von „Wohnung, Haus, das nur aus einem Raum bestehende Gebäude“ vorliegt.
Das im Birker Bruderschaftsbuch aus der Zeit von 1503-1538 genannte Salgerod, und zwar „Johan van salgerod“, bestätigt die Vermutung Dittmaiers, daß Salgert eine gerode-Siedlung sein muss.
In Salgard werden in den Heberegistern von 1644 „Grieß gut und gee-part“ als Abgabepflichtige genannt. Im Verzeichnis der Vogteien aus dem Jahre 1646 erscheinen „Kleins erben und Catharina henseler und consorten zue Salgert.“35 Den Erbhuldigungseid leisten im Jahre 1666 „Klein Jan und Heinrich daselbst“.
In den Limiten der Honschaft Haiberg aus dem Jahre 1644, zu der Salgert gehört, heißt es, daß die „Saigerder Nachparen“ alleine das Vieh in „busch und Velderen“ hüten.37 .
Die Schreibweise Saigart finden wir im Protokollbuch der Kirchscheider Hofgedinge aus dem Jahre 1699: „Ursula zu Salgard modo Diederich zum Seifen hat geliebert 6 frl haber, 10 ½ heller“. Im Vergleich zu anderen Abgaben an den Kirchscheider Hof muß „Ursula zu Saigart“ die Besitzerin eines größeren Hofes zu Seifen (Muchensiefen) gewesen sein.
Weitere Schreibweisen: 1700 Salgert, ebenfalls im Wertier und Landmaßbuch von Haiberg aus dem Jahre 1738 – „petter Kellershon zu Salgert“. 1790 Sahlscheid , 1807 und 1817 Salgert.
Der Ort hatte 1829 25 Bewohner an 6 Feuerstellen. 1840 wohnten 57 Personen an 11 Feuerstellen. Im Jahre 1843 hat Salgert immer noch 42 Bewohner von 6 Wohngebäuden. Auch 1851 werden noch 44 Einwohner gezählt. Dann aber nimmt diese Zahl rapide ab, bis 1871 auf 35 und 1872 sogar auf 28 Personen.41
Der bevölkerungsmäßige Aufschwung dieser Siedlung in der Mitte des 19. Jahrhunderts steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erzgrube Noeggerath, die in der Nähe Salgerts lag und aus der noch 1860 Erze gefördert wurden.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Scheid,
in der ehemaligen Bürgermeisterei Wahlscheid gelegen und zur Honschaft Honrath gehörig: Obwohl dieses Scheid älter sein muß, können wir jedoch vor 1644 nichts in Erfahrung bringen. In den Heberegistern von 1644 (Steuerlisten) werden „Halffmans gut, Hagermans gut, Gilles von Johentges und Hagermans gut, Höuelichs (Hövelichs) halbman, Alten Dietherichs Erben und Joesten Erben von Hagermans gut zu Scheidt“ als abgabepflichtige Personen aufgeführt. Im gleichen Jahr wird für das Amt Blankenberg ein neues Rentu. Lagerbuch aufgestellt. Am 8. 6.1644 unterschreibt ein „Gillis Wasser zu Scheidt“ als Geschworener die Ausführungen über den „Futterund Hühner-Zehnt“, der wahrscheinlich nicht mehr überall eingehalten wurde.
Sechs Haushaltsvorstände, darunter auch „gilleß auff scheidt“, werden in den Erbhuldigungslisten von 1666 der Honschaft Honrath aufgeführt.
Auf der Ploennis-Karte von 1715), der Wiebeking-Karte von 1790 und auf derTranchot-Karte von 1817 erscheint die Schreibweise Scheid. Auch eine Flurkarte von 1822 und die Hartmann-Karte von 1845 bringen die gleiche Schreibweise.
1858 zählt die Siedlung 92 und 1864 98 Einwohner. 1871 werden 76 Personen in 18 Gebäuden gezählt. Seltsamerweise werden die Bewohner Scheids 1875 aufgeteilt, und zwar 31 Bewohner in 5 Häusern zu „oberste Scheid“ und 58 Bewohner in 13 Häusern zu „unterste Scheid“32. Diese Be-zeichnungen tauchen jedoch nach der Jahrhundertwende nicht mehr auf. Wahrscheinlich hatte es bald Irrtümer und Verwechslungen gegeben mit dem in der Bürgermeisterei Lohmar gelegenen Oberscheid.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Scheiderhöhe liegt im Westen des Stadtgebietes von Lohmar auf dem zwischen Agger und Sülz in nördlicher Richtung leicht ansteigenden Lößlehmplateau. Bis 1969 war Scheiderhöhe eine eigenständige Gemeinde im Amt Lohmar. Durch den Ort verläuft die Kreis- und Höhenstraße von Heppenberg nach Honrath – Dahlhaus. Mit dem heutigen Ortsnamen bezeichnete man ursprünglich das gesamte Hochplateau zwischen Agger, Sülz und Gammersbach, im Norden bis an die Grenze zur Honschaft Honrath (also bis nördlich von Muchensiefen).
Zum ersten Mal hören wir von Scheiderhöhe gegen Ende des 14. Jahrh. Um 1381 besitzt ein Alf von Eckerscheidt, wahrscheinlich aus dem bergischen Eckerscheidt stammend, einen Hof zu Scheiderhue. Am 27. 4. 1387 löst der Knappe „Alf von Eggerscheidt“ eine Zahlung von jährlich 2 Pfund Wachs aus Schrivers Erbe, ferner 2 ½ Summer Hafer und 6 Schilling aus seinem Hof auf der Scheiderhoe ab, zahlbar an den Abt und Konvent zu Siegburg. Das Gebiet der Scheiderhöhe gehörte bis zu dieser Zeit zur Herrschaft Löwenburg, bis es 1363 an die Grafen von Berg kam.
Auch aus dem Weistum aus der Löwenburgischen Zeit aus dem Jahre 1432 geht hervor, dass auf der Scheiderhöhe ein Hof bestand. „Ein huißmann uff der scheiderhoe“, der 25 alte und junge Schafe besitzt, soll meinem Herrn jährlich davon einen Hammel geben“, heißt es dort.
Schon sehr früh wird Scheiderhöhe „Freiheit“ genannt. Das gesamte Kirchspiel Altenrath und das Gebiet der Scheiderhöhe (zu einem großen Teil zum Kirchspiel Lohmar gehörig) unterstand dem Amte Porz.Scheiderhöhe aber hatte ein eigenes Gericht, das jedoch in Altenrath gehalten wurde. In einem alten Protokollbuch von Altenrath heißt es: „Anno 1438 off mondach nach sant vallentin hait man das gerichte off der scheiderhoe zo alderade, we van alders gewöhnlich, vugeboden gedinghe gehalten“. Dies blieb so, bis 1555 infolge der Erkundigung über die Gerichtsverfassung im Herzogtum Berg die Zahl der Gerichte verringert wurde. So wurde die Freiheit Scheiderhöhe mit dem Volberger Gericht vereinigt, was am 24.1.1556 in Kraft trat. Am 24.8.1499 verpfänden Johann Stael v. Holstein und seine Frau Aleid von Arental (Siehe Haus Sülz u. Hammersch) den Hammershof an den Siegburger Heyntz Vlach. Dies geschieht „in dem hoiffs gerichte sent Jacobs (gemeint ist das Hofgericht zu Kirchscheid, das unabhängig von dem o.g. Gericht bestand) op der Scheyder hoe im Kirspel van Aldenrode“. Am 12.4.1526 wird u.a. von der Abtei Siegburg dem Probst Dr. Antonius Fürstenberg der Hof „zu kerenscheide auf der Scheiderhöh“ auf Lebenszeit verkauft (überlassen). Am 8.12.1563 beschwert sich „Ailff von Belickhuisen“ am Landtag zu Düsseldorf, „dass sein halfman im Hammershof auf der Scheiderhohe gelegen“ viermal in diesem Jahr dem „keiner zu Bensbur“ mit Pferd und Wagen habe dienen müssen.! Laut einer Urkunde vom 23.12.1578 wird das Gut zum Schoepgen auf der Scheiderhöhe an Johann und Bertram von Nesselrode verkauft.
Aus diesen eben genannten Urkunden geht deutlich hervor, daß nicht nur die Siedlung, sondern das ganze Gebiet des südlichen Höhenrückens zwischen Agger und Sülz die Bezeichnung „auf der Scheiderhöhe“ trug. Im Protokollbuch über die Kirchscheider Hofgedinge von 1560-1565 wird mehrmals ein „peter zom eigen“ oder „eygenn“ als Schöffe genannt, der 1563 auch als „Amptknecht uff der scheiderheu“ bezeichnet wird. Ein Protokoll über die Begehung des Weges vom Kirchspiel Wahlscheid zur Sülzer Brücke, einschließlich der Bedingungen zur Benutzung dieser Brücke, wurde von „Peter auff dem Rüpkamp geschrieben mit Bewilligung desß Kirspelß Wahlscheydt und der Seyderhohe 1586 den Zehenden Juny“198 . Dieser Weg muß über die Scheiderhöhe geführt haben.
Aus einem Sendgerichtsprotokoll von Altenrath aus dem Jahre 1619 erhalten wir genauen Aufschluss über die Honschaften des Altenrather Gerichtsbezirks. Dazu zählt auch die Scheiderhöhe. Als Hone (Vertrauensperson einer Honschaft) wird „auff d Scheidterhöe ahngesetzt Gerhardt zu oberstorff in gelicher (gleicher) auch befohlen bey seiner trewen (Treue) achtungh zu haben auff alle die Jenigen, so in unser kirspell hörren“. Der „hone“ hatte die Pflicht, vorkommende Verstöße gegen Moral und Sitte zur Anzeige zu bringen; denn diese Vergehen unterstanden dem sog. Send.
Nach den Limiten (Grenzbeschreibungen) des Amtes Blankenberg vom 14.7.1644, in denen auch der Zustand von Straßen, Wegen und Stegen beschrieben wurde, war der Donrather Steg zur Hälfte von der Scheiderhöhe im Amt Porz in Ordnung zu halten. Dort heißt es: „...welchen die Scheiderhöe Ambts Portzes auch zur halbscheit bawen und in ehse dem alten herkommen gemeß halten muß.
Kirchlich gehörte Scheiderhöhe wie auch Kirchscheid zum Kirchspiel Lohmar. Weil die Bewohner der vielen Höfe um Scheiderhöhe und Schönrath zu ihren Pfarrkirchen in Altenrath und Lohmar einen weiten und beschwerlichen Weg hatten, besuchten sie die Gottesdienste in der Jakobskapelle zu Kirchscheid. Diese scheint aber von der Abtei Siegburg, in deren Besitz Hof und Kapelle waren, nicht immer gut mit Geistlichen versehen worden zu sein. Dies geht aus einem Protokoll über ein ungebotenes Geding des Jahres 1433 hervor, worin sich die Bewohner über diesen Zustand beschweren: „Item vroegen die Naber (Nachbarn), we de Heren vann sybergh hauen (haben) ein Kirche uff der Schederhoe lyene, die selbe sollenn haltenn mit geluichte vund missen vund de Kirche vund Kirchhoeff in gueten bouwe, wielichs nit geschehene“. Später ist jedoch davon die Rede, daß ein „her Johan, paestor vff der scheiderhöe“ residierte. Daraus geht hervor, daß die Beschwerde Erfolg gehabt hat. Als die Jakobskapelle zu Kirchscheid im 18. Jahrh. baufällig wurde, griffen die Bewohner der umliegenden Orte auf die alten Argumente (wei¬te, schlechte Wege, keine Schule) zurück und bauten 1803 auf der Scheiderhöhe eine neue Kapelle, wozu sie einen großen Teil des anfallenden Materials von der Jakobskapelle verwandten. Dabei kam ihnen die testa¬mentarische Stiftung einer Schulvikarie durch das Freifräulein Maria Elisabeth von Geller sehr gelegen. Trotz eines Streites mit den Erben erhielten sie 1500 franz. Kronenthaler, wogegen sich die Erben das Patronatsrecht vorbehielten. Die neue Kapelle wurde 1805 vom Lohmarer Pfarrer Lieser geweiht „sub titulo Kreuzerhöhung“. Nach rund 14-jährigeni Auseinandersetzungen wurde Scheiderhöhe am 12.5.1866 zur selbständigen Pfarre erhoben. Die 1803 gebaute Kapelle wurde zur Pfarrkirche. Die heutige Kirche wurde erst in den Jahren 1911- 1913 gebaut, und zwar unmittelbar nördlich der Kapelle, die erst 1926 abgebrochen und in ein Kriegerdenkmal umgebaut wurde.
In Scheiderhöhe wohnten 1829 32 Personen an 6 Feuerstellen. 1840 hatte der Ort 56 Einwohner (32 kath. u. 24 evang.) an 11 Feuerstellen. Bis hierhin machte sich also die Reformation in den Pfarren Honrath und Wahlscheid bemerkbar. 1872 zählte Scheiderhöhe 28 Einwohner in 5 Häusern und 6 Haushaltungen.
Schenkbüchel,
der Name eines Altenrather Gutes, in der Nähe des oberen Witzenbaches gelegen:
Erwähnt wird das Gut in den Erbschaftsakten von 1649: „ein guetgen zu Aldenraidt Schenkbüchel genandt“.
Weitere Schreibweisen enthalten die Tauf und Sterbebücher Altenraths: 1666 „Jahn auff dem Schengbüchel“, 1673 auf Schenbüchel, 1784 und 1804 Schengbüchel. Eine weitere Schreibweise ergibt sich aus der Tranchot-Karte von 1817 Schenckbüchel.
Neußer vermutet einen Zusammenhang mit dem nhd. schenken. Der Name könnte aber auch Zusammenhängen mit „Schenkel“. Durch Weglassen der Endsilbe wäre dann Schenkelbüchel zu Schenkbüchel geworden und bedeutet ein Flurstück, das nach Art eines Schenkels einen Winkel bildet.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Scherferhof
bei Scheiderhöhe: Wenn wir bei Pützrath von der Sülztalstraße die Kreisstraße über Heppenberg hinauf zur Scheiderhöhe fahren, erreichen wir kurz vor Scheiderhöhe rechts, am Abhang zum Aggertal gelegen, den Scherferhof. Auf der anderen Straßenseite liegt Wielpütz. Hier etwa beginnt das fruchtbare Lößlehmgebiet am Rande des Bergischen Landes.
Wie aus den Protokollen der Kirchscheider Hofgedinge aus den Jahren 1560 bis 1565 hervorgeht, war ein „peter zo scherff“ Schöffe dieses Hofgerichts. Als solcher wird er 1560 und 1563 genannt. Im Jahre 1565 verpachtet Johann zu Wielpütz mit Einverständnis seines Lehnsherrn „Peteren zu Scherff und Tryngenn seiner hausfrauwen einen halbenn Morgenn Landtz scheut uff die Holstraiß“.
In einer Urkunde vom 26.7.1576 wird u. a. „Peter Scherff“ als Zeuge in einem Streit zwischen dem Präsenzmeister von Siegburg und Michael von Mackenbach wegen Deichanlagen genannt. Auch in einer Fischerei Prozeßakte vom 22.2.1636, in der die Fischerei-Rechte in Sülz und Agger festgelegt werden, wird ein Hof zu Scherf erwähnt.
Die gleiche Schreibweise Scherf finden wir 1665 und 1688/91 in den Taufbüchern von Lohmar. Auf der Ploennis-Karte von 1715 finden wir den Scherferhof , auf der Wiebeking-Karte von 1790 die Bezeichnung Scherfer (wahrscheinlich zu ergänzen ...Hof). Auch auf der Tranchot-Karte von 1817 finden wir die Schreibweise Scherferhof .
Delvos berichtet, daß der Scherferhof, der der Abtei Siegburg gehörte, 1803 zur Erleichterung der fürstlichen Finanzen säkularisiert wurde und 1820 in den Besitz des Herrn von Hymnen überging. Nach Dittmaier leitet sich der Name des Scherferhofes nicht vom ahd. „scarph“, mnd. „scharp“ = scharf ab, sondern vom Personennamen „Scarfo, Scerfi“, was sicherlich durch die nachmittelalterliche Schreibweise „Scherff“ bestätigt wird.
Auf dem Hof wohnten 1829 12, 1843 11 Personen. 1872 wurde das Ackergut von 9 Personen in 1 Haushaltung bewohnt.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Die Siedlung liegt auf der rechten Aggerseite gegenüber von Donrath, am Südostfuß des Scheiderhöher Bergriedels zwischen Agger und Sülz. Das mundartliche „Sottemich, Soddemich“ gehört zum mhd. „sute, sutte“ = Lache, Pfütze, Sumpf, eine Lagebezeichnung, die in der Niederung zwischen Agger und Sülz zutreffend gewesen sein mag. Das Hin und Her der Schreibweise Sottenbach und Sottenberg haben ihre Begründung: zweifellos liegt Sottenbach am Rande der Aggerniederung; es liegt aber auch auch am Fuße eines Bergriedels.
Aus den Mitteilungen des Kölner Stadtarchivs zitiert Dittmaier die Schreibweise Sottenbach aus 1402. Unter den oft erwähnten Ortschaften in den alten Protokollbüchern der „ungebotenen gedinghe“ von Altenrath befindet sich auch säettenbergh188. Im Mitgliederverzeichnis der Birker Marienbruderschaft von 1538 wird „el-sa van sottenbach“ aufgeführt. In den Heberegistern des Amtes Blankenberg aus dem Janre 1644 wird unter der Haiberger Honschaft ein „Meiß Karst wegen Conrat zu Sotterbach“ als abgabepflichtig bezeichnet. Weitere Schreibweisen ergeben sich aus den Taufbüchern von Lohmar: 1689 Sottenberg und 1720 Sottomlg, sowie aus der Ploennis-Karte von 1715 Sottenbag und der Wiebeking-Karte von 1790 Sottenbach. Nach dem Wertierund Landmaßbuch von Haiberg aus dem Jahre 1738 besaß „Wilhelm Kellershan zu sottenbach“ steuerpflichtige Ländereien in der Gemeinde Haiberg192. Im Wertierund Landmaßbuch von Lohmar aus dem Jahre 1746 wird „petter Klein zu sottenbagh“ genannt, der Ländereien „in der pann, an der Jabagh und in der backes Wießen“ besaß. Im gleichen Buch werden „Kutte Küllerß Erben zu sottenbagh“ erwähnt.
Die Siedlung wird 1829 als Dorf bezeichnet und hat 62 Bewohner an 11 Feuerstellen. Bis 1851 verringerte sich die Einwohnerzahl auf 35. Im Jahre 1872 wurden 37 Personen in 8 Häusern und 10 Haushaltungen gezählt. An die Siedlung erinnert heute die „Sottenbacher Straße“. In diesem Zusammenhang ist noch eine Tatsache von geschichtlicher Bedeutung: Die heutige Sottenbacher Straße stellt ein Teilstück der „Alten Kölner“ oder „Siegerländer Straße“ dar, die von Altenrath herab ins Sülztal bei Pützrath, von dort über Sottenbach, Donrather Steg weiter nach Haiberg führte. Auch die Post nahm diesen Weg. In den Limitenbüchern vom 14.7.1644 ist bereits vom „Döenrother Steegh“ die Rede; eine Holzbrücke, die heute noch Donrath mit Sottenbach verbindet. Etwas südlich dieses Steges wurde 1878 eine feste Brücke aus Bruchsteinen errichtet, die aber bei einem Hochwasser am 4.11.1940 einstürzte.
Spechtshausen,
zwischen Scheid und Oberscheid östlich der Kreisstraße nach Honrath am Abhang zum Aggertal gelegen:
Diese Siedlung erscheint in keinen Urkunden, Akten oder Karten bis einschließlich des 19. Jahrhunderts. Erst auf den topographischen Meßtischblättern 5109 Wahlscheid von 1905 und 1953 finden wir die Siedlung unter dem Namen Spechthäuschen. Im Ortsplan der Gemeinde Lohmar aus dem Jahre 1975 ist der Name Spechtsberg eingetragen.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Steinhauershäuschen bei Kreuznaaf,
an der Naafmündung zwischen der alten Aggertalstraße und der heuti-gen B 484 gelegen:
Wie aus einem Schriftwechsel zwischen dem Wahlscheider Pfarrer Lungstras und dem Lohmarer Bürgermeister Busbach aus dem Jahre 1847 ersichtlich ist, ist Steinhauershäuschen mit Vicksoder Vixhäuschen identisch.
Als Namensbelege finden wir außer dem o. g. Schriftwechsel Steinhauershaus auf der Karte von Zimmermann aus dem Jahre 1807, Steinhauershäuschen auf der Tranchot-Karte von 1817 und auf der Hartmann-Karte von 1845 Vickshäuschen.
Die Siedlung ist wahrscheinlich jüngeren Datums und nach einem Steinhauer, der in den naheliegenden Steinbrüchen beschäftigt war, benannt worden.
1829 wohnten hier 6 Personen an 1 Feuerstelle, 1840 8 Personen an 3 Feuerstellen. 1851 wurden sogar 27 Einwohner gezählt, und 1872 lebten 17 Personen in 4 Häusern und 6 Haushaltungen55. Der Siedlungsname ist heute offiziell verschwunden. Die Bewohner zählen zu Kreuznaaf.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Ungertz
bei Naaferberg: Unmittelbar hinter Donrath in Richtung Wahlscheid zweigt ein Fahrweg, der nach Ellhausen und Kreuzhäuschen auf die alte Siegener Landstraße führt, von der B 484 rechts ab und führt in zwei Serpentinen hoch. Bevor wir die Höhe erreichen, durchqueren wir in einer leichten Mulde Ungertz, heute noch mit seinen Feldern fast ganz von einem Waldgürtel umgeben.
Der Siedlungsname, ein früheres Ungereitsched, leitet sich vom mhd. „ungereit“ ab, was soviel bedeutet wie „unzugänglich, unwegsam“. Diese Bedeutung mag für die Zeit der Gründung dieser Siedlung voll zutreffend gewesen sein, wenn man bedenkt, daß die Wege früher schlechter und der Waldgürtel dichter und breiter war.
Weitere Schreibweisen finden wir nur auf einem Meßtischblatt von 1905 als Ungertz und von 1953 als Ungerts.
Schon sehr früh muß diese Siedlung zu Naaferberg gezählt worden sein, denn weder in den Heberegistern von 1644, noch in den Ortschaftsver-zeichnissen ab 1829 ist Ungertz als selbständige Siedlung verzeichnet.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Wahlscheid,
eine ursprünglich kleine Siedlung, jedoch schon sehr früh Kirchort, liegt über dem Westabhang des Höhenrückens zwischen Naafbach und Agger. In zwei Kehren führt die Straße von der B 484 zur St. BartholomäusKirche hoch. Deutlich ist heute noch dieser kleine Kirchort vom nördlich gelegenen Hauptort (entstanden durch Eingemeindungen im Jahre 1927) getrennt. Diem-Straße und Pestalozzi-Weg stellen die Verbindung zum heutigen Hauptort dar, der den Bergriedel und den Talgrund des großen Aggerbogens ausfüllt.
E. Förstemann will „Wahl“ ableiten vom ahd. „walah“, was so viel bedeutet wie Fremder, Romane, Kelte. Später jedoch – und dies scheint richtig zu sein – leitet er „Wahl“ vom Personennamen „Walho oder Walo“ ab. Die erste urkundliche Nennung für Wahlscheid finden wir am 6. 1.1121, als Erzbischof Friedrich I. von Köln die schriftlich vorliegenden Verfügungen Abt Kunos I. von Siegburg, die dieser zum besseren Unterhalt der sich ständig vergrößernden Zahl der Mönche getroffen hatte, bestätigt. In dieser Urkunde heißt es: „Nunc itaque de elemosina dicendum est: de Walescheit, quod nos acquisivimus, de vino, siligine, ordeo, avena...“ (Nunmehr muß über die Almosen (Abgaben) gesagt werden: von Wahlscheid, welches wir hinzuerworben haben, Wein, Weizen, Gerste, Hafer...). Im Jahre 1166 schenkte Gräfin Hildegund von Meer ein Allod zu Walescheit dem Kloster Meer bei Neuß. Mit Urkunde des Jahres 1179 bestätigt Papst Alexander II. die Besitzungen und Privilegien des Klosters Meer, zu denen auch ein „Allodium Walescheit cum ecclesia“ = ein Allod zu Wahlscheid mit der Kirche gehört. Auch im Siegburger Mirakelbuch aus dem Jahre 1183 finden wir Wahlscheid: „Item rustica quedam de villa Walescheit...“ Hier wird erzählt, daß eine Bauersfrau aus Wahlscheid, die seit längerer Zeit weder hören noch sehen konnte, im Traum den Besuch des hl. Anno erhielt. Sie genas zusehends, konnte nach 14 Tagen bereits die Reliquien verehren und erlangte im Beisein einer großen Volksmenge auf wunderbare Weise den Gebrauch beider Sinne zurück. In einer Urkunde von 1187 bestätigt Abt Gerlach von Siegburg die Schenkungen an Besitz und Einkünften des Elemoslnars Heinrich zu Bedingungen, die bei einer Versammlung in Walscheid festgelegt wurden. Eine Urkunde vom September 1244 besagt, daß laut eines zwischen dem Kloster Siegburg und dem Kloster Meer abgeschlossenen Vergleichs der Verwalter des Meerer Hofes zu Walscheit dem Kloster Siegburg jährlich 8 Schilling zahlen soll. In dieser Urkunde wird auch gesagt, daß die Kirche in der Pfarre Wahlscheid dem Kloster Meer gehört (gemeint ist hier das Patronatsrecht der Wahlscheider Kirche): „...ecclesia de Meere in parrochia Walscheit,...“ Diese Urkunde siegelt u.a. ein „Henricus plebanus de Walscheidt“, der Verwalter des Wahlscheider Hofes (Münchhof). Auch im „über valoris“ um 1300 findet die Kirche zu Wahlscheid Erwähnung. Ein Steinfelder Mönch versah damals die Pfarrstelle zu Wahlscheid. Im Vasallenverzeichnis (1320-1349) des Abtes Wolfard I. von Siegburg wird ein Stück Land erwähnt, das zur „kirchen van Walscheit“ gehört (Siehe Anhang Nr. 2). In einer Urkunde aus der Zeit zwischen 1358 und 1364 wird ein Hof „Wege bei Waelscheit“. Die gleiche Schreibweise geht auch aus einem Vermerk auf der Rückseite der o. g. Urkunde von 1187 – stammend aus dem 15. Jahrh. – hervor: „De bonis attinentibus curie Waelscheit“ (über die zu Wahlscheid gehörigen Güter). Am 19. 4.1421 gibt Arnold, Pastor zu Wahlscheid, bekannt, daß ein gewisser „Theil von Kirchscheid“ das Gut zu Dorp als Mannlehen und Erbe, im Kirchspiel Wahlscheid gelegen, erhalten habe. Am 14. 2. 1452 wird Arnold von Walscheit als Schöffe vor Gericht in Hirzenach genannt. Bei der Auftragung der Untersassen des Herzogtums Berg aus dem Jahre 1487 gewähren mehrere Bürger des Kirchspiels Walscheyt Herzog Wilhelm II. ein Darlehen von insgesamt „30 enckel gülden“. Als Dienstmann von „Walscheyt“ wird ein „johan kurtte“ genannt. Eine weitere Schreibweise ergibt sich aus einer Urkunde vom 30. 4.1490 und aus dem Erkundigungsbuch der Gerichtsverhältnisse im Herzogtum Berg von 1555: Walscheidt. Mit Datum vom 20.6.1586 besteht ein Protokoll über eine Besichtigung des Weges von Walscheidt zur Sülzer Brücke, durchgeführt von „Wilhelm Nesselroet“ und Vertretern des „Kirspelß Walscheydt“.
Schon sehr früh werden Honrath und Wahlscheid von einem gemeinsamen Schultheißen verwaltet. Um 1500 ist „Henrich von der Ley Schulteis zu Honrath und Walscheid“. Sein Enkel Henrich bekleidet wiederum dieses Amt, das auf dessen Sohn „Wimar von Ley“ übergeht. Dieser Wimar von Ley (auch Wymmaren Ley genannt) unterschreibt als „scholtes zu Honrodt und Walscheidt“ im Jahre 1644 die die Gemeinden Wahlscheid und Honrath betreffenden Regelungen im neuen Rentund Lagerbuch des Amtes Blankenberg. Auch das Heberegister von „Hanrodt und Walscheit“ aus dem gleichen Jahre ist von ihm abgezeichnet. Im Jahre 1666 wird ein „VerZeigniß der manschafft im Kirßbell Walscheit“ als sog. Erbhuldigungsliste angelegt. Weitere Schreibweisen finden wir auf der Hondius-Karte (K 2) um 1600 Walscheid. Auf einem Kupferstich von N. Sanson aus dem Jahre 1670 (K 6) wie auch von 1673 (K 7) finden wir Walscheit, die gleiche Schreibweise 1690 (K 8) bei N. Visscher, ferner auf der Ploennis-Karte von 1715 und auf der Wiebeking-Karte von 1790.
In der ältesten Bevölkerungsstatistik Wahlscheids aus dem Jahre 1816 heißt es dagegen Walscheid. Leider ist in dieser Statistik nur die Gesamtzahl der Gemeinde Wahlscheid angegeben, und zwar 1029 Bewohner in 191 Gebäuden. 1833 werden 1209 Seelen und 227 Familien gezählt. Erst ab 1858 werden die Einwohnerzahlen für die Ortschaften getrennt angegeben. In diesem Jahre zählte Wahlscheid 25 Einwohner, 1864 schon 35. 1871 wohnten 30 und 1875 29 Personen in 6 Häusern. Erst als Auelerhof, Aggerhof, Müllerhof und Fliesengarten im Jahre 1927 in Wahlscheid umbenannt wurden, wird der Ort ein Dorf mit 250 Einwohnern. Diese Zahl wuchs bis 1950 auf 790 Einwohner an.
Zur Geschichte Wahlscheids gehört aber auch die Zeit der Reformation: Da das Patronat der Kirche von Wahlscheid, die dem hl. Bartholomäus geweiht ist, das Kloster Meer innehatte, besetzte dieses Kloster auch die Pfarrstelle. So kam es, daß bis zur Reformation meist die Prämonstratenserpatres des Klosters Steinfeld Pfarrer von Wahlscheid waren. Um 1550 war Peter von Düren, auch aus dem Kloster Steinfeld, Pfarrer in Wahlscheid. 1557 faßte die evangelische Lehre Fuß. Eine Zeit lang wechselten Pfarrer katholischen wie lutherischen Bekenntnisses. Das Kloster Meer war nicht mehr Herr der Lage, bis schließlich die Protestanten obsiegten. Letzter Kath. Pfarrer war Friedrich Klee bis 1645. Seitdem blieb Wahlscheid, und damit auch die Kirche, im Besitz der Protestanten. Daran änderte auch eine Befragung der ältesten Einwohner durch den Notar Hall nichts mehr. Die Katholiken hielten bis zur Einweihung der Neuhonrather Kirche (Siehe Seite 79) ihre Gottesdienste in den Hauskapellen von Honsbach und Schloß Auel. Durch weiteren Bevölkerungszuwachs bis in die heutige Zeit und wegen des weiten Kirchweges nach Neuhonrath wurde im November 1963 mit dem Bau einer neuen katholischen Kirche in Wahlscheid begonnen. Sie wurde am Ostersonntag 1966 von dem als Subsidiär ernannten Pfarrer i. R. Hermann Blank benediziert und am 8.4.1967 konsekriert. Sie erhielt den Namen „St. Bartholomäus im Tal“.
Aggerhof, ein Ortsteil Wahlscheids, an der Einmündung der Schiffarther Straße auf die B 484 gelegen:
Das um 1280 in einer Siegburger Urkunde genannte „Bona de Achera“ können wir leider nicht auf Aggerhof beziehen, da das Gut unter der Honschaft Vilkerath genannt ist. Wahrscheinlich ist der im Birker Bruderschaftsbuch von 1503 genannte „Johan van der acher“ auf Aggerhof zu beziehen, da sich im Mitgliederverzeichnis auch noch andere Ortsbezeichnungen aus der Honschaft Wahlscheid befinden. Ein sicherer Nachweis liegt dagegen aus dem Jahre 1586 vor. Vom 1.6.1586 ist ein Protokoll datiert, in dem der Weg vom Kirchspiel Wahlscheid zur Sülzer Brücke beschrieben wird. Bei der Besichtigung war ein „Schneider zur Acher“ zugegen. Vom Müllerhof führte der Weg über den Aggerhof weiter, wahrscheinlich über Schiffarth bergan nach Muchensiefen (damals nur Siefen genannt) durch „Nesselraids garten“.
Gemäß den Heberegistern des Amtes Blankenberg für die Honschaft Wahlscheid werden 11 abgabepflichtige Personen zur Acher genannt: „Johan Schmidt, Webers gut, Klein Dries gut, sein Halbman, sein Pechter, Bitters gut, der Halbman, Michaels gut, der Pechter, Heitgens gut modo Korstgens gut, der Pechter“. Auch in den Erbhuldigungslisten des Jahres 1666 finden wir zur Acher im Kirchspiel Wahlscheid 9 Eintragungen. An diesem Beispiel erkennen wir deutlich, daß schon im 17. Jahrh. die Tendenz zur Siedlung im Tal bestand. Auf der Ploennis-Karte von 1715 sind Zur Agger „viele Höfe“ vermerkt. Die Wiebeking-Karte von 1790 verzeichnet Acherhof. Eine weitere Schreibweise enthält die Tranchot-Karte von 1817 als Aggerhof .
1858 werden in Aggerhof 81 und 1864 97 Einwohner gezählt. 1871 wohnen dort 77 Personen in 17 Wohngebäuden, 1875 66 Personen in 15 Häusern. 1927 wird Aggerhof in Wahlscheid umbenannt und erscheint heute nur noch als Straßenbezeichnung „Im Aggerhof“.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Auelerhof,
ebenfalls Ortsteil von Wahlscheid, und zwar im Norden vor der Aggerbrücke an der B 484 gelegen:
Wie schon aus der Zusammensetzung des Namens mit „Auel“, wird die Gründungszeit dieser Siedlung jüngeren Datums sein. Immerhin finden wir schon einen Nachweis aus dem Jahre 1586. „Bernd und Schneider zum Auwel“ sowie „Heintz im Auwel“ werden in einem Protokoll bezüglich einer Besichtigung der Sülzer Brücke vom 10.6.1586 genannt.In den Heberegistern (Steuerlisten) aus dem Jahre 1644 werden „Michaels gut, Johan daselbst, Schroeders erben zum Auwell und der Pechter uff gewin“ als Abgabepflichtige genannt. Fünf Namen zum Auwel erscheinen in den Erbhuldigungslisten von 1666.
Weitere Namensbelege ergeben sich aus der Ploennis-Karte von 1715 Zum Auel mit dem Hinweis „viele Höfe“ (K 9), aus der Wiebeking-Karte von 1790 als Auel (K 10) und aus der Tranchot-Karte von 1817 als Auelerhof.
Der Ort war schon 1858 ein Dorf mit 163 Einwohnern. Die Zahl vergrößerte sich bis 1864 auf 180 Personen. 1871 wohnten 145 Personen in 31 Häusern, 1875 132 Personen in 28 Wohngebäuden. Von 1924 bis 1927 befand sich hier das Bürgermeisteramt der Bürgermeisterei Wahlscheid, eine Angabe, die der Realität nicht ganz entspricht; denn das Bürgermeisteramt blieb hier, lediglich wurde Auelerhof 1927 in Wahlscheid umbenannt, so daß heute nur noch die Straßenbezeichnung „Im Auelerhof“ an die einst selbständige Siedlung erinnert.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Die Straße Hammerwerk im Ortsteil Wahlscheid ist nach dem bis 1998 ansässigen Familienunternehmen Ernst Wilhelms GmbH & CO KG, Hammerwerk und Maschinenfabrik, Wahlscheid benannt.
Katharinenbach liegt östlich von Wahlscheid und unterhalb von Schönenberg. Auf der Ploennis-Karte von 1715 ist ein Freihof Bach eingetragen. Der Lage nach - nahe Schönenberg und Hohn - wäre eine Zuordnung zu Katharinenbach möglich. Auf derTranchot-Karte von 1817 ist Catharienenbach und auf der Hartmann-Karte von 1845 Katharinenbach genannt. Nach den Ortschaftsverzeichnissen von 1858 hatte die Siedlung 9 Bewohner. 1871 und 1875 wohnten ebenfalls 9 Bewohner in 1 Wohnhaus zu Katharinenbach. Quelle: Wilhelm Pape, Siedlungs- und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar, 1983.
Müllerhof,
(heute Ortsteil von Wahlscheid) liegt an der B 484 sofort am Ortsanfang Wahlscheids auf etwas höher gelegenem Gebiet der Aggerniederung, wenn wir aus Richtung Lohmar kommen. Die Siedlung war schon sehr früh durch eine Furth, dann durch eine Brücke mit Schiffarth verbunden. Von hier aus führte der Weg über Schiffarth, Hitzhof, Schöpcherhof, Kirchscheid zur Sülzer Brücke (Siehe Anhang 14).
Wie wir anschließend aus der Entwicklung der Schreibweise ersehen können, leitet sich der Siedlungsname von „Mühle“ ab. Später wandelte sich der Name in den Besitzer der Mühle, eben der Müller, um.
Als am 10. 6.1586 auf Veranlassung des Kirchspiels Wahlscheid durch Wilhelm von Nesselrode und mehreren Zeugen der Weg von Wahlscheid zur Sülzer Brücke beschrieben wird (siehe oben), sind auch „Michel zur Müllen“ und „Peter zur Müllen“ zugegen. Wir erfahren, daß der Weg schon seit 70 Jahren durch die Höfe von „Michael und Peter“ führte: „... die fahrt hette siebenzig Jahr durch Michelß hoff zur Müllen und durch Peters hoff an der Acher bey der dreyen Eychen“ geführt. Somit können wir unbestritten sagen, daß der Müllerhof schon um 1500 bestand.
In den Heberegistern (Steuerlisten) aus dem Jahre 1644 werden „Michaels gut zur Mühlen, deßen Pechter von gewin, Bertram zur Müllen und Bernhardt zur Müllen“ als abgabepflichtig geführt.
„Bernhart, Wilhelm und Bertram zur Müllen“ erscheinen 1666 auf den Erbhuldigungslisten „der manschafft im kirßbell Walscheit“.
Weitere Namensbelege finden wir auf der Ploennis-Karte von 1715 als Hof Zur Mühlen und auf einer Flurkarte von 1822 als Müllerhof.
Obwohl die Siedlung 1858 schon 38 Seelen zählte, und 1871 37 Bewohner in 12 Häusern aufwies, wurde auch sie 1927 in Wahlscheid umbenannt, so daß heute nur noch die Straßenbezeichnung „Im Müllerhof“ an sie erinnert.
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Weegen liegt im Südwesten der Stadt Lohmar an der Kreisstraße 37, die die Bundesstraßen B 507 (Jabachtalstraße) und B 56 miteinander verbindet. Bis zur Kommunalreform 1969 gehörte der Ort im Amt Lohmar zur selbstständigen Gemeinde Halberg. Heute wohnen hier ca. 850 Personen.
Weilerhohn,
nördlich von Scheid an der Kreisstraße nach Honrath gelegen: Mit Weiler bezeichnete man im 19. Jahrh. in der Regel eine Siedlung mit 4 bis 8 Wohnhäusern. Auch eine Siedlung mit nur 2 Wohnhäusern wurde zuweilen im Gegensatz zum Einzelhof mit Weiler bezeichnet. Da in der Bürgermeisterei Wahlscheid die Namen Hohn und Höhnchen mehrfach Vorkommen, gab man diesem Hohn bei Honrath um die Jahrhundertwende den Namen Weilerhohn, entstanden aus dem Weiler mit Namen Hohn.
So finden wir in den Heberegistern (Steuerlisten) des Amtes Blankenberg aus dem Jahre 1644 in der Honschaft Honrath als abgabepflichtig die „Steißer von der Haen“ sowie „den Halbman uff gewin“.
In den Erbhuldigungslisten von 1666 wird ein „henrich auff han“ genannt.
Den Namen Hohn oder Weilerhohn finden wir jedoch nicht auf der Ploennis-und Wiebeking-Karte. Die Ploennis-Karte von 1715 weist hier ein Selshöhe aus und die Wiebeking-Karte von 1790 ein Gigeishöh .
Hohn hatte 1858 12 und 1864 14 Bewohner. 1871 und 1875 werden 13 Bewohner in 2 Wohnhäusern gezählt.96
Quelle: Siedlungs und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar von Stud.-Direktor Wilhelm Pape
Wickuhl ist ein Weiler in der Stadt Lohmar und liegt im Nordwesten des Stadtgebietes in der Nähe von Honrath.