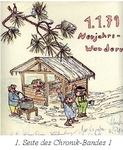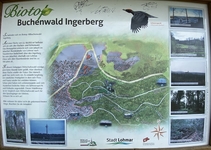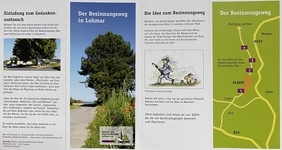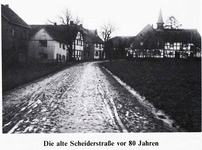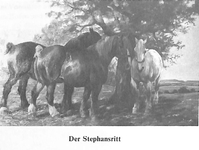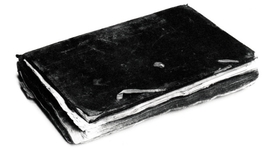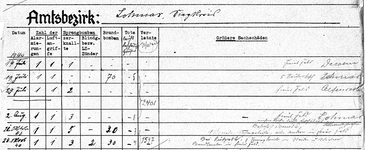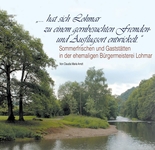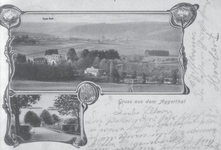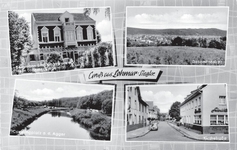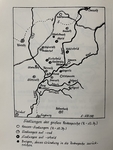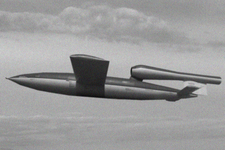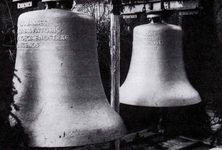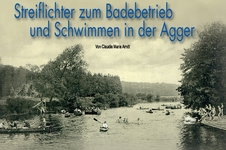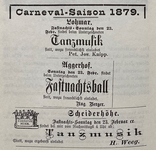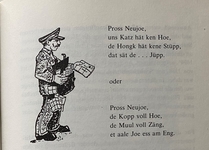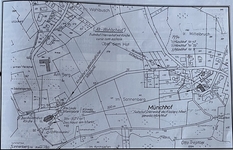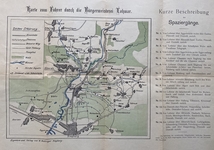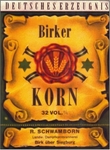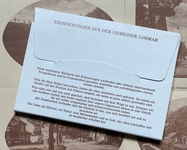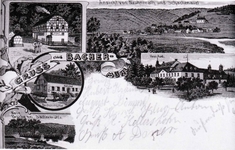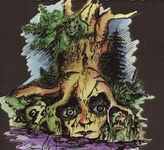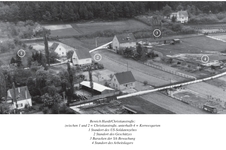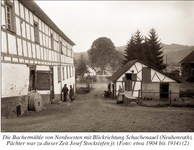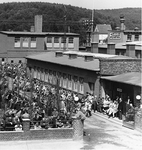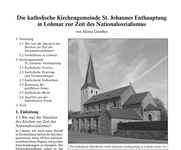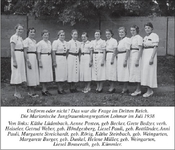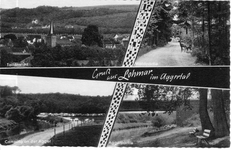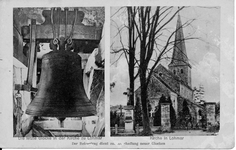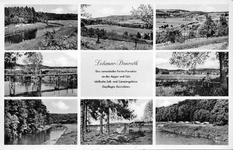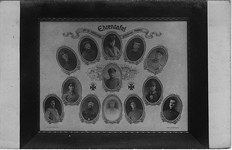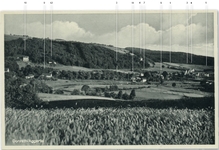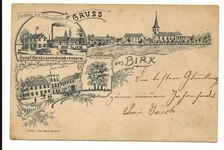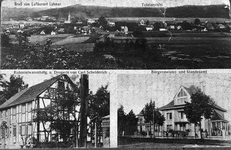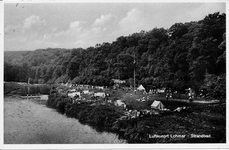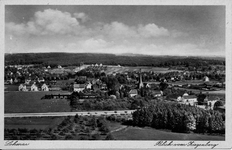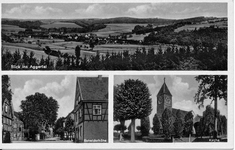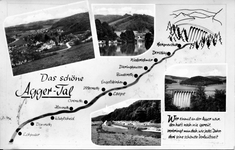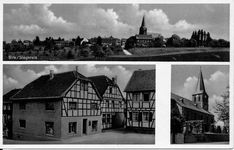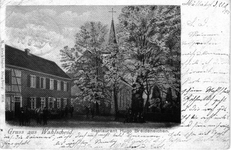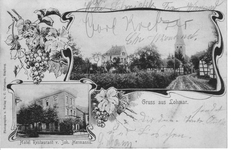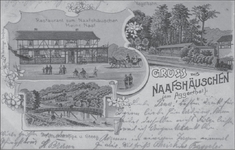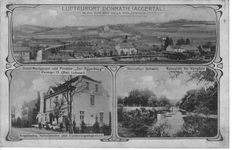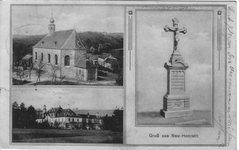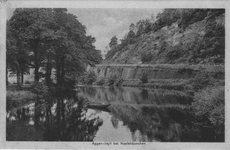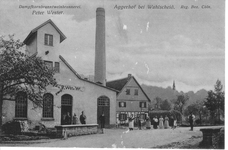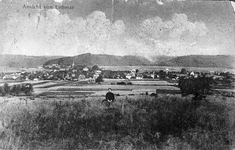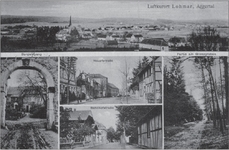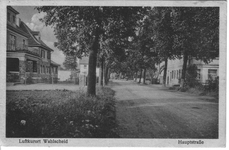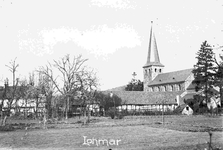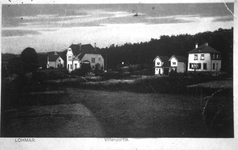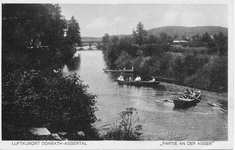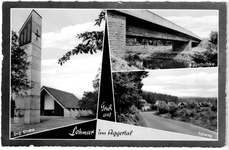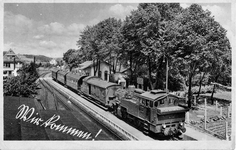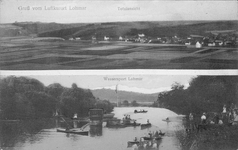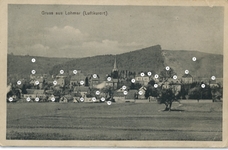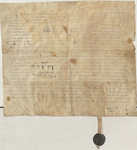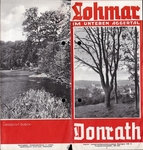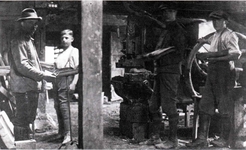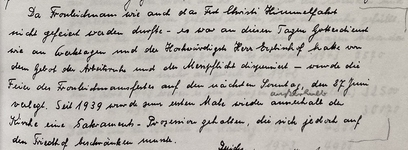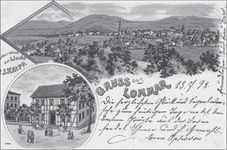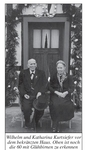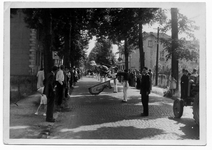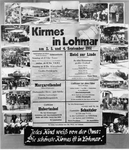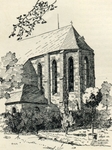Exponat-Suche
|
1911
- 1920 Fast 4000 Lichtmasten gehören der Stadt Lohmar, mehr als die Hälfte mit quecksilberhaltigen Leuchtstofflampen Die Straßenlaterne der Zukunft soll nicht nur Fahrbahnen und Wege erhellen, sie soll auch auf die Tierwelt Rücksicht nehmen und als... Fast 4000 Lichtmasten gehören der Stadt Lohmar, mehr als die Hälfte mit quecksilberhaltigen Leuchtstofflampen Die Straßenlaterne der Zukunft soll nicht nur Fahrbahnen und Wege erhellen, sie soll auch auf die Tierwelt Rücksicht nehmen und als Tankstelle für Elektroautos dienen. In Lohmar soll die intelligente, digitale Beleuchtung bald in einigen Straßen erprobt werden (siehe Dokument). Elektrisches Licht ist überall vorhanden. Das war nicht immer so. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg leuchteten in Deutschland vor allem gasbetriebene Laternen. In Lohmar wurde 1910/1911 neben einer zentralen Wasserversorgung (Brunnen, Pumpenhaus) im freien Feld im Wiesenpfad ein Aerogengaswerk gebaut. Das Gaswerk bestand aus dem Gaserzeuger mit einer stündlichen Leistung von 36 cbm und einem Gasbehälter mit einem Fassungsvermögen von150 cbm Aerogengas. Neben der Belieferung der Lohmarer Bevölkerung mit Luftgas wurde auch eine bescheidene Straßenbeleuchtung eingeführt. Das Gaswerk wurde von der Firma Aerogen GmbH betrieben und lieferte Luftgas für die 15 Straßenkandelaber, das Rathaus und einige Privathäuser. An der Hauptstraße stand in einer Entfernung von etwa 150 – 200 Meter, meist an Wegeabzweigungen, je eine Gaslaterne. Im restlichen Gebiet des Dorfes waren sie noch dürftiger aufgestellt. Der Schlossermeister Wilhelm Pape, Geburtsjahrgang etwa 1848, betreute in Lohmar das erste Gas- und Wasserwerk recht und schlecht. Im früheren Waldweg, heute Humperdinckstraße, besaß er eine kleine Schlosserei. Da er keine Vorbildung auf dem Gebiet des Wasserleitungsbaus und einer Gasversorgung besaß, musste er sich mit seinen heranwachsenden Söhnen in die neuen Gebiete einarbeiten. Neben seiner handwerklichen Tätigkeit lief er an dunklen Abenden von Gaslaterne zu Gaslaterne, ein kleines Leiterchen auf der Schulter, um jede Gaslaterne anzuzünden und sie später wieder zum Erlöschen zu bringen. Eine mühselige Arbeit für den etwas mager geratenen Wilhelm Pape. Die Verglasung war regelmäßig von Ruß und Schmutz zu befreien. Im Winter bestand zusätzlich die Aufgabe, die Steigleitungen „Eisfrei“ zu halten. Das Leuchtgas war sehr feucht und dadurch konnte es zu Eisbildungen in den Leitungen kommen. Um dies zu verhindern, wurde Spiritus, ein Alkohol, auf die Düsen der Lampen gegossen. Dieser Alkohol konnte natürlich auch anderweitig genossen werden. Aus diesem Umstand leiten sich zwei Sprichwörter bei übermäßigem Alkoholkonsum ab: „Einen auf die Lampe gegossen…“ und „Der hat alle Lampen an…“ Das gemeindliche Gaswerk hauchte nach etwa 6 - 7 Jahren seines Bestehens sein Leben wieder aus.
| |
„Wie Sand am Meer“ ist ein altes Bibelzitat und eine Redewendung, die beschreibt, wenn etwas im Überfluss vorhanden ist. In Deutschland stammen Sande und Kiese aus den Ablagerungen, die Flüsse und Gletscher im Lauf von Hunderttausenden und mehr... „Wie Sand am Meer“ ist ein altes Bibelzitat und eine Redewendung, die beschreibt, wenn etwas im Überfluss vorhanden ist. In Deutschland stammen Sande und Kiese aus den Ablagerungen, die Flüsse und Gletscher im Lauf von Hunderttausenden und mehr Jahren hinterlassen haben. Doch der begehrte Rohstoff Sand wird allmählich knapp. Die Nachfrage aufgrund des anhaltenden Baubooms ist nach wie vor hoch. Für ein Einfamilienhaus benötigt man etwa 200 Tonnen Sand. In den 1920er bis 1960er Jahre wurden in Lohmar größere Sandvorkommen abgebaut. Die Sandgebiete lagen zwischen Hauptschule, Südstraße und Heide und im Dreieck Lohmar, Altenrath und Troisdorf. Peter Höndgesberg, Spitzname „Coco“, betrieb in Lohmar am Birkenweg und unterhalb von Lohmarhohn bis Ende der 1960er Jahre größere Sandgruben. Schon als Kind war er dabei, wenn sein Vater Johann mit einem Pferde-Einspänner 2 Kubikmeter Sand aus der Sandgrube an der Straße Lohmar – Altenrath unterhalb des Ziegenbergs zum Bahnhof an der Kirchstraße transportierte, um täglich 2 Eisenbahnwaggons zu beladen. Aufgrund des Baubooms nach dem Zweiten Weltkrieg, eröffnete „Coco“ seine erste Sandgrube. Anhand von Probebohrungen bis in 10 Meter Tiefe erkundete er ein lohnendes Abbaugebiet am Ende der Schmiedgasse in Richtung Birkenweg. 1948 schloss er mit der Gemeinde Lohmar einen Vertrag zur Sandausbeute. Täglich wurden 40 bis 50 Kubikmeter Sand abgebaut. 1961 war das Sandvorkommen erschöpft. Die Gemeinde verfüllte die Sandgrube mit Bauschutt und legte dort in den 1970er Jahren eine Laufbahn für den Sportbetrieb der Hauptschule an. Von 1961 bis 1969 betrieb Peter Höndgesberg unterhalb von Lohmarhohn seine zweite Sandgrube. Über Peter Höndgesberg: Einer der letzten Sandgrubenbetreiber und über die Tradition der Sandausbeute in Lohmar berichtet Wolfgang Weber in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter 2002, siehe Dokument
| |
1848 hatte Johann Peter Wilhelms den Grundstein für den Betrieb mit einer kleinen Schmiede für Hufbeschlag und Wagenbau gelegt. Neben seiner Schmiede und Schlosserwerkstatt baute er 1864 ein massives Wohnhaus, in dem alle folgenden Generationen geboren wurden. Davor pflanzte er eine Linde, die heute noch steht. 1880 übernahm sein Sohn August den Betrieb und stattete ihn mit kraftgetriebenen Maschinen wie Drehbank und Bohrmaschine aus. August Wilhelms wurde der stärkste Mann im mittleren Aggertal genannt, was er bei seinem 50. Arbeitsjubiläum 1916 nochmals unter Beweis stellte und mit 64 Jahren in Gegenwart von Gratulanten wie dem Bürgermeister Schmitz aus Münchhof einen 528 Pfund schweren Amboss anhob. Bereits 1911 hatte er den Betrieb auf seinen Sohn Friederich (genannt Fritz) übertragen. Ab 1928 begann die Einzel- und Serienfertigung von Weichenverbindungsstangen für Schienenfahrzeuge und von sonstigen Schmiedestücken für Schienenfahrzeuge. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges übernahm sein Sohn Ernst Wilhelm den Handwerksbetrieb und ließ ihn im Handelsregister als Industriebetrieb eintragen. Er forcierte die Fertigung von Ersatz- und Neubauteilen für Dampflokomotiven und schuf moderne Einrichtungen für die Freiformschmiede (hier können größerer Werkstücke unter Hämmern und Schmiedepressen hergestellt werden). Das Betriebsgelände wurde um weitere 20.000 qm erweitert. Nach dem Kriegsende 1945 änderte sich die Situation. Der Bedarf an Teilen für Dampfloks ging zurück. 1956 nahm die Firma Wilhelms die Produktion von Bauteilen für Walzwerke, Bagger, Gabelstapler, etc auf. Als erster Betrieb in der Bundesrepublik Deutschland wurden Gabelzinken produziert. 1964 stiegen seine Söhne Ernst Friederich und Wolfgang in die Geschäftsleitung ein. Das Fertigungsprogramm der 1980er Jahre umfasste die spanlose und spangebende Stahlverformung zur Herstellung von Kurbelwellen, Druckplatten, Gabelzinken, Baggerzähnen, etc. Zu Beginn der 1990er Jahren änderten sich die wirtschaftlichen Verhältnisse gravierend. Am 1. Oktober 1993 übernahm das englische Unternehmen MSI Mechforge LTD aus Doncaster in South Yorkshire die Firma Wilhelms. Die Produktion und die Schmiedehämmer wurden nach England verlagert. Wilhelm Pape hat die Firmen- und Familiengeschichte 2001 festgehalten, siehe Dokument.
| |
Peter Adolf Schneider (Spitzname „Struch“) lernte das Schmiedehandwerk bei seinem Vater Peter Wimar Schneider, der eine Gaststätte „Jägersruh“ (später Hubertushof, Achnitz) und eine Schmiede an der Ecke Hauptstraße/Auelsweg betrieb. Die Gebäude wurden 1998 im Zuge des Ausbaus der Straßenkreuzung abgerissen. Anfang der 1920er Jahre baute Peter Adolf ein eigenes Wohnhaus mit Schmiede an der Ecke Bachstraße/Hauptstraße. Eine seiner Hauptschmiedearbeiten war das Beschlagen von Zugpferden. 1960 gab er sein Schmiedehandwerk auf. 1976 verstarb er im Alter von 88 Jahren. Erst nach seinem Tod wurde die Schmiede abgerissen und durch ein neues Gebäude ersetzt (Bachstraße 45), in dem seine Enkelin Irene Frings viele Jahre ein Küchenstudio betrieb. Der Schlossermeister Wilhelm Pape wurde 1846 in Lohmar geboren und übernahm mit etwa 30 Jahren die Werkstatt seines Vaters „In der Gasse“, heute Humperdinckstraße 6. Bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges hatte er viel zu tun und beschäftigte neben seinen Söhnen weitere Lehrlinge. Die Hauptarbeiten waren das Anfertigen und Reparieren von Schlössern an Haus und Stalltüren. Nebenbei betreute er auch die um die Jahrhundertwende errichtete Straßenbeleuchtung mit Gaslaternen, die einzeln angezündet werden mussten. Das Gaswerk befand sich im Wiesenpfad. Seine beiden Söhne übernahmen nach dem 1. Weltkrieg die Schlosserei und eröffneten Mitte der 1920er Jahre noch dazu eine Eisenwarenhandlung im alten „Hüsers Haus“ (später Handarbeitsgeschäft Niedergesäß) an der Hauptstraße. Wegen der schlechten Wirtschaftslage gaben sie 1929 das Geschäft auf. Auch die Schlosserei wurde geschlossen. Wilhelm Pape starb 1934 im Alter von 88 Jahren.
| |
Die selten gewordene Winterlandschaft mit ergiebigen Schneefällen am 17./18. Januar 2024 nutzten viele Kinder mit Freude zum Schlittenfahren, zumal der Schulunterricht wegen „Unwetter“ (!) abgesagt worden war. An Winterfreuden der 1930er bis Anfang... Die selten gewordene Winterlandschaft mit ergiebigen Schneefällen am 17./18. Januar 2024 nutzten viele Kinder mit Freude zum Schlittenfahren, zumal der Schulunterricht wegen „Unwetter“ (!) abgesagt worden war. An Winterfreuden der 1930er bis Anfang der1970er Jahre und an die legendäre Rodelbahn „Et Hubbelsbähnche“ erinnert Gerd Streichardt in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter aus dem Jahre 2010, siehe Dokument. Die Rodelstrecke befand sich angrenzend an den Park Lohmarhöhe in der Nähe einer Gabelung zweier Waldwege, die in den Ingerberg führten. Die Strecke war nur ca. 200 m lang, hatte aber mehrere tückische Hubbel (Erdverwerfungen), die oft die Schlitten zu Bruch gehen ließen. Auch die beiden Waldwege links und rechts der Gabelung waren beliebte Rodelbahnen; die rechte war besonders lang und gefährlich und wurde deshalb „Todesbahn“ („Dudebahn“) genannt. Die Strecke oberhalb im Ingerberg diente auch als Skipiste. Hier gaben in den 1960er Jahren die Brüder Rolf und Hardy Walterscheid-Müller den Lohmarer Jungs ein paar Tipps, wie man auf Ski die Kurve kriegt. Sie brachten das Können aus ihren Skiurlauben mit. Unbeeindruckt von der Kurventechnik blieb Frank ("Männlein") Haas, der später von seinem Vater Helmut die Allianz-Vertretung in Lohmar übernahm. Er fuhr stets Schuss, meistens ohne Baumkontakt, den steilen Hang hinunter mit einer Textilbremse zum Abschluss. | |
Mit dem Kirch- und Schulweg verbinden sich in der Regel viele Kindheitserinnerungen. Unzählige Erlebnisse und Eindrücke bleiben präsent. Geht man heute durch das Ortszentrum von Lohmar in Richtung altes Kirchdorf sieht die Welt anders aus als in den... Mit dem Kirch- und Schulweg verbinden sich in der Regel viele Kindheitserinnerungen. Unzählige Erlebnisse und Eindrücke bleiben präsent. Geht man heute durch das Ortszentrum von Lohmar in Richtung altes Kirchdorf sieht die Welt anders aus als in den 1950er Jahren. Die Straßen mit den Häusern und ihren Bewohnern in den späten 1950er Jahren beschreibt Hans-Willi Höndgesberg (Jahrgang 1949), der auf der Kieselhöhe in Lohmar aufgewachsen ist, die alte Schule in der Kirchstraße besuchte und in der Kirche St. Johannes im alten Kirchdorf 1960 zur Kommunion gegangen ist, siehe Dokument. In dem Porzellangeschäft der Familie Vogt gegenüber der Kirche kaufte er mit seiner Schwester zum Muttertag die Sammeltassen. Die Heimabende mit den Pfadfindern wurden im Pfarrheim direkt neben der Kaplanei an der Kurve der Kirchstraße verbracht. Hinter dem Pfarrheim lagen die Schulgebäude aus rotem Backstein. Daran anschließend das Wohnhaus von Lehrer Bollmann, im Erdgeschoss der kleine Laden von Herrn Gogol mit Süßigkeiten und Schreibwaren. Gegenüber der Schule waren die Gärtnerei Ramme, die Stellmacherei Schmitz, das Juweliergeschäft Leonard, das Lebensmittelgeschäft Heimig und der Hutladen von Frau Gäb. Die Heimwege der Kinder von der Schule trennten sich meistens an der Hauptstraße. Auch an seinen weiteren Weg über Haupt- und Mittelstraße (Rathausstraße) erinnert sich Hans-Willi Höndgesberg genau und beschreibt die alten markanten Gebäude und die Begegnungen mit ihren Bewohnern. | |
|
Oktober 1923
Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg war die wirtschaftliche Notlage groß. Lebensmittel wurden vor allem in den städtischen Bereichen knapp. Ende Oktober 2023 spitzte sich die Situation zu. Die Kartoffelernte war in diesem Jahr besonders schlecht und... Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg war die wirtschaftliche Notlage groß. Lebensmittel wurden vor allem in den städtischen Bereichen knapp. Ende Oktober 2023 spitzte sich die Situation zu. Die Kartoffelernte war in diesem Jahr besonders schlecht und die Inflation galoppierte. Während die Wahlscheider dank eigener Gärten oder guter Beziehungen zu hiesigen Bauern, Ihren Hunger stillen konnten, traf es die Stadtbewohner von Köln schwer. In ihrer Not setzten sich die an der Bahnstrecke Köln-Overath liegenden Köln-Kalker zu Hunderten in den Zug und fuhren ins Bergische, um sich zu nehmen, was sie brauchten. Sie saßen auf den Dächern und Trittbrettern der total überfüllten Eisenbahn-Waggons. Von den Bahnhöfen Honrath und Overath schwärmten sie in Trupps von 20-50 Mann zu den Bauern bis nach Seelscheid und Much aus. Es kam zu gewaltsamen Zusammenstößen. Die Wahlscheider Bauern standen den „Kalkern“ zunächst hilflos gegenüber. Einen gut funktionierenden Polizeiapparat gab es nicht. Die Besatzungsmacht, die sich in dem Kartoffelkrieg zurückhielt, hatte die Bildung von Polizeitruppen unterbunden. Aber mit der Zeit ergriffen die Wahlscheider Gegenmaßnahmen. Die Männer von Wahlscheid setzten sich mit Mistgabeln, Hacken usw. („de ahl Wahlen met de Kaarstip“) in Richtung Bahnhof Honrath in Bewegung, um dort die „Kalker“ abzufangen. Die Wahlscheider besetzten den Hang, der sich zur Kirche Honrath hochzieht. Die Jäger der Gemeinde waren mit ihren Flinten erschienen. Die Geschlossenheit und Kampfbereitschaft der Wahlscheider hatte die „Kalker“ so beeindruckt, daß sie sich in Honrath nicht „an Land“ wagten. Sie fuhren weiter nach Overath... Vielleicht half den bewaffneten Wahlscheidem aber auch die strategisch hervorragende geographische Lage am Hang am Honrather Bahnhof. In seinem Buch "Wie et fröhe woe, Band II" berichtet Siegfried Helser über das Geschehen, siehe Dokument | |
Die St. Franziskus Xaverius Kapelle steht in der Kapellenstraße 45 in Lohmar-Heide. 1734 ließen Bewohner von Heide ein Holzkreuz bei einer sogenannten Volksmission von Jesuitenpatres benedicieren (segnen). Das Holzkreuz wurde in Heide aufgestellt und... Die St. Franziskus Xaverius Kapelle steht in der Kapellenstraße 45 in Lohmar-Heide. 1734 ließen Bewohner von Heide ein Holzkreuz bei einer sogenannten Volksmission von Jesuitenpatres benedicieren (segnen). Das Holzkreuz wurde in Heide aufgestellt und zum Schutz mit einer kleinen Holzkapelle versehen. Auf die Bitte der Heider Bürger, in der Kappelle an den Feiertagen Messen feiern zu dürfen, entschied der Kölner Erzbischof und Kurfürst Clemens August am 31.Okt.1735, dass die Kapelle zwar verbleiben dürfe, verbot aber, darin Messen oder Andachten zu feiern. Die hölzerne Kapelle stand bis 1830. Auf Initiative des Kirchenrendanten Jakob Roth wurde von 1843 -- 1845 eine neue Kapelle gebaut. Die Steine kamen aus einem Steinbruch von Gut Umschoß und dem Tannenbachtal in Lohmarer Wald. 1862 übertrug Jakob Roth das Grundstück an die Pfarrgemeinde Birk. Seine Erben stifteten 1867 80 Reichstaler unter der Bedingung, dass die Kapelle zur Feier einer Messe gesegnet würde. Am 3. Dez. (Fest des hl. Franz Xaverius) 1868 fand die Segnung wahrscheinlich durch Pfarrer Dr Aumüller statt. Um 1900 wurde der Kapellenverein gegründet und der Anbau des Turmes mit 2 kleinen Glocken finanziert. 1975 fand eine grundlegende Renovierung der Kapelle statt. Regelmäßige Gottesdienste wurden bis in das Jahr 2006 gefeiert. Das alte Kreuz wurde 2015 restauriert und in der Kapelle aufgestellt. Die Kapelle ist in der Regel sonn- und feiertags geöffnet. Bis Ende Oktober 2023 findet in der Kapelle in Heide eine Ausstellung zum Thema Heimat statt. In einer Auslage in der Kapelle ist die Geschichte der Kapelle nachzulesen. Der 2022 verstorbene Heimatforscher Heinrich Hennekeuser hat in einer Dokumentationschrift 1985 die Kapellengeschichte ausführlich beschrieben, siehe Dokument.
| |
|
2005
- 2006 Im Frühjahr 2005 ergriffen Helmut Otto (Landhotel und Landgasthaus Naafshäuschen) und Bürgermeister Wolfgang Röger die Initiative zur Gründung einer Bürgerstiftung Lohmar. Sie trugen die Idee an Ihnen bekannte Persönlichkeiten und Unternehmen heran.... Im Frühjahr 2005 ergriffen Helmut Otto (Landhotel und Landgasthaus Naafshäuschen) und Bürgermeister Wolfgang Röger die Initiative zur Gründung einer Bürgerstiftung Lohmar. Sie trugen die Idee an Ihnen bekannte Persönlichkeiten und Unternehmen heran. Schnell fand sich ein größerer Initiativkreis zusammen. Wertvolle Hinweise kamen in dieser Phase von Norbert Lenke, einem Steuerberater aus Rösrath, der 1 Jahr zuvor die Bürgerstiftung Rösrath mitgegründet hatte. Der damalige Rösrather Bürgermeister Dieter Happ hatte den Kontakt hergestellt. Es wurde sehr schnell deutlich, dass eine Bürgerstiftung ein möglichst hohes Stiftungskapital benötigt, um genügend Erträge für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung zu haben. Daher wurde entschieden, einen einmaligen Mindestbeitrag von 5.000 € für Stifterinnen und Stifter festzulegen. Weiterhin war man sich einig, die Bürgerstiftung frei von parteipolitischen Interessen zu halten. Innerhalb weniger Monate fanden sich 24 Gründungsmitglieder, die für die Startphase der Bürgerstiftung ein hervorragendes Stammkapital von 175.000 € (zum Vergleich: Startkapital Rösrath 55.000 €) zusammenbrachten. Die steuerliche Beratung und Betreuung übernahm ehrenamtlich der aus Lohmar stammende Wirtschaftsprüfer Joachim Weyer. Weniger hilfreich war in dieser Zeit ein politischer Antrag der Fraktion Soziale Demokraten zum Thema Bürgerstiftung. Die Fraktion hatte sich neu aus Gaby Trapp-Fischer und Stefan Müller gebildet, nachdem beide aus der SPD ausgetreten waren. Die übrigen Ratsmitglieder unterstützen jedoch die eingeschlagene Linie, die Initiative frei von politischen Beschlüssen und Einflussnahmen zu halten (siehe Dokument). Die Gründung der Bürgerstiftung Lohmar wurde am 1. Mai 2006 auf Schloss Auel gefeiert. Der damalige Innenminister Ingo Wolf weilte an diesem Tag mit seiner Frau bei der Feier zur Wiedereröffnung von Schloss Auel nach umfangreichen Sanierungsarbeiten und nahm gerne die spontane Einladung zur Gründungsfeier der Bürgerstiftung Lohmar wahr.
| |
Im Oktober 2010 wurde das brandenburgische Feldheim zum ersten energieautarken Ort Deutschlands gekürt. Daran gemessen war Wahlscheid seiner Zeit weit voraus. Nach erfolgreichen Verhandlungen der Gemeinde Wahlscheid mit dem Landrat des Siegkreises... Im Oktober 2010 wurde das brandenburgische Feldheim zum ersten energieautarken Ort Deutschlands gekürt. Daran gemessen war Wahlscheid seiner Zeit weit voraus. Nach erfolgreichen Verhandlungen der Gemeinde Wahlscheid mit dem Landrat des Siegkreises und dem Elektrizitätswerk Berggeist wurde 1924 die Wahlscheider Elektizitäts GmbH gegründet, die in der Bachermühle ein wassergetriebenes Elektrizitätswerk baute, am 1. Oktober 1924 den Betrieb aufnahm und die Häuser der Bürgermeisterei Wahlscheid mit Strom versorgte. Das Gesellschaftskapital von 108.000 RM setzte sich zusammen aus Gemeinde Wahlscheid 40.000 RM, Freiherr LA Valette 9.000 RM und Einlagen Bürger 59.000 RM. Die Bachermühle - eine Wassermühle - war im Besitz von Otto Freiherr von LA Valette de St. George. Er hatte der Gemeinde angeboten, sie für 50 Jahre zu pachten. Das Wasser für den Mühlenbetrieb kam aus der Agger aus einem Abzweig der angeströmten Fläche des Honsbacher Wehres. Im Dezember 1940 wurde bei einem Hochwasser ein Drittel der Wehrmauer des Stauwehrs unterhalb von Naafshäuschen weggerissen, so dass kaum noch Wasser in den Mühlengraben zur Stromerzeugung gelangte. Der Wiederaufbau des Stauwehrs stellte die Rentabilität des Elektrizitätswerks in Frage. Auf einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung wurde am 6.11.1942 der Verkauf an das RWE beschlossen. Die Gesellschafter wurden ausbezahlt und Wahlscheid hatte keinen Einfluss mehr auf die Stromversorgung. Das Betriebsgebäude wurde teilweise abgerissen. Bachermühle blieb für das RWE ein bedeutender Strom-Verteilungspunkt. Der 2022 verstorbene Realschullehrer und Heimatkundler Hans Warning hat die Geschichte der Wahlscheider Stromversorgung umfassend beschrieben, siehe Dokument. Ausführlich geht er auf die handelnden Persönlichkeiten der damaligen Zeit ein. Er beschreibt u.a. die Auseinandersetzung zwischen dem Freiherrn von LA Valette und dem Bürgermeister Max Koch und dem Beigeordneten Walter Lemmer, die darin eskalierte, dass der Freiherr 1933 eine Anzeige wegen öffentlicher Beleidigung beim Oberstaatsanwalt des Landgerichts Bonn einreichte.
| |
Der russische Angriffskrieg in der Ukraine erschütterte 2021 die Rahmenbedingungen der Energieversorung in Deutschland und der EU, die abhängig waren von russischen Energieimporten wie Erdgas, Öl und Kohle. 2022 explodierten die Strompreise. Im Jahr... Der russische Angriffskrieg in der Ukraine erschütterte 2021 die Rahmenbedingungen der Energieversorung in Deutschland und der EU, die abhängig waren von russischen Energieimporten wie Erdgas, Öl und Kohle. 2022 explodierten die Strompreise. Im Jahr 2023 rückte die Stromversorgung unter dem Aspekt des Klimaschutzes wieder in den Focus. Sie soll auf dem Weg zur Klimaneutralität einen wichtigen Beitrag leisten. Dabei ist es gerade mal gut 100 Jahre her, dass das elektrische Licht Einzug hielt in das damalige Amt Lohmar. Noch zu Zeiten des Ersten Weltkrieges brannten in den Haushalten Petroleumlampen zur Beleuchtung. Die Laternen der wichtigsten Straßen in Lohmar sowie das Rathaus und einige Privathäuser wurden mit Leuchtgas versorgt, das durch Kohlevergasung von der Firma Aerogen GmbH in Lohmar erzeugt wurde. Erst am 1. März 1922 beschloss der Gemeinderat in Lohmar sich dem Elektrizitätswerk (EW) Berggeist, dessen Aktienmehrheit dem RWE gehörte, anzuschließen. Zuvor war die Versorgung durch ein Elektrizitätswerk auf Lohmarer Stadtgebiet im Wiesenpfad gescheitert. Die übrigen 5 Gemeinden des Amtes Lohmar Altenrath, Breidt, Halberg, Inger und Scheiderhöhe waren schon Monate zuvor an das Schaltnetz des EW Berggeist angeschlossen worden, da sie sich bereits vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges für den Anschluss an Berggeist ausgesprochen hatten. Der 2022 verstorbene Realschullehrer und Heimatforscher Hans Warning hat die Geschichte der Stromversorgung in Lohmar und den Amtsgemeinden recherchiert, siehe Dokument.
| |
Der Heimatverein Birk blickt auf eine über hundertjährige Vereinsgeschichte zurück (Gründungsjahr 1920). Drei Jahrzehnte (1984 – 2014) führte Dr. Jörn Hansen als Vorsitzender die Geschicke des Vereins. Er verstarb im Alter von 83 Jahren am 14. Juni... Der Heimatverein Birk blickt auf eine über hundertjährige Vereinsgeschichte zurück (Gründungsjahr 1920). Drei Jahrzehnte (1984 – 2014) führte Dr. Jörn Hansen als Vorsitzender die Geschicke des Vereins. Er verstarb im Alter von 83 Jahren am 14. Juni 2023. 36 Jahre lang hat der Verein in 24 Chronikbänden die Geschehnisse von 1979 – 2014 mit Berichten und Bildern festgehalten. Sie beginnen mit der Neujahrswanderung 1979 im Band 1 und enden mit dem Hinweis auf das 1. Boule-Turnier im Birker Dreieck im Band 24. In diese Zeit fallen das Algerter Dorffest mit der Einweihung des Algerter Kreuzes 1989, das 75jährige Vereinsjubiläum 1995, die Einweihung des Schwibbogens am Eppendorfplatz 2003 und die Feier zu 700 Jahre Birk 2010. Dr. Jörn Hansen hat 2016 in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter eine Übersicht über interessante und bemerkenswerte Ereignisse zusammengestellt, siehe Dokument.
| |
|
1914
- 2023 Am 14.Juli 2023 fand der Spatenstich für den neuen Modepark Röther in der Raiffeisenstraße 13 statt. Hier entsteht bis Ende 2024 ein Modehaus mit einer Verkaufsfläche von 5600 qm über 2 Etagen. Reiner Sieben verfolgte als alter Firmenchef der Firma... Am 14.Juli 2023 fand der Spatenstich für den neuen Modepark Röther in der Raiffeisenstraße 13 statt. Hier entsteht bis Ende 2024 ein Modehaus mit einer Verkaufsfläche von 5600 qm über 2 Etagen. Reiner Sieben verfolgte als alter Firmenchef der Firma Kümpel das Geschehen mit gemischten Gefühlen. Bis zum Verkauf im Jahr 2016 an Röther stand das Areal im Eigentum der Familie Kümpel-Sieben. Hier war der Sitz der Firma Kümpel über 3 Generationen. Die Ursprünge gehen zurück auf Peter Kümpel II, der 1914 das alte Fähr- und Forsthaus „Zur Alten Fähre“ in Lohmar gekauft hatte und dort auch eine Tischlerei betrieb. Er erkannte schon früh die große Zukunft des Kunststoffs und nutzte ihn für den Innenausbau. 1939 gründeten Peter Kümpel II und sein Sohn Peter Kümpel III den Kunststoffverarbeitungsbetrieb „Peter Kümpel & Sohn, Kunststoffverarbeitung und Erzeugnisse aus Plexiglas“. 1978 wurde die Einzelfirma in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt und nach dem Tod von Peter Kümpel III im Jahr 1989 übernahm sein Schwiegersohn Reiner Sieben die Firmenleitung. Heute ist Geschäftsführer und Firmeninhaber sein Sohn Frank Sieben, der 1996 die Firma „Kümpel- Kunststoff-Verarbeitungswerk-GmbH“ gründete, in der die Firma „Peter Kümpel & Sohn KG“ verankert ist. Die Grundstücke für den ehemaligen Firmensitz waren von 1958 bis Mitte der 1970er Jahre gekauft worden. 1972 wurde das Verwaltungsgebäude an der Raiffeisenstraße bezogen. Die betrieblichen Zwänge für einen Neubau der Betriebsgebäude wurden über die Jahre immer größer. 2013 hatte man sich selbst um Grundstückskäufer bemüht, um die Umsiedlung auf eine neues Gewerbegrundstück zu finanzieren. Die Projektentwicklungs GmbH „INWO Bau“ aus Baden-Württemberg machte ein Angebot und wollte hier ein Einkaufsmeile mit einigen Filialisten errichten. Parallel dazu hatte Michael Röther, ebenfalls aus Baden- Württemberg, der Stadt gegenüber sein Interesse erklärt, ein Modehaus zu errichten. Er war von Klaudia Herrmann - Projektentwicklerin der Lohmarer Höfe – auf den Standort aufmerksam gemacht worden. Die Stadt entschied sich für den Modepark und stellte der Firma Kümpel eine neue Gewerbefläche an der Raiffeisensstraße zur Verfügung. 2018 siedelte die Firma in das neue Betriebsgebäude um. Wilhelm Pape hat die Firmen- und Familiengeschichte "Kümpel" in einem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter festgehalten, siehe Dokument.
| |
Die Burg aus dem 11. Jahrhundert ist dicht am Kirchturm gebaut, nur ein schmaler Gang trennt beide, über den in früheren Zeiten eine Verbindungsbrücke zwischen dem oberen Stockwerk der Burg und dem Inneren der Kirche, die im 12. Jahrhundert erbaut... Die Burg aus dem 11. Jahrhundert ist dicht am Kirchturm gebaut, nur ein schmaler Gang trennt beide, über den in früheren Zeiten eine Verbindungsbrücke zwischen dem oberen Stockwerk der Burg und dem Inneren der Kirche, die im 12. Jahrhundert erbaut worden ist, führte. Der romanische Kirchturm hat, da die Burg einen besonderen Bergfried nicht besaß, für Verteidigungszwecke dienen müssen. Nach alter Überlieferung soll vom Burgkeller aus ein Fluchttunnel nach Schloss Auel geführt haben. Im Jahre 1117 wird der Rittersitz erstmals urkundlich erwähnt. Auch in Honrath war die Reformationszeit eine bewegte Zeit. Pfarrer Peter Lemmer verteidigte anfangs des 17. Jahrhunderts trotz Vertreibung und Kerkerhaft unerschrocken seinen evangelischen Glauben. Das in den 80er Jahren gebaute Gemeindezentrum heißt „Peter-Lemmer-Haus“. Heute ist die Kirche wegen ihrer Akustik über die Grenzen hinweg bekannt als Veranstaltungsort für klassische Musik. Die Postkarte zeigt die Burg Honrath in den 30er Jahren. | |
|
1942
- 1948 Die Ereignisse der Kriegs- und Nachkriegsjahre hat der katholische Pfarrer (1938 – 1960) Wilhelm Offergeld wie ein Tagebuch in der "Chronik der Pfarre Lohmar“ niedergeschrieben. Die Lohmarer Bevölkerung hat nicht nur durch die Kriegsereignisse sehr... Die Ereignisse der Kriegs- und Nachkriegsjahre hat der katholische Pfarrer (1938 – 1960) Wilhelm Offergeld wie ein Tagebuch in der "Chronik der Pfarre Lohmar“ niedergeschrieben. Die Lohmarer Bevölkerung hat nicht nur durch die Kriegsereignisse sehr gelitten, sondern war in den ersten Nachkriegsjahren Flüchtlingsströmen, Hochwasserkatastrophen und auch Plünderungen und Raubzügen marodierender Zwangsarbeiter ausgesetzt, bis sich 1948 die Lage beruhigte. Neben dem Bericht aus der Pfarrchronik, sind Kriegserlebnisse in Donrath nachzulesen, siehe Dokument.
| |
Der Ingerberg liegt im Nordwesten des Lohmarer Waldes auf dem Höhenrücken zwischen dem Jabach- und Auelsbachtal. Auf einer Fläche von 6,6 ha hat die Stadt Lohmar 2008 hier eine Naturwaldzelle ausgewiesen. Sie besteht aus einem Eichen- und Buchenwald... Der Ingerberg liegt im Nordwesten des Lohmarer Waldes auf dem Höhenrücken zwischen dem Jabach- und Auelsbachtal. Auf einer Fläche von 6,6 ha hat die Stadt Lohmar 2008 hier eine Naturwaldzelle ausgewiesen. Sie besteht aus einem Eichen- und Buchenwald mit bis zu 200 Jahre alten Bäumen. Die Buchen- und Eichenwaldbestände wurden aus der Bewirtschaftung herausgenommen, der Wald sollte sich selbst überlassen bleiben. Auf großen Informationstafeln des Heimatvereins Lohmar an den beiden Ingerbergs-Wanderwegen ist Wissenswertes nachzulesen. Nach Plänen aus 2022 will die Stadt Lohmar aufgrund eines Antrages der Koalition aus Grünen, SPD und UWG hier einen Bewegungs- und Erlebnispfad anlegen mit Sportgeräten finanziert aus den Mitteln des Projektes „Moderne Sportstätten“ des Landessportbundes. Mit viel Aufwand und Energie haben die Lohmarer Heimatforscher Bernhard Walterscheid-Müller und Johannes Heinrich Kliesen die geschichtliche Entwicklung des Ingerbergs untersucht und dabei Marksteine der Lohmarer Siedlungsgeschichte entdeckt. Nach dem Aufstieg über den Forstweg am Ende der Buchbitze erreicht man ca. 200 Meter nach der Wegegabelung in Richtung Algert/Inger den Standort des ehemaligen Ingerbergshofes. Bei Ausgrabungen im Jahr 1980 wurden hier eine Menge Reste aus Stein und Holz und Keramikscherben gefunden, die ins 10. Jahrhundert zurückreichen. Um 1500 wird der Ingerbergshof erstmalig schriftlich erwähnt, nach 1790 findet sich der Name nicht wieder. Warum der Hof spätestens um 1800 von seinen Bewohnern aufgegeben wurde, ist ungeklärt. Etwa gleichzeitig mit der Siedlung Ingerbergshof stand am Fuße des Ingerbergs im Auelsbachtal ein Schleifkotten (kleine Hütte), wo das Werkzeug (Rindenritzeisen, Schälmesser, etc.) von Wald- und Loharbeitern geschliffen wurde. Die Lohrinde wurde zum Gerben von Tierfellen geschält. Die Lohe ist ein aus der Rinde junger Eichen gewonnener Extrakt, der für die Zurichtung von Tierfellen zu Leder verwendet wurde.
| |
Ein ökololgisch bedeutsames Projekt präsentierte der Landesbetrieb Wald und Holz NRW zusammen mit dem Lions Club Siegburg, dem Heimatverein Lohmar und der Fischzucht A. Pilgram GmbH am 19.042023 der Presse. Initiiert hatte das Naturschutzprojekt der... Ein ökololgisch bedeutsames Projekt präsentierte der Landesbetrieb Wald und Holz NRW zusammen mit dem Lions Club Siegburg, dem Heimatverein Lohmar und der Fischzucht A. Pilgram GmbH am 19.042023 der Presse. Initiiert hatte das Naturschutzprojekt der ehemalige Leiter des Kreisgesundheitsamtes und Mitglied des Lions Club Erich Klemme. Über seine früheren beruflichen Kontakte zum Vorstandsmitglied des Heimatvereins Wolfgang Röger hatte er den Heimatverein für eine Kooperation gewonnen. Auszug aus der Presseeinladung des Forstamtsleiters Stephan Schütte:: "....der Lohmarer Wald ist bekannt durch seine historischen Teiche, die im Mittelalter von der Abtei Siegburg zur Versorgung mit frischem Fisch angelegt wurden. Heute befindet sich der Lohmarer Wald im Besitz der Landesforstverwaltung NRW, die sich gemeinsam mit dem Fischereibetrieb Pilgram um den Erhalt der historischen Teichanlagen kümmert. In der Nachbarschaft der Teiche gibt es wertvolle Heidemoorrelikte, so auch in der Nähe der sog. 12-Apostel-Teiche. Vor über 150 Jahren wurde durch die damalige preußische Forstverwaltung die Heidemoore durch die Anlage von Gräben entwässert, um auch hier Waldbestände anzulegen. Aus heutiger Perspektive war dies damals ein Fehler, denn Heidemoore sind auf Grund der hohen biologischen Vielfalt ein seltener und unbedingt zu schützender Lebensraum. Im vergangenen Sommer konnten ein kleines Heidemoor in der Nähe der 12-Apostel-Teiche durch eine Spende des Lionsclubs Siegburg in Höhe von 5600 € mittels Verschließung der Gräben durch einen „Tonpfropfen“ wieder renaturiert werden. Jetzt nach dem Winterhalbjahr wird der Erfolg dieser Maßnahme sichtbar. Durch die Anhebung des Wasserstandes kann sich dort jetzt die noch relikthaft vorhandenen Heidemoor wieder gut entwickeln und so als ein wertvoller Lebensraum für seltene Pflanzen (Gagelstrauch, Königsfarn, Sonnentau, Moorlilie, eiförmige Sumpfbinse, Sumpf-Johanniskraut, gewöhnlicher Pillenfarn) und Tiere (Ringelnatter, Libellen) gesichert werden. Zusätzlich dient diese Wiedervernässung dem Klima- und Hochwasserschutz. Zum einen speichern Moore bei Ihrem Wachstum viel CO2, zum andern saugen die Moose bei Starkregenereignissen wie ein Schwamm das Wasser auf und geben es dann langsam wieder ab. Dadurch werden Hochwasserspitzen abgepuffert..." Es ist zu wünschen, dass dieses erfolgreiche Projekt sich fortführt in dem Projekt "Teichlandschaft Lohmarer Wald" des Strukturförderprogramms des Landes "Regionale 2025 Bergisches Land" . Projekträger ist die Stadt Lohmar. Der Presseartikel des Generalanzeigers vom 25.04.23 und die Beschreibung der Intinitative "Trittsteine" von Erich Klemme sind in dem Dokument nachzulesen.
| |
Sein Bruder Joseph hatte eine Hauslehrerstelle in Schloss Auel beim Freiherren Philipp de La Valette St George und übernahm die Verantwortung für die Erziehung und Schulbildung, nachdem ihre Mutter früh (1828) verstorben war. Johann Gregor wohnte im Gasthaus Lindenberg in der Hunschaft Höhe (Oberstehöhe) und ging in Neuhonrath zur Schule. Er fiel schnell durch seine Flinkheit und seinen gesunden Geist auf. Der damalige Lehrer Weeg in Neuhonrath, der neben dem Schulamt auch den Küsterdienst nebenan in der katholischen Kirche verrichtete, nutzte die Fähigkeiten und förderte den Jungen. Von Höhe zog Johann Gregor um in das Gut Rosauel, das zur Herrschaft Auel gehörte. Hier fühlte er sich sehr wohl. Schwerer fiel ihm das Einleben, als er nach Schloss Auel zu seinem Bruder umziehen musste. Besonders die Eingewöhnung an die strengen Tischsitten machten ihm Probleme. Seine nächste Station war danach der Umzug in das Schulhaus Neuhonrath, als sein Bruder zum Nachfolger des ausgeschieden Lehrers Weeg an die katholische Volksschule Neuhonrath berufen wurde. Hier wurde er schon zur Unterrichtung kleinerer und größerer Mitschüler eingesetzt. 1837 - 1838 besuchte er in Lohmar die Präparandenschule. Hier wurden junge Männer auf die Aufnahme in ein Lehrerseminar vorbereitet. Er wohnte bei dem Dorfschullehrer Johann Klein im Schulhaus, dass gleichzeitig Wohnung des Lehrers war. Ende 1838 trat Johann Gregor eine Unterlehrerstelle an der katholischen Mädchenschule in Elberfeld an. Seine soziale und karitative Einstellung zeigte Johann Gregor als er in Neuhonrath den „Armen-Kranken-Verein“ gründete. In Elberfeld war er Gründer und Initiator vieler sozialer Einrichtungen, von denen das bedeutenste Werk der „Elberfelder Gesellenverein“ war, aus dem das Kolpingwerk entstanden ist. Der 2022 verstorbene Lohmarer Realschullehrer und Heimatforscher Hans Warning hat den Aufenthalt von Johann Gregor Breuer in Lohmar beschrieben mit interessanten Einblicken in das damalige gesellschaftliche Leben, siehe Dokument.
| |
|
12. März 2023
Zu einer sonntäglichen Wanderung entlang der Agger und durch die Wahner Heide hatte das Vorstandsmitglied des Heimatvereins Lohmar Wolfgang Weber eingeladen. Die Nachfrage war so groß, dass nicht alle Teilnehmerwünsche erfüllt werden konnten.... Zu einer sonntäglichen Wanderung entlang der Agger und durch die Wahner Heide hatte das Vorstandsmitglied des Heimatvereins Lohmar Wolfgang Weber eingeladen. Die Nachfrage war so groß, dass nicht alle Teilnehmerwünsche erfüllt werden konnten. Schließlich trafen sich 35 Wanderer am Startpunkt an der Gaststätte „Zur alten Fähre“ an der Aggerbrücke nach Altenrath, in der Nähe der alten Aggerfurt durch die die Agger überquert wurde, bevor es eine Brücke gab. Die Wanderung führte entlang der Agger in Richtung Troisdorf bis zum Gedenkkreuz an die drei ermordeten Lohmarer kurz nach dem 2. Weltkrieg. Von dort ging es zum Aufstieg auf den Güldenberg (Höhe 110 m) zur Ringwallanlage aus der Eisenzeit. Sie wurde 1936 bei Ausgrabungen entdeckt und ist als Bodendenkmal geschützt. Auf dem weiteren Weg lagen die naturkundlichen Highlights mit dem Kronenweiher und dem Fliegenbergmohr, ehemalige Moore, die sich allmählich wieder zurückbilden. Entlang des Waldrandes ging es weiter in Richtung Aggeraue. Der (Wahner) Heidecharakter mit den offenen sandigen Flächen war deutlich zu erkennen. An dem Heiligenhäuschen der Familie Engels unter den drei Rotbuchen wurde Rast einlegt. Der nächste Halt war in der Aggeraue an einer Stelle, wo eindrucksvoll verfolgt werden konnte, wie die Agger sich ihr Bett gräbt und mäandriert, wenn man sie ihrer Natur überlässt. Nach Überquerung der Aggerbrücke in Siegburg/Troisdorf und einem Zwischenstopp auf dem Gelände des Kanu Club Delphin Siegburg mit freundlicher Bewirtung durch Guido Trompetter („Beim Guido“) ging es zurück entlang der Agger in Richtung Lohmar. Die Ruine Ulrather Hof, das Denkmal "Förster Kleinschmidt", die Widdauer Wiesen, der Widdauer Hof und die Restfundamente des von Engländern errichteten Barackenlagers in der Besatzungszeit nach dem 1. Weltkrieg waren Wegbegleiter und eindrucksvolle geschichtsträchtige Monumente. Am Ziel an der Burg Lohmar waren zwar alle von der über 4stündigen Wanderung geschafft, aber hellauf begeistert von den Eindrücken und Informationen. Mit einem herzlichen Applaus für den Organisator und Wanderführer Wolfgang Weber vom Heimatverein Lohmar endete die Tour. AusführlichenWander-Tour-Beschreibung, siehe Dokument. | |
|
2002
- 2003 In den Jahren 2002/03 wurde das Brückenbauwerk als Teil der Ortsumgehung Lohmar errichtet. Es verbindet die damals neu geschaffene Anschlussstelle Lohmar Nord an der Donrather Kreuzung mit der Autobahn A 3. Die Umgehung führt ca. 3 km über die... In den Jahren 2002/03 wurde das Brückenbauwerk als Teil der Ortsumgehung Lohmar errichtet. Es verbindet die damals neu geschaffene Anschlussstelle Lohmar Nord an der Donrather Kreuzung mit der Autobahn A 3. Die Umgehung führt ca. 3 km über die Autobahn bis zur alten Anschlussstelle zwischen Lohmar und Siegburg auf die Bundesstraße B 484. Die neue Brücke war erforderlich, weil aus Richtung Norden der Verkehr die Autobahn in einer Linkskurve überfahren muss. Die Brücke wurde in einem Stück aus Spannbeton von der Firma von der Wettern aus Köln errichtet. Sie hat nur eine Fahrspur und ist ca. 160 m lang. Die Baukosten beliefen sich auf rund 3 Millionen Euro. Jürgen Morich hat in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter die Bauphase beschrieben und in eindrucksvollen Bildern festgehalten, siehe Dokument.
| |
|
1666
- 1958 Der Backeshof wird bereits 1666 in der Erbhuldigungsliste urkundlich erwähnt und lag in der Flur und Gewannebezeichnung „Backesgarten“. Sie gehörte neben dem Griesberg (heute Kieselhöhe), dem Vogtshof, dem Linden- und Schmitthof sowie der Mühle zum... Der Backeshof wird bereits 1666 in der Erbhuldigungsliste urkundlich erwähnt und lag in der Flur und Gewannebezeichnung „Backesgarten“. Sie gehörte neben dem Griesberg (heute Kieselhöhe), dem Vogtshof, dem Linden- und Schmitthof sowie der Mühle zum Oberdorf. Mitte des 19. Jahrhunderts teilte sich die Ortsbesiedlung in Lohmar in das Kirchdorf, das Unterdorf und das Oberdorf. Das Haus- und Hofgrundstück befand sich auf den Parzellen 372 und 371, heute Bachstraße 6. Die Hofanlage ist ursprünglich ein landwirtschaftliches Anwesen des 17.-18. Jahrhunderts gewesen. 1836 erscheint urkundlich der Gastwirt Nikolaus Weingarten in Lohmar. Er ist in der Ur-Flurkarte von 1823 im Backesgarten als Eigentümer des Flurstücks 372 eingetragen. 1846 ist Johann Weingarten Wirt und Barriereempfänger, d.h. er hatte entweder von der Rheinprovinzialverwaltung oder der Gemeinde die Erlaubnis zur Chausseegelderhebung für die Finanzierung und Unterhaltung der neuen Straße von Beuel über Siegburg nach Overath (Chausseebau um 1845) erhalten. 1895 wurde der Hof mit Gaststube an Wilhelm Lehr verkauft. Er ließ keine Gelegenheit aus, weiteres Kulturland um seinen Hof und auch weiter abgelegene Gemarkungsteile zu kaufen. 1900 hatte er einen Besitz von 4 Hektar 24 AR und 52 Meter. Trotzdem reichten die Ackerlandflächen nicht aus für eine Vollbauernstelle. Wilhelm Lehr war nicht nur Ackerer, sondern auch Holzschneider und Fährmann an der Agger. Er verstarb 1906. Die Geschichte um den Backeshof hat Lothar Faßbender ausführlich in einem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter beschrieben, siehe Dokument. Er bietet interessante Erkenntnisse über die ersten Siedlungsansätze des Areals wischen der heutigen Rathausstraße, Bachstraße, Poststraße und Hauptstraße. Es wird deutlich, dass die historische Kulturlandschaft mit dem vorherrschenden kleinbäuerlichen Landbesitz, wie auch anderswo im Dorf, relativ schnell zerstört worden ist.
| |
|
26. Oktober 2019
Am 26.10.2019 wurde mit zahlreichen Gästen am Algerter Arma-Christi-Kreuz der Besinnungsweg eröffnet. Hier steht die erste von vier Tafeln, die entlang des alten Pilgerweges in Richtung Ingerberg/Lohmar den Wanderern Denkanstöße geben sollen. Der... Am 26.10.2019 wurde mit zahlreichen Gästen am Algerter Arma-Christi-Kreuz der Besinnungsweg eröffnet. Hier steht die erste von vier Tafeln, die entlang des alten Pilgerweges in Richtung Ingerberg/Lohmar den Wanderern Denkanstöße geben sollen. Der ehemalige Apoptheker Dr. Johannes Bolten hatte die Idee, die er mit dem ehemaligen HGV- Vorsitzenden Gerd Streichardt und dem Heimatverein Lohmar umsetzte. Die Tafeln enthalten Texte zu den klassischen Tugenden Gerechtigkeit, Maßhalten, Mut und Weisheit und deren Gegenteil Ungerechtigkeit, Größenwahn, Feigheit und Torheit. Sie knüpfen an die griechischen Philosophen Platon und Sokrates an. Die Lohmarer Glaskünstlerin und Buchautorin Brigitte Simon hat ihre Gedanken auf dem Besinnungsweg in einem Buch beschrieben, siehe Dokument. | |
|
1800
- 2023 Lohmar-Scheiderhöhe, Scheiderhöher Str. 44/46 Die in der Denkmalliste der Stadt Lohmar aufgeführte „Fachwerkhofanlage“ wurde um 1800 erbaut. Zwischen 1849 und 1900 wurde das Gebäude als Schule und Wohnung für die Lehrer mit ihrer Familie genutzt.... Lohmar-Scheiderhöhe, Scheiderhöher Str. 44/46 Die in der Denkmalliste der Stadt Lohmar aufgeführte „Fachwerkhofanlage“ wurde um 1800 erbaut. Zwischen 1849 und 1900 wurde das Gebäude als Schule und Wohnung für die Lehrer mit ihrer Familie genutzt. Das mietfreie Wohnen war Teil des Gehalts. Um 1900 wurde aus Platzbedarf ein neues Schulgebäude nebenan errichtet (jetziger Kindergarten). Bis Mitte der 50er Jahre wohnten verschiedene Lehrer mit ihren Familien im dem Haus. Nach Schließung der Schule in Scheiderhöhe wurde das Haus von der Gemeinde an die Familien Mester vermietet, die das Haus 1979 kauften. Seit 2010 sind Martina und Horst Furk die Besitzer. Mehrfach sollte das Haus wegen der geplanten Straßenverbreiterung abgerissen werden. Dies konnte durch den Rhein-Sieg Kreis und dem Landeskonservator verhindert werden, als Kompromiss wurde die Eingangstreppe demontiert. In den Räumlichkeiten befindet sich nun ein Atelier für Malerei und Schmuckdesign von Martina Furk. Weitere Künstlerinnen nutzen die oberen Räume als Atelier. In direkter Nähe des Fachwerkhauses befindet sich die Kunsthalle des Vereines „LohmART“ (alte Gymnastikhalle der Schule). Hierdurch ist der Standort zu einem Treffpunkt der bildenden Kunst geworden. Cronik: 1825 Bewohner Anton Steinbach (Parzelle 119, spätere Schule) 1848 Der Rat kauft das Haus von Daniel Miesenbach (Gerber und Gastwirt) für 2195 Reichsmark 1849 Lehrer Peter Becher nimmt den Schulbetrieb auf (nach Umbauarbeiten und Komplettierung der Inneneinrichtung, jetzt Haus-Nr. 6) 1864 Gemeinde Scheiderhöhe mit 846 Einwohner bevölkerungsreichstes Amt in Lohmar 1874 Anbau für weiteres Klassenzimmer für 7.600 Mark 1877 Lehrer und Küster bewohnen das Schulhaus, der Lehrer Peter Becher verstarb mit 57 Jahren nach 33 jähriger Tätigkeit 1877 Herr Wilhelm Stolzen für 1 Jahr Lehrer, Gehalt 62,50 Mark plus freiem Wohnen 1879 Wilhelm Bitzer wird Lehrer, 3 jährige Probefrist, Jahresgehalt 1.050 Mark und freies Wohnen und Nutzung Garten und Stallung 1894 Wilhelm Bitzen wegen Fehlverhalten suspendiert 1894 Nachfolger Baltasar Josef Heinzen nahm sich am 5 Juli 1895 das Leben 1895 24. Juli öffentliche Anzeige für neue Lehrerstelle 1895 Neuer Lehrer Johann Mungen bezieht Lehrerwohnung mit Familie 1948-1953 Familie Breuer bewohnen das Haus als Lehrerfamilie. Herr Breuer gibt auch Musikunterricht in Klavier und Gitarre im Haus. 1969 Die Gemeinde Lohmar will im Zuge der geplanten Straßenverbreiterung das Haus abreißen 1974 wieder geplanter Abriss. Der Rhein-Sieg Kreis und der Landeskonservator verhindert den Abriss. Als Kompromiss wurde die Eingangstreppe demontiert. 1979 Die Gemeinde Lohmar verkauft das Fachwerkhause für 50.658 DM 2010 Kauf des Fachwerkhauses durch Martina und Horst Furk und Eröffnung eines Ateliers für Malerei und Schmuckdesign
| |
|
1804
- 1968 Die Schule in Scheiderhöhe blickt auf eine 164 Jahre lange wechselvolle Schulgeschichte zurück, siehe Dokument. Die Schule in Scheiderhöhe blickt auf eine 164 Jahre lange wechselvolle Schulgeschichte zurück, siehe Dokument. In der Freiheit Scheiderhöhe lebten wohlhabende Adelsfamilien, Gutsherrn und Lehensmänner, deren Kinder teilweise überregionale höhere Schulen besuchten. Anfang des 19. Jahrhunderts waren von 142 Anwesen 36 größere Höfe, welche je einen steuerbaren Jahresreinertrag zwischen 5 bis 27 Reichstalern nachwiesen. Der Schulvorstand von Scheiderhöhe beauftragte erst am 20. Juli 1817 Paul Grames zu Kirchscheid und Anton Arends vom Hammersch mit dem Kauf des Hauses Nr. 1 vom Ackersmann Anton Steinbach. Der Kaufpreis betrug 2560 Franc. In diesem Schul- und Rektoratshaus fand 31 Jahre lang Unterricht für die Kinder der weitgestreuten Gemeinde statt. In den vergleichbaren Gebieten (Höfe und Lehensgüter) um Honrath, Schlehecken, Inger oder Birk legte man Wert auf bessere Ausbildung und finanzierte erforderliche Schulhäuser. Scheiderhöhe besaß als einzige „nur“ eine Rektorats- oder Vikarieschule. Schließlich fasste der Gemeinderat am 1. März 1848 den Beschluss, die Schule von der Vikarie zu trennen und entschied sich, das Anwesen des Gerbers und Gastwirts Daniel Meisenbach (Parzellennummer 119) für 2165 Reichstaler zu kaufen. Das Fachwerkhaus war als Schullokal mit einer Lehrerwohnung, bei günstiger Mittelpunktlage neben der Kapelle geeignet. Nach einigen Umbauarbeiten und der Komplettierung der Inneneinrichtung konnte Lehrer Peter Becher den Schulbetrieb 1849 aufnehmen. Damit war eine eigene, den Ansprüchen gerecht werdende Gemeindeschule für rund 120 schulpflichtige Kinder vorhanden. Zum Schulbezirk zählten: Bacherhof, Berfert, Brückerhof, Feyenberg, Gammersbach, Gammersbachermühle, Hagerhof, Hammersch, Hammerschbüchel, Haus Sülz, Helmgensmühle, Heppenberg, Hitzhof, Höngesberg, Hoverhof, Kellershohn, Kirchscheid, Klasberg, Knipscherhof, Kreuzhäuschen, Meigerhof, Meigermühle, Muchensiefen, Oberscheid, Pützrath, Reelsiefen, Rodderhof, Rottland, Scheiderhöhe, Scherferhof, Schiffarth, Schönrath, Schöpgerhof, Sottenbach, Wielpütz. 1874 kritisierte der Schulpfleger und die obere Schulbehörde das nunmehr 25 Jahre benutzte Schullokal. Man einigte sich auf den Anbau eines aus Ziegelsteinen zu errichtenden weiteren Klassenzimmers zum Betrag von 7600 Mark, worüber 1876 die Vergantung (Auftragsvergabe an den Mindestbietenden) durchgeführt wurde. Im Schulhaus konnte dem Küster längerfristig eine Wohnung vermietet werden, so dass Schule, Lehrer und Küster wieder in einem Hause vereint waren. Der Lehrer oder der Küster war in der Doppelfunktion auch Organist. Ein ständiges Problem auf der Scheiderhöhe war der vorgeschriebene wöchentliche Religionsunterricht für die kleine Gruppe evangelischer Kinder und der häufige Lehrerwechsel. Das änderte sich als 21. September 1895 Johann Mungen in sein Amt eingeführt wurde. Er unterrichtete viele Jahre annähernd 100 Kinder. Am 21. Dezember 1908 beschloß der Rat der Spezialgemeinde Scheiderhöhe endlich die Einrichtung der zweiten Schulklasse. Am 1. November 1911 wurde der Schulamtsbewerber Wilhelm Krautheuser aus Siegburg als Volksschullehrer der 2. Klasse ernannt. Während der bedrückenden Zeit der Kriegsjahre konnte Johann Mungen den Schulbetrieb auf seine verdienstvolle Art notdürftig aneinanderhalten. Lehrer Wilhelm Krautheuser verließ die Schule am 24. Oktober 1928. Johann Mungen wurde zum 1. April 1930 nach 35 Scheiderhöher Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand versetzt. Die Schule hatte zu dieser Zeit noch 64 Schüler. Sein Nachfolger Lehrer Heinrich Vetter wurde am 18. Juni 1942 zur Wehrmacht einberufen. Der Lohmarer Lehrer Josef Schmitz, später mit ihm abwechselnd auch Lehrer Grunenberg, übernahmen die Vertretung als Schulleiter. Wie an den übrigen Volksschulen des damaligen Siegkreises konnte auch auf der Scheiderhöhe am 11. September 1945 zunächst für die Grundschuljahrgänge der Unterricht wieder aufgenommen werden. Die Schule hatte seit Anfang des Jahres wegen der Kriegswirren geruht. Lehrerin Frau Christine Grell aus Altenrath übernahm den ersten Unterricht. Unter sehr erschwerten Verkehrsbedingungen machte sie täglich zu Fuß den Weg von Altenrath über den Sülzfluss zur Schule. Der außerplanmäßige Lehrer Heinrich Breuer aus Niederkassel trat am 3. Januar 1946 seinen Dienst an der hiesigen Schule an. Es waren an diesem Januarmorgen 76 Schulkinder erschienen. Alle Schuljahrgänge mußten in Scheiderhöhe nunmehr von Lehrer Breuer allein unterrichtet werden. Am 7. November 1949 wurde die notwendige Erweiterung der Schulräumlichkeiten durch den Bau eines dritten Klassenraumes durch den Gemeinderat mit einem Kostenaufwand von 20000 DM beschlossen. Am 14. November 1949 konnten mit gemeindlichem Hand- und Spanndienst die Ausschachtungsarbeiten für den Anbau beginnen. Der Schulerweiterungsbau konnte am 18. Dezember 1950 geweiht und seiner Bestimmung übergeben werden. !953 wurde heinrich Breuer vesrsetzt. Auf ihn folgte mit der Verfügung des Regierungspräsidenten vom 27. Februar 1954 der Hauptlehrer Heinrich Kurscheidt aus Lohmar, bisher als Lehrer in Birk tätig. Zur auftragsweisen Verwaltung einer Schulstelle kam Paul Demmer am 11. April 1961. Am 25. März 1963 wurde Hauptlehrer Heinrich Kurscheidt in einer würdigen Feier in den Ruhestand versetzt. Am 20. Juli 1964 trat der Hauptlehrer Fritz Küpper die Leitung der Schule an. 1967 übernahm er die Schulleitung in Birk und Paul Demmer wurde mit der Führung der Scheiderhöher Schule und Lehrerin Gabriele Wirtz mit der Unterrichtung der Kinder in der Klasse I beauftragt. Am 21. März 1968 verfügte der Regierungspräsident die Auflösung der Schule. Ab 1. August 1968 wurden die Hauptschüler (5.–9. Schuljahr) in das neu errichtete Hauptschulsystem in Lohmar integriert. An der verbliebenen Grundschule wurden am 16. August 1968 nur noch 38 Kinder gezählt. Nach eine Elternbefragung sollten nur 9 Kinder in Scheiderhöhe verbleiben. Nach 164 Jahren wechselvoller Schulgeschichte schlossen sich 1968 die Tore der katholischen Volksschule auf der Scheiderhöhe.
| |
Eine sagenhafte Anekdote (siehe Dokument) rankt sich um die „sauren Wiesen“ im Auelsbachtal unterhalb von Lohmarhohn, die südwestlich durch den Damm des Hochwasserrückhaltebeckens begrenzt werden. Hier soll ein schwedischer Reiterhauptmann während... Eine sagenhafte Anekdote (siehe Dokument) rankt sich um die „sauren Wiesen“ im Auelsbachtal unterhalb von Lohmarhohn, die südwestlich durch den Damm des Hochwasserrückhaltebeckens begrenzt werden. Hier soll ein schwedischer Reiterhauptmann während des 30jährigen Krieges zwischen 1618 und 1648 im Schlamm versunken sein. Die Sage wurde vom Historiker Peter Kemmerich, dem früheren Burgherrn und Landwirt „Hendrich“ Wasser sowie vom Konrektor der Lohmarer Volksschule Josef Grunenberg sogar in der Schule gerne erzählt.
| |
|
1395
- 2022 Die Flur „In der Freiheit“ verleiht dem unter Denkmalschutz stehenden Gut im 19. Jahrhundert seinen Namen. Urkunden aus dem 14. Jahrhundert ist zu entnehmen, dass mit großer Wahrscheinlichkeit der Ritter Hermann von der Seldunck erster namentlich... Die Flur „In der Freiheit“ verleiht dem unter Denkmalschutz stehenden Gut im 19. Jahrhundert seinen Namen. Urkunden aus dem 14. Jahrhundert ist zu entnehmen, dass mit großer Wahrscheinlichkeit der Ritter Hermann von der Seldunck erster namentlich bekannter Besitzer des Gutes war. Dies geht insbesondere aus einem Erbpachtbrief der Kunigunde von Aldenacher (Algert) vom 16. Mai 1395 hervor. Seit Mitte des 15. Jahrhunderts gehörte das Rittergut dem bergischen Geschlecht von Waldenburg, genannt Schenkern. Der bedeutendste Sitz der Familie im Rhein Sieg Kreis war Haus Rott bei Sieglar. Nachdem der letzte männliche Sproß Hugo Eberhard von Waldenburg 1715 in einer „donatio inter vivos“ das Haus Freiheit an seine Verwandten verschenkt hatte, ging bald danach der Besitz in nicht adelige Hände über. Durch Heirat wurde er 1836 an die Freiherren von Francken weitergegeben. In der Zeit von Adolf von Francken, der von 1851 -1965 Gemeindevorsteher von Inger war, werden östlich vom "Schenkerhof" die neuen Gebäude in der heutigen Form errichtet. Sein Sohn Karl Ludwig Philip Hubert Freiherr von Francken übernimmt das Gut. Er war von 1892 bis 1906 Bürgermeister der Bürgermeisterei Lohmar. Seine erste Sorge galt dem Ausbau der Jabachtalstraße, 1893. 1970 übernahm die in Sankt Augustin-Mülldorf alteingesessene Familie Franz Halberg von der Familie Osthoff das Gut. Ausführlich beschreibt Heinrich Hennekeuser in seinem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter Größe, Wirtschaftsweise und Naturalleistungen des Gutes, siehe Dokument. Ein Investor plant durch Um- und Neubau hier 23 Wohneinheiten zu errichten. Das Gros der Gebäude soll erhalten bleiben. | |
|
26. Dezember 1934
In den 1930er Jahren war es in Lohmar noch üblich, am zweiten Weihnachtstag den Stephansritt zu veranstalten. Am 26. Dezember, dem Stephanstag, ist das Fest des ersten christlichen Märtyrers, des hl. Stephanus. In vielen Gegenden ein echter... In den 1930er Jahren war es in Lohmar noch üblich, am zweiten Weihnachtstag den Stephansritt zu veranstalten. Am 26. Dezember, dem Stephanstag, ist das Fest des ersten christlichen Märtyrers, des hl. Stephanus. In vielen Gegenden ein echter Brauchtumstag. Stephanus wird als Patron der Pferde angerufen. Bernhard Walterscheid- Müller hat die Geschichte des weihnachtlichen Stephansausritt festgehalten, siehe Dokument. Lohmar zählte 1927: 32 Pferde, 164 Kühe und Ochsen, 82 Schweine, 136 Ziegen. Die ältesten Bauernsöhne und Fuhrleute, die Beckers, Höndgesbergs, Schultes, Jabächer Klein u. a. sammelten sich mit ihren Pferden am Backeshof (heute Im Backesgarten) und ritten über die Buchbitze und den Ingerberg bis zum Endziel, dem Lokal Franzhäuschen, wo sie Anton Salgert bewirtete. | |
|
1911
- 2022 Rechtzeitig zum ersten Advent 2022 hat der Lions Club Lohmar den Adventskalender aufgelegt. Das Motiv zeigt Scheiderhöhe mit Blick um die Ecke des historischen Fachwerkhauses "Kunst im Fachwerk" auf die Kirche. Die Kirche Kreuzerhöhung Scheiderhöhe... Rechtzeitig zum ersten Advent 2022 hat der Lions Club Lohmar den Adventskalender aufgelegt. Das Motiv zeigt Scheiderhöhe mit Blick um die Ecke des historischen Fachwerkhauses "Kunst im Fachwerk" auf die Kirche. Die Kirche Kreuzerhöhung Scheiderhöhe blickt in diesem Jahr auf 111 Jahre Entstehungsgeschichte zurück. Am Sonntag, den 9. Juli 1911 wurde der Grundstein für eine neue Kirche der Pfarrei gelegt. Ursprünglich sollte die alte Pfarrkapelle aus dem Jahre 1803 erweitert werden. Da deren Zustand zu schlecht war, beschloss der Kirchenvorstand 1906, den Neubau einer Kirche in Angriff zu nehmen. Letzendlich plante man eine Kirche für 440 (!) Seelen. Architekt Stumpf aus Bonn konnte 1908 die Baupläne fertigstellen, die die Kirche in der heutigen Form zeigen. Die Baukosten wurden mit 36.000 Mark kalkuliert. Es wurde teurer als geplant. Die Baukosten erhöhten sich auf 49.262,38 Mark. Die Finanzierung erfolgte über eine Hauskollekte. Eine große Herausforderung war der Transport der Steine, die aus einem Steinbruch bei Reelsiefen mittels Feldbahn und Pferdefuhrwerk den Berg hinauf nach Scheiderhöhe gekarrt werden mussten. Kurz vor Fertigstellung der Kirche stürzte im Februar 1912 der Glockenturm ein. Verletzt wurde Gott sei Dank niemand. Die Ursache konnte nicht eindeutig ermittelt werden. Mit vereinten Kräften gelang es das Bauwerk zu vollenden, so dass am 29. Januar 1913 die neue Kirche eingeweiht werden konnte. Eine ausführliche Beschreibung der Entstehungsgeschichte entnehmen Sie dem Dokument. | |
|
1989
- 2022 Mit vielen Ehrenamtlern aus der Naturschutzgruppe hatte der Heimat-und Geschichtsverein Lohmar - heute Heimatverein Lohmar - 1989 die 10 Morgen (2,5 ha) großen „Sauren Wiesen“ unterhalb von Lohmarhohn in schweißtreibender Handarbeit wieder... Mit vielen Ehrenamtlern aus der Naturschutzgruppe hatte der Heimat-und Geschichtsverein Lohmar - heute Heimatverein Lohmar - 1989 die 10 Morgen (2,5 ha) großen „Sauren Wiesen“ unterhalb von Lohmarhohn in schweißtreibender Handarbeit wieder vernässt. Eine Maßnahme, die ursprünglich dem Tier- und Pflanzenschutz diente. Rund 30 Jahre später erfährt sie durch die Trockenheit in Folge des Klimawandels eine neue zusätzliche Relevanz, wenn es darum geht, auch regionale Wasserkreisläufe zu stärken und das Klima zu kühlen. Der alte Entwässerungsgraben wurde damals verbreitert und mit den verzweigten Kleingräben zu einer offenen Wasserflächen angestaut. Schon nach kurzer Zeit kehrten Feuersalamander, Bergmolche, Wasserfrösche und zahlreiche Wasserkäfer und Liebellenarten ein. Die Pflege des Geländes wurde in alter bäuerlicher Tradition und Handarbeit durchgeführt und die Wiese mit der Sense gemäht und das Schnittgut auf Heuböcken gestapelt (siehe Dokument). Die „Sauren Wiesen“ gehören zum Hochwasserrückhaltebecken Auelsbach, das 1982 durch den Aggerverband errichtet wurde. Es hat ein Fassungsvermögen von ca. 57.000 Kubikmeter und soll vor einem 50 jährlichen Regenereignis schützen. Nachdem der Aggerverband laut Aggerverbandsgesetz seit 2004 nicht mehr die Aufgabe des Hochwasserschutzes hat, wurde das Eigentum der Stauanlage 2016 auf die Stadt Lohmar übertragen. Der (Rest-)Wert der Anlage wurde auf 118.132,00 € festgelegt. Nach dem Hochwasser im Juni 2013 beschloss die Stadt Lohmar das Stauvolumen des Rückhaltebecken auf ein 200 jährliches Regenereignis zu ertüchtigen. Es dauerte bis Mitte 2022 bis die Pläne im Stadthaus offengelegt wurden. Danach wird die Dammkrone um ca. 3 Meter erhöht und das Auffangvolumen auf 166.000 Kubikmeter erweitert. | |
Der Ziegenberg ist eine Erhebung von 124,3 Meter an der westlichen Stadtgrenze von Lohmar an der Agger gelegen. Er ist in der letzten Eiszeit als Sanddüne entstanden. Von Lohmar aus erreicht man ihn direkt rechts hinter der Aggerbrücke nach Altenrath... Der Ziegenberg ist eine Erhebung von 124,3 Meter an der westlichen Stadtgrenze von Lohmar an der Agger gelegen. Er ist in der letzten Eiszeit als Sanddüne entstanden. Von Lohmar aus erreicht man ihn direkt rechts hinter der Aggerbrücke nach Altenrath über einen schmalen Wanderpfad. Bei Ausgrabungen fand man hier Pfeilspitzen aus der Ahrensburger Kultur aus der Altsteinzeit. Die Menschen dieser Zeit vor etwa 12.500 Jahren waren hochspezialisierte Rentierjäger. Aus einem Schriftwechsel von 1930 des Lohmarer Bürgermeisters Ludwig Polstorff mit dem Regierungspräsidenten Köln geht hervor, dass auf dem Bergkegel ein Herr Klein privat eine Kriegergedächtnisstätte errichtet hatte. Es soll dort auch ein Aussichtsturm aus Rundhölzern von 6 – 8 Metern Höhe gestanden haben. Da in dieser Zeit die Bergkuppe noch frei von Baumbestand war hatte man bis in die 1930er Jahre einen weiten ungestörten Blick über Lohmar und das untere Aggertal. Siehe auch den Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter 2016, Dokument.
| |
Der Straßenname Eisenmarkt könnte darauf schließen lassen, dass es hier einmal einen merkantilen Eisenmarkt gegeben hat. Doch die Heimatforscher schließen das aus, zumal es auch kaum vorstellbar ist, dass es für 160 Einwohner, die Lohmar am Ende des... Der Straßenname Eisenmarkt könnte darauf schließen lassen, dass es hier einmal einen merkantilen Eisenmarkt gegeben hat. Doch die Heimatforscher schließen das aus, zumal es auch kaum vorstellbar ist, dass es für 160 Einwohner, die Lohmar am Ende des 18. Jahrhunderts hatte, einen solchen Markt gegeben hat. In den bisher bekannten schriftlichen und mündlichen Überlieferungen seit dem 16. Jahrhundert findet sich nicht ein einziges Mal der Begriff Markt am Ende mit „t“ geschrieben. Die Bezeichnungen waren u- a- „Isermarcken“ und „Ißermarck“. Erst in der sogenannten Urflurkarte von 1823 ist dann plötzlich „Eisen-Markts Garten“ zu lesen. Für die Heimatforscher ein offensichtlicher Fehler der Kartografen wegen ihrer Unkenntnis der etymologischen (sprachkundlichen) Herkunft des Wortes Mark. Sie machten daraus Markt = Handelsplatz. Mark oder Marck bedeutete im Mittelalter Land, Flur, Grenzmarkierung. Für den Begriff Iser könnte nach dem Lohmarer Heimatforscher Wilhelm Pape ein historischer Bezug auf Eisen gegeben sein. 1565 gab es für den Isermarck zu Lohmar den Dienstreiter Wymar van der Soltz, der seinem Dienstherrn mit Pferd und Harnisch (eiserner Helm und Brustpanzer) dienen musste. Daraus könnte man schließen, dass sein Hof und seine Ländereien „die Mark derer in der Eisenrüstung“ kurz: „Eyser Mark“ hießen. Dienstreiter waren Privilegierte der weltlichen Herrscher, deren Besitztümer von Abgaben befreit waren. Die Güter und Höfe hießen deshalb auch „Freie Güter“ und „Sattelgüter der Dienstreiter“. Im Landmaßbuch von Lohmar von 1746 sind u. a, Eysermarks Erben aufgeführt. Das Sattelgut am Isermarcken selbst ist nicht mehr aufgeführt. Warum das ehemalige Gut des Wymar van der Soltz seine Bedeutung unter den Lohmarer Höfen verlor, ist nicht bekundet. Gründe dafür könnten Erbteilungen gewesen sein. Sattelgüter behielten nur solange ihre Funktion, wie Hof und Ländereien eine bestimmte Größe hatten. Das Haus Eisenmarkt 20 und das nebenstehende Haus Nr. 22 sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die größeren Überbleibsel des ehemaligen Sattelgutes aus dem Spätmittelalter. Das Teilstück Eisenmarkt zwischen Bachstraße und Hauptstraße wird volkstümlich auch Saujässje /Saugässchen genannt. Der Name soll aus der früheren Schweintrift zur Eichelmast im Lohmarer Erbenwald stammen. Urkundlich kann dieser Name nicht nachgewiesen werden. Um 1750 wird dieser Pfad im Landmaßbuch als "Kirchpetgen" entlang der Guttenhoffs Scheueren (Scheune) bezeichnet. In einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter 1998 setzt sich Johannes Heinrich Kliesen (1924 – 2017) mit dem Rätselraten um den Eisenmarkt und um vergessene Höfe auseinander, siehe Dokument.
| |
50 Jahre lang war Lohmar von besonderer Bedeutung für die Kölner Familie Rohloff. Etwa um 1910/15 kaufte Albert Rohloff, der in Köln mit seiner Frau Margarete eine private Handelsschule gegründet hatte, ein großes Grundstück am südlichen Ende der... 50 Jahre lang war Lohmar von besonderer Bedeutung für die Kölner Familie Rohloff. Etwa um 1910/15 kaufte Albert Rohloff, der in Köln mit seiner Frau Margarete eine private Handelsschule gegründet hatte, ein großes Grundstück am südlichen Ende der Hauptstraße als Wochenend- und Altersruhesitz. Am nördlichen rechten Rand des Grünstücks baute er ein Haus im Stil der Gründerzeit, das heute noch steht (Hauptstr. 126). Er nannte es „Alberts Rast“ und ließ den Namen in großen Lettern über den Eingang schreiben. Die Familie reiste am Wochenende mit der Bahn an, und da die Bahntrasse des „Luhmer Grietche“ direkt hinter dem Grundstück verlief, warfen sie in Höhe ihres Grundstücks das Gepäck aus dem Zug, damit sie es nicht vom Bahnhof den langen Weg zurücktragen mussten. Nach Alberts Tod im Jahr 1924 wurde das Grundstück unter seine beiden Söhne Albert und Walter und seiner Tochter Hilde aufgeteilt. Hilde erhielt den von der Straße aus gesehen rechten Teil des Grundstücks mit dem Haus, dass sie 1937 an eine Familie Hoeck verkaufte. Die beiden Söhne errichteten auf den bislang unbebauten Grundstücken Wochenendhäuser. Das Haus von Walter im mittleren Teil des Grundstücks (Hauptstr. 128) wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wegen der herrschenden Wohnungsnot zwangsverwaltet. Das Ferienhaus auf dem linken Grundstücksteil (Hauptstr. 130) von Albert Rohloff wurde 1944, als das Haus in Köln im Krieg zerstört wurde, zur Dauerwohnstätte der Familie. Da das ursprüngliche Wochendhäuschen viel zu klein war, wurde es in den 1950er Jahren ausgebaut. Das Grundstück war parkartig angelegt, das Haus stand an der hinteren Grundstücksgrenze. Für die fünf Enkel war es ein Kinderparadies. 1960 übernahmen Sohn Gerd Rohloff und seine Frau Christel mit ihren drei Kindern Cornelia, Barbara und Albert das Haus. Als 1961 die alte gepflasterte mit Linden gesäumte Hauptstraße verbreitert wurde, verlor das Grundstück nach und nach seinen Charme für die Familie Rohloff. Die Autobahn wurde immer lauter und die Firma Walterscheid expandierte und rückte näher. Schließlich wurde 1966/67 das Grundstück an die Eheleute Doris und Dieter Zibell verkauft. Sie bauten 1968 vor das Wohnhaus eine BP-Tankstelle mit anschließender Werkstatt. 1986 wurde Herr Büchling neuer Eigentümer, ließ Haus und Tankstelle abreißen und errichtete einen neuen Tankstellenkomplex. Cornelia Lewerenz (geb. Rohloff) hat ihre Kindheitserinnerungen für die Lohmarer Heimatblätter 2018 festgehalten und Gerd Streichardt berichtet über ein Wochendhaus an der Hauptstraße, siehe Dokument.
| |
|
1938
- 1945 Scheiderhöhe war bis zur kommunalen Neuordnung 1969 eine selbstständige Gemeinde und Mittelpunkt der umliegenden Ortschaften. Neben der Kirche gab es eine Volksschule mit zwei Klassenräumen und acht Klassen. Zwei Lebensmittelläden von Heinrich Bonn... Scheiderhöhe war bis zur kommunalen Neuordnung 1969 eine selbstständige Gemeinde und Mittelpunkt der umliegenden Ortschaften. Neben der Kirche gab es eine Volksschule mit zwei Klassenräumen und acht Klassen. Zwei Lebensmittelläden von Heinrich Bonn und Heinrich Faßbender boten alle Artikel des täglichen Gebrauchs an. Die Festlichkeiten wurden in zwei Gasthöfen gefeiert, im nördlich gelegenen Gasthof Höderath und der im südlichen Teil gelegenen Gastwirtschaft von Hugo Weeg (heute Royal-Albert-Hall). Der Gründer der Firma ABS Albert Blum, Jahrgang 1930 hat einige persönliche Erinnerungen über Begebenheiten in Scheiderhöhe, inbesondere in den Kriegszeiten festgehalten (siehe Dokument). Unter anderem beschreibt er in einer Anekdote die Zuverlässigkeit des eingesetzten „Volkssturms“ bei der Bedienung der Geräte in der Kommandozentrale Scheiderhöhe für die im weiten Umkreis gelegenen Scheinwerferbatterien, sowie die Angriffe der Jagdbomber auf Wielpütz und Muchensiefen.
| |
Das Dorf Lohmar (Honschaft, Nachbarschaft) hatte um 1770 rund 160 Einwohner, die in etwa 50 Häusern wohnten. Aus dem Wertier- und Landmaßbuch von 1746 sind die Bestitzverhältnisse zu entnehmen. Zu dieser Zeit bestehen in Lohmar an Höfen das... Das Dorf Lohmar (Honschaft, Nachbarschaft) hatte um 1770 rund 160 Einwohner, die in etwa 50 Häusern wohnten. Aus dem Wertier- und Landmaßbuch von 1746 sind die Bestitzverhältnisse zu entnehmen. Zu dieser Zeit bestehen in Lohmar an Höfen das Pastoratsgut (Widdenhof), der Backeshof, der Frohnhof, der Pützerhof, der Bachhof, der Burghof, das Korfer Gut, der Vogtshof, Steinhof, Wolfshof, Nietterhof, Rengrathsgut. Die vielen Einzelhöfe erweckten den Eindruck, als ob sich ein Höfeverband zu einem Dorf zusammengeschart hätte. Zwischen den Höfen entstanden im Laufe der Zeit die vielen Kleinsiedlungen, so dass die ursprünglich getrennten Ortsteile Burg, Kirchdorf, Ober- und Unterdorf zusammenwuchsen. Die Angelegenheiten des dörflichen Gemeinschaftslebens regelte das Lohmarer Nachbarbuch. Es war am 10. November 1767 neu angelegt und von 23 Einwohnern unterschrieben worden, nachdem das alte Nachbarbuch von 1581/1644 verschlissen und unleserlich geworden war. Bereits die Präambel des Lohmarer Nachbarrechts geht unmissverständlich auf die enge Bindung der Dorfgemeinde mit dem Erbenwald ein. Übersetzt in die heutige Sprache heißt es: "Gleichwie bekannt ist, dass das Dorf Lohmar berechtigt ist, im Lohmarer Wald Stock und Sprock (dürres Holz) zu sammeln, das Vieh im Weid- und Schweidgang (Schweidgang meint eine allgemein und gemeinsam genutzte Fläche zum Weiden des Viehs) zu hüten, wie auch zur Eckerzeit den Auftrieb der Schweine nach Ordnung des Waldbuches vorzunehmen, sowie gemeinschaftlich das nötige Gras als Viehfutter zu krauten, so wird jetzt festgestellt, dass durch die Vermehrung der Haushaltungen im Dorf und durch Unangesessene aus anderen Orten Tag und Nacht Leute in den Wald schleichen und dadurch die Dieberei mehr und mehr zunimmt." Das Nachbarbuch enthält insgesamt 40 Punkte oder Paragraphen. Die meisten sind mit Strafen (Geldbußen) bewehrt). Im Punkt 33 heißt es zum Beispiel: Beim Verlassen des Dorfes oder der Rückkehr soll ein jeder Nachbar die Dorftore verriegeln. Falls Tore offenstehen, sind die Nachbarn zum Verschließen verpflichtet, bei einer Strafe von 12 Albus (1 Reichstaler = 78 Albus). In dem Dokument ist das Nachbarbuch ausführlich beschrieben. | |
|
2003
Die Diskussionen um den Ausbau der Windkraft an Land haben in der ersten Jahreshälfte 2022 wieder Fahrt aufgenommen. Bis 2026 sollen nach dem Willen der Bundesregierung 1,4 % und bis 2032 dann 2 % der Bundesfläche für Windräder zur Verfügung gestellt... Die Diskussionen um den Ausbau der Windkraft an Land haben in der ersten Jahreshälfte 2022 wieder Fahrt aufgenommen. Bis 2026 sollen nach dem Willen der Bundesregierung 1,4 % und bis 2032 dann 2 % der Bundesfläche für Windräder zur Verfügung gestellt werden. Nach den Koalitionsverhandlungen in NRW wollen CDU und Grüne bis 2027 1000 zusätzliche Windkraftanlagen errichten. Konflikte mit Bürgerinnen und Bürgern und beim Artenschutz sind vorprogrammiert. Vor gut 20 Jahren hatte die Stadt Lohmar wegen dieser Konflikte im Flächennutzungsplan eine Vorrangfläche für Windräder ca. 600 m westlich des Algerter Ortsrandes zwischen Algert und Kröhlenbroich ausgewiesen, um zu verhindern, dass im Stadtgebiet Windräder errichtet werden können. Man ging davon aus, dass auch auf der Vorrangfläche bei dem dort herrschenden schwachen Durchschnittswind Windkraftanlagen nicht wirtschaftlich zu betreiben sind. Umso überraschter war man, als 2003 die Firma Hakon aus Essen den Bau von 2 Windrädern mit einer Nennleistung von je 1800 kW beantragte. Die Firma hatte sich die Flächen von dem damaligen Eigentümer von Gut Freiheit/Inger über einen Pachtvertrag schon gesichert. Letztlich wurde das Projekt nicht weiterverfolgt. Man darf gespannt sein, wann der Bau von Windrädern wieder ein Lohmarer Thema wird.
| |
|
1940
Am 4. November 1940 gab es einen gewaltigen Knall und die einst stolze Sottenbacher Brücke stürzte ein (siehe Dokument). Das Hochwasser hatte einen Brückenpfeiler unterspült und die Brücke zum Einsturz gebracht. Teile fielen in die Agger und wirkten... Am 4. November 1940 gab es einen gewaltigen Knall und die einst stolze Sottenbacher Brücke stürzte ein (siehe Dokument). Das Hochwasser hatte einen Brückenpfeiler unterspült und die Brücke zum Einsturz gebracht. Teile fielen in die Agger und wirkten wie ein Staudamm. Hart betroffen von den Überflutungen waren der Kreuzerhof und das Haus der Familie Klein. Opa Karl Klein konnte von der Feuerwehr nur in einer Zinkwanne gerettet werden. Da es keinen Fährbetrieb mehr gab, bauten die Männer einen Notsteg. Später bauten Soldaten einen stabileren Fußgängersteg. Die Planungen, 1945 die Sottenbacher Brücke wieder aufzubauen, wurden wegen der hohen Kosten nicht ausgeführt. Stattdessen baute man einen provisorischen Steg in Pontonbauweise an der Stelle am Kreuzerhof, wo auch 1940 ein solcher erbaut war. Dieser Steg wurde bei Hochwasser an einer Seite losgemacht, auf der anderen Seite der Agger trieb er dann mit der Strömung, so wurde verhindert, dass er vom Hochwasser weggerissen wurde. Später kam hier eine hochwassersichere auf hohen Stelzen stehende Holzbrücke, die man in weiser Vorsehung mit Rammböcken schützte. Die Sottenbacher Brücke war 1870 auf Betreiben des Lohmarer Bürgermeisters Wilhelm Peter Orth genehmigt und von dem Lohmarer Bauunternehmer und Besitzer des Jabachgutes Friederich Wilhelm Sapp als fünfbogige Steinbrücke errichtet worden. Mitte des 19 Jahrhunderts wurde die Agger zwischen Sottenbach und Donrath noch mittels Furt und Fähre überquert. Der Mann, der zum Zeitpunkt des Brückenbaus die Fähre bediente, kannte man weit und breit unter dem Namen „et Fahrwellemsche“, mit Bürgernamen hieß er Wilhelm Klein.
| |
|
2006
Ein recht bedeutender Bergbau in Lohmar fand in der Grube Moritz am Holzbach (Tannenbach) unterhalb von Lohmarhohn statt. Direkt am Wegesrand nach Heide liegt noch eine große Halde aus sogenanntem tauben Gestein, dass für den Bergmann keinen Nutzen... Ein recht bedeutender Bergbau in Lohmar fand in der Grube Moritz am Holzbach (Tannenbach) unterhalb von Lohmarhohn statt. Direkt am Wegesrand nach Heide liegt noch eine große Halde aus sogenanntem tauben Gestein, dass für den Bergmann keinen Nutzen hatte und direkt am Stollen oder Schacht abgelegt wurde. Der Holzbach, der westlich von Heide entspringt, versickert etwas unterhalb der Halde in einem ehemaligen Schacht, der verfüllt ist, und tritt nach ca 100 m am Ende des Wasserabzugsstollens, einige Meter tiefer wieder zutage und mündet in den Auelsbach. Zu der Anlage gehörte auch ein Zechenhaus, das der damalige Bürgermeister Orth 1857 genehmigte und auch noch nach der Jahrhundertwende dort stand. Der Abbau von Kupfer, Blei- und Zinkerzen erfolgte in den Jahren 1842 - 1872. Den Verkaufswert der Blei- und Zinkerze dokumentieren Zahlen aus dem Jahr 1871: 15 t Stückblende - Summe 305,00 Tlr; 10 t Graupenblende - Summe 168,10 Tlr.; 5 t Bleierz - Summe 256,20 Tlr. Eine ausführliche Darstellung ist in dem Dokument nachzulesen. | |
|
1945
- 1948 Am 10. April 1945 wurde nach wochenlangem Artilleriebeschuss und Bombenangriffen die Kreisstadt Siegburg nach heftigen Straßenkämpfen von den amerikanischen Streitkräften eingenommen und am gleichen Tag auch Lohmar militärisch besetzt. Die... Am 10. April 1945 wurde nach wochenlangem Artilleriebeschuss und Bombenangriffen die Kreisstadt Siegburg nach heftigen Straßenkämpfen von den amerikanischen Streitkräften eingenommen und am gleichen Tag auch Lohmar militärisch besetzt. Die Bevölkerung litt Not. Die Kommunalverwaltungen waren zusammengebrochen. Riesengroß waren die Schwierigkeiten auf allen Gebieten des täglichen Lebens. Die amerikanische Führung erkannte, dass schnellsten eine provisorische Verwaltung eingerichtet werden musste. In Lohmar wurde als politisch unbelasteter Fachmann Josef Lagier aus Heppenberg mit der Wahrnehmung der Geschäfte als Amtsbürgermeister betraut. In Personalunion sollte er gleichzeitig die Gemeinde Wahlscheid mitverwalten. Nach zwei Monaten wurde er von Richard Schmidt abgelöst. Es wurde den Amts- und Gemeindeverwaltungen erlaubt, Beratende Ausschüsse mit höchstens zehn Personen einzurichten. Die erste Sitzung des Ausschusses fand am 12. Oktober 1945 statt. Um die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger an den örtlichen Verwaltungen über die Beratenden Ausschüsse hinaus zu erweitern, erließ die britische Militärregierung im November 1945 Richtlinien für die kommunale Selbstverwaltung. Statt der beratenden Ausschüsse sollten jetzt Gemeindevertretungen vorgeschlagen und von der Militärregierung eingesetzt werden. Der Gemeindevertretung gehörte neben dem Bürgermeister zwölf Mitglieder an. Zum Amtsbürgermeister wurde am 29. April 1946 Ferdinand Hein (zugleich Gemeindebürgermeister von Scheiderhöhe) gewählt. Der bisherige Bürgermeister Richard Schmidt wurde im Juni 1946 zum Amtsdirektor gewählt. Die Aufgaben von Verwaltung und politischem Bürgermeister waren zuvor getrennt worden. Die Verwaltung sollte von einem hauptamtlichen Gemeinde- bzw. Amtsdirektor geleitet werden - dieses System der kommunalen Doppelspitze wurde 1999 abgeschafft und die Direktwahl eines hauptamtlichen Bürgermeisters durch die Bürgerschaft eingeführt -. Zwei Jahre nach der ersten freien Kommunalwahl 1946 wurde 1948 wieder gewählt. Die großen Gewinner der Wahl waren die CDU und das Zentrum. Unter den berufenen Politikern befand sich keine Frau. Die Nachkriegspolitik war reine Männersache. In einem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter 2008, beschreibt Hans Warning Umstände, politische Parteien und Personen, die den materiellen und geistigen Aufbau des Heimatortes zwischen 1945 und 1948 einleiteten, siehe Dokument.
| |
|
1998
Die denkmalgeschützte Honsbacher Mühle ist eine ehmalige Wassermühle und liegt im Norden des Stadtgebietes im Weiler Honsbach. Das jetztige Hauptgebäude wurde um 1808 errichtet. Erstmals urkundlich erwähnt wird die Honsbacher Mühle 1625 als Besitz... Die denkmalgeschützte Honsbacher Mühle ist eine ehmalige Wassermühle und liegt im Norden des Stadtgebietes im Weiler Honsbach. Das jetztige Hauptgebäude wurde um 1808 errichtet. Erstmals urkundlich erwähnt wird die Honsbacher Mühle 1625 als Besitz des Baacher Hofes (Cortenbachshof). Vor 1945 wurde der Mühlenbetrieb eingestellt. In den 1980er und 1990er Jahren wurde das Mühlenanwesen als Gasthaus genutzt. Heute dient es als Wohnhaus. Nach dem Erwerb des ca 3500 qm großen Arreals durch die Eheleute Gabriele und Robert Reschke im Jahr 1994 wurden die Gebäude aufwendig renoviert, siehe Dokument. | |
|
1939
- 1945 Bilder von Zerstörungen zeigen in den ersten Monaten des Jahres 2022 das schreckliche Ausmaß des russischen Bombardements aus der Luft im Ukrainekrieg. Die Kriegskinder des Zweiten Weltkrieges können aus eigenem Erleben die Ängste und das Leid der... Bilder von Zerstörungen zeigen in den ersten Monaten des Jahres 2022 das schreckliche Ausmaß des russischen Bombardements aus der Luft im Ukrainekrieg. Die Kriegskinder des Zweiten Weltkrieges können aus eigenem Erleben die Ängste und das Leid der ukrainischen Bevölkerung nachvollziehen. Der Bombenkrieg wurde von alliierter Seite bereits Ende März 1942 auf deutsche Städte und Wohngebiete ausgeweitet. Hierüber gibt es für das ehemalige Amt Lohmar mit den Gemeinden Lohmar, Scheiderhöhe, Halberg, Inger und Birk feingliedrige Aufzeichnungen über Fliegeralarme, Abwürfe von Spreng- und Brandbomben sowie entstandene Personen- und Sachschäden. Von Juli 1940 bis Februar 1945 wurden 985 Brandbomben, 269 Sprengbomben und 44 Blindgänger abgeworfen. Es wurden 21 Verletzte und 8 Tote verzeichnet. Die schlimmsten Folgen im Amtsbezirk hatte am 17. Dezember 1944 der Abwurf von 2 Sprengbomben in Wiehlpütz bei Scheiderhöhe. Es starben 7 Menschen, 15 wurden teils schwer verletzt. Ein besonderes Schreckensereignis in Lohmar war der Absturz einer unbemannten fehlgeleiteten Flugbombe V1 ((Vergeltungswaffe 1) am 15. Februar 1945 in der Straße Am Bungert. Es war eine von deutscher Seite eingesetzte neu entwickelte Waffe, vergleichbar mit einer Boden-Boden-Rakete. Gott sei Dank gab es keine Toten zu beklagen. In unserer Region sind noch 14 Abschussrampen erkennbar, davon 3 bei Lohmar. Über Marschflugkörper am Schlangensiefen berichtet Christoph Kämper in den Lohmarer Heimatblättern 2011 und über den Luftkrieg 1939 – 1945 und seine Auswirkungen in Lohmar schreibt Karlheinz Urbach in einem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter 2004, siehe Dokument.
| |
|
2000
Am 11. Mai 1942 wurden kriegsbedingt die Marienglocke und die Josefsglocke der Kirche Sankt Mariä Geburt abtransportiert. Sie landeten auf dem sogenannten Glockenfriedhof in Hamburg-Wilhelmshof. Über 100.000 Glocken wurden im Zweiten Weltkrieg... Am 11. Mai 1942 wurden kriegsbedingt die Marienglocke und die Josefsglocke der Kirche Sankt Mariä Geburt abtransportiert. Sie landeten auf dem sogenannten Glockenfriedhof in Hamburg-Wilhelmshof. Über 100.000 Glocken wurden im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen, um daraus Kriegsgerät herzustellen. So auch die Josefsglocke. Die Marienglocke kehrte im September 1947 wieder nach Birk zurück und läutete am Sonntag, den 11. Januar 1948 wieder ein. Bereits im Ersten Weltkrieg waren zwei Glocken der drei 1888 eingeweihten Kirchenglocken beschlagnahmt worden. In Birk ging damals hinter vorgehaltener Hand der Satz um: "Wenn se och noch de Jlocke holle, dann es de Kreech verlore". Kirchenglocken sind aus dem christlichen Leben nicht hinwegzudenken. Darüberhinaus haben sie auch eine weltliche Bedeutung wie das Neujahrsläuten oder in manchen Orten der Uhrschlag. Auch läuteten Glocken in den ersten Monaten des Jahres 2022 für den Frieden im Ukrainekrieg. Früher spielten sie auch eine wichtige Rolle als Alarmglocken bei Gefahren. Die Erweiterung des Glockengeläuts in Birk durch die neuen Glocken der evangelischen Friedenkirche zu Beginn des 21. Jahrhunderts war Anlass genug für Heinrich Hennekeuser, die Geschichte aller Glocken im Birker Bereich und ihr Schicksal zu dokumentieren, siehe Dokument. Sein Beitrag endet mit den Schlussversen aus Schillers Lied von der Glocke: Sie bewegt sich, schwebt! / Freude dieser Stadt bedeute, / Friede sei ihr erst Geläute! | |
|
1919
- 1926 Nach dem Ende der Kampfhandlungen des 1. Weltkrieges durch das Waffenstillstandsabkommen von Compiegne am 11. November 1918 und noch während der Gespräche über den Versailler Friedensvertrag marschierten erste britische Besatzungstruppen am 12.... Nach dem Ende der Kampfhandlungen des 1. Weltkrieges durch das Waffenstillstandsabkommen von Compiegne am 11. November 1918 und noch während der Gespräche über den Versailler Friedensvertrag marschierten erste britische Besatzungstruppen am 12. Dezember 1918 in Lohmar ein. Einen Tag später folgten Kanadier, die als Mitglieder des Commonwealth an der Seite der Briten gekämpft hatten. Anfang 1920 wurden sie von den Franzosen abgelöst, da durch den im Juni 1919 unterzeichneten Versailler Friedensvertrag Frankreich als Besatzungsmacht die Besetzung des Kölner Raumes (Brückenkopf Köln) übertragen wurde. Sieben Jahre bis 1926 blieb Lohmar besetzt. Eine der ersten Amtshandlungen des britischen Kommandeurs war, statt der bestehenden mitteleuropäischen Zeit die in Großbritannien geltende westeuropäische Zeit einzuführen: Am Freitag, den 13. Dezember 1918 waren alle Uhren um eine Stunde zurückzustellen. Für die Zivilbevölkerung gab es eine Fülle von Einschränkungen durch die Besatzer, wie nächtliche Ausgangssperre, Briefzensur, Verkehrsverbot ins unbesetzte Reichsgebiet, Versammlungsverbot etc. Für die Durchführung und Überwachung wurden die Kommunalbehörden beauftragt. Dazu wurde eigens ein Besatzungsamt eingerichtet. Die Lohmarer Bevölkerung empfand die Besatzungszeit, in der es ihr ohnehin durch die Inflation sehr schlecht ging, als Schmach. Zwischen den einfachen Soldaten in den Privatquartieren und der Zivilbevölkerung entwickelte sich ein entspanntes und manchmal freundschaftliches Verhältnis. Im Frühjahr 1919 begann der Bau eines Barackenlagers im Wald am Ziegelfeld für ca. 1.000 Soldaten. Die Kosten beliefen sich auf 2 Millionen Mark. Der Wirt des Schützenhauses in Siegburg, August Piotter, errichtete in einer Baracke seine „Waldschenke“, die auch zur Zeit der Briten von Bürgern besucht wurde. In der Nähe des Waldlagers in den Widdauer Wiesen wurde eine Sportanlage mit einer 500 m Umlaufbahn errichtet, die auch die Sportler des Siegburger Turnvereins nutzten. In einem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter 1999 berichtet der am 14. Februar 2022 verstorbene Heimatkundler und langjährige Lohmarer Realschullehrer Hans Warning ausführlich über die Besatzungszeit, siehe Dokument.
| |
Die Separatistenbewegung in der Ostukraine, die 2014 zwei international nicht anerkannte Republiken ausrief und am 21.02.2022 wenige Tage vor dem Großangriff von Russland anerkannt wurden, lässt einige Assoziationen aufkommen zu den Separatisten im... Die Separatistenbewegung in der Ostukraine, die 2014 zwei international nicht anerkannte Republiken ausrief und am 21.02.2022 wenige Tage vor dem Großangriff von Russland anerkannt wurden, lässt einige Assoziationen aufkommen zu den Separatisten im Rheinland – auch in Lohmar –, die vor hundert Jahren die „Rheinische Republik“ proklamierten. Die 1920er Jahre werden zwar die „Goldenen Zwanziger“ genannt. Der wirtschaftliche Aufschwung und die politische Stabilität begannen allerdings erst Mitte der 1920er. Zuvor war es eine Zeit der Krisen nach dem 1. Weltkrieg besonders in den besetzten Gebieten im Rheinland. Nachdem am 6. Dezember 1918 die letzten deutschen Truppen auf ihrem Rückmarsch von der Westfront den Lohmarer Wald passiert hatten, nahmen bereits eine Woche später englische und kanadische Truppen Quartier in Lohmar. Am 3. Februar 1919 zieht ein englischer Brigadestab für ein paar Tage in die Villa Maruschka (Park Lohmarhöhe) ein. Auf dem Ziegelfeld wird für 2 Millionen Mark ein Waldlager für die Besatzer eingerichtet. Anfang 1920 folgen französische und später marokkanische Besatzungstruppen. Die Beziehungen der Lohmarer Bevölkerung zu den Franzosen und Marokkanern sind schlecht. Die Besetzung des Ruhrgebietes 1923 durch die Franzosen und Belgier hatte verheerende ökonomische Folgen. In Berlin wurden Pläne diskutiert, das Rheinland „versacken“ zu lassen und den Besatzungsmächten die Verantwortung zu übertragen. Dies löste 1923 Putschversuche von Separatisten aus mit dem Ziel, eine Rheinische Republik zu gründen. Die Putschisten, die vorübergehend zahlreiche Rathäuser und Regierungsgebäude besetzt hatten, scheiterten letztlich am Widerstand der Bevölkerung. Der national gesonnenen Bevölkerung erschien die Idee der Separatisten, eine Aussöhnung mit dem Erzfeind Frankreich herbeizuführen als Hochverrat. In Lohmar kam es am 23. Oktober 1923 im Bertelsbeck`schen Haus (Pützerhof, Kirchstraße 37) zu einer bewaffneten Auseinandersetzung. Etwa 30 Separatisten hatten sich hier verschanzt. Sie wurden von allen Seiten von jungen Männern, die sich mit Knüppeln, Sensen und Dreschflegeln bewaffnet hatten, angegriffen. Die Separatisten eröffneten das Feuer und verletzten vier Personen zum Teil schwer. Sie flüchteten anschließend in das Franzosenlager am Ziegelfeld. Der Separatismus in unserem Raum endete mit der Schlacht bei Aegidienberg am 15./16. November 1923.
| |
|
1945
- 2022 Der Krieg in der Ukraine im Jahr 2022 ruft bei vielen älteren Menschen, den sogenannten „Kriegskindern“, schreckliche Erinnerungen wach an die Zeiten des 2. Weltkrieges. Bilder von Bombenangriffen, Flucht, Vertreibung kommen wieder hoch, Schicksale... Der Krieg in der Ukraine im Jahr 2022 ruft bei vielen älteren Menschen, den sogenannten „Kriegskindern“, schreckliche Erinnerungen wach an die Zeiten des 2. Weltkrieges. Bilder von Bombenangriffen, Flucht, Vertreibung kommen wieder hoch, Schicksale vergleichbar mit dem, was Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine jetzt erleben. Über ein solches Schicksal wird in dem Beitrag (Dokument) „Giesela Houck, geborene Conrad: Die Flucht aus meiner Heimat“ berichtet. Gisela Houck wurde 1935 in Reichenbach (Schlesien) geboren. Der Ort liegt wenige Kilometer von der Lausitzer Grenze entfernt in Polen, mittig zwischen Cottbus und Breslau. 1945 flüchtete ihre Familie vor den heranrückenden russischen Soldaten ins Sudetenland. Dort wurden sie nach kurzer Zeit von den Tschechen vertrieben und fanden schließlich über ihren alten Heimatort Reichenbach den Fluchtweg in das Auffanglager in Wipperfürth und schließlich in die neue Heimat nach Lohmar.
| |
In der Nacht zum 25. Februar 2022 verstarb im Alter von 87 Jahren Heinrich Hennekeuser. In der Nacht zum 25. Februar 2022 verstarb im Alter von 87 Jahren Heinrich Hennekeuser. In Birk 1935 geboren und dort aufgewachsen hat er Zeit seines Lebens den Kontakt zu seiner ursprünglichen Heimat und Region gehalten, auch nachdem er 1999 mit seiner zweiten Ehefrau Christel nach Solingen gezogen war. Schon als Schüler des Gymnasiums Siegburg interessierte er sich für die Heimatgeschichte. Im Laufe der Jahre verfasste er zahlreiche historische Schriften. Sie brachten ihm einen hohen Bekanntheitsgrad ein. Allein für die Lohmarer Heimatblätter schrieb er 30 Beiträge.
| |
Die alte Fachwerkhofanlage in Hammerschbüchel steht unter Denkmalschutz. 1939 kauften Peter und Rosa Schmitz den Hof von den Geschwistern Gippert. Die Familie Schmitz stammte aus dem Heckenbacher Ländchen im Kreis Ahrweiler. Sie mussten ihren... Die alte Fachwerkhofanlage in Hammerschbüchel steht unter Denkmalschutz. 1939 kauften Peter und Rosa Schmitz den Hof von den Geschwistern Gippert. Die Familie Schmitz stammte aus dem Heckenbacher Ländchen im Kreis Ahrweiler. Sie mussten ihren heimatlichen Hof in Oberheckenbach aufgeben, als das Hitlerregime 12 Dörfer mit 2440 Einwohnern in der Eifel für einen Luftwaffenübungsplatz räumen ließ. In Hammerschbüchel fanden sie als selbstständige Landwirte ein neues Zuhause. In den 1950er und 1960er Jahren baute die Familie Schmitz einen neuen Hof. Der älteste Sohn Rudolf übernahm 1970 die Landwirtschaft. 2001 musste er aus gesundheitlichen Gründen die Landwirtschaft aufgeben.
| |
Am 14. Febr. 2022 verstarb Hans Warning kurz vor seinem 90. Geburtstag. Er wurde am 18. April 1932 in Kiel geboren. Als einer der Realschullehrer der „ersten Stunde“ unterrichtete er 16 Jahre (1978 – 1994) an der Realschule Lohmar. Nebenberuflich... Am 14. Febr. 2022 verstarb Hans Warning kurz vor seinem 90. Geburtstag. Er wurde am 18. April 1932 in Kiel geboren. Als einer der Realschullehrer der „ersten Stunde“ unterrichtete er 16 Jahre (1978 – 1994) an der Realschule Lohmar. Nebenberuflich hatte er als junger Lehrer für die „Siegburger Zeitung“ geschrieben. In den späteren Jahren verfasste er zahlreiche Beiträge für das Jahrbuch und die Heimatblätter des Kreises und für die 65er Nachrichten in Siegburg. Im HGV Lohmar war Hans Warning bis 2012 Fachbereichsleiter für die Heimatgeschichte. Fast 20 Beiträge hat er im Laufe der Jahre für die „Lohmarer Heimatblätter“ geschrieben. Er engagierte sich auch stark für den Breitensport. 2008 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande für seine Verdienste um den Sport und die Heimatforschung verliehen. Zum 20- und 30jährigen Jubiläum der Lohmarer Realschule schrieb Hans Warning zwei Beiträge für die Lohmarer Heimatblätter, siehe Dokument. Er hat das Werden „seiner“ Schule hautnah miterlebt und die Entwicklung auch nach seiner Pensionierung weiterverfolgt. Er erinnert an die Anfänge der Schule, als die Realschulen Rösrath, Siegburg und Overath die Lohmarer Schülerinnen und Schüler nicht mehr aufnehmen konnten und das Kultusministerium aufgrund dieser Notlage am 6. Okt.1977 der Errichtung einer zweizügigen Realschule im Donrather Dreieck zustimmte und am 30. November 1979 die neue Schule eingeweiht werden konnte. Zum Schluss hält er fest, dass fast alle Absolventen gern an ihre Schulzeit in der Lohmarer Realschule zurückdenken
| |
|
1996
- 2022 Über den schadhaften Zustand des denkmalgeschützten Fachwerkgebäudes, Eisenmarkt 4 (Saugässchen) wurde in der Ausgabe des Lohmarer Stadtanzeiger von Januar 2021 berichtet. Es handelt sich um das Wohnhaus des ehemaligen Guttenhofes. Inzwischen (Febr.... Über den schadhaften Zustand des denkmalgeschützten Fachwerkgebäudes, Eisenmarkt 4 (Saugässchen) wurde in der Ausgabe des Lohmarer Stadtanzeiger von Januar 2021 berichtet. Es handelt sich um das Wohnhaus des ehemaligen Guttenhofes. Inzwischen (Febr. 2022) ist das Gebäude mit einem Bauzaun und Holzträgern abgesichert worden. Der Anblick lässt Zweifel aufkommen, ob das Baudenkmal erhalten bleibt. Die Geschichte des Guttenhofs geht auf das Jahr 1653 zurück, als er zum ersten Mal in einem Steuerregister über den „Lampenzehnden“ genannt wird. Im Landmaßbuch der Honschaft Lohmar von 1746 war der Guttenhof mit 3556 Ruten (1 Rute = 21,8 qm) als der 5. Größte von 54 Anwesen eingetragen. Über Personen und Familien, die im Zusammenhang mit dem Guttenhof bis 1996 genannt werden, berichtet Heinz Müller in einem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter, siehe Dokument. Auch der von 1813 - 1826 amtierende Bürgermeister Balthasar Schwaben hatte hier seinen Dienst- und Wohnsitz. 1996 war Karl Heinz Müller, Sohn des Heinrich Müller von der Lohmarer Jabach Eigentümer. Nicht nur der Bestand des „Guttenhof“, sondern auch der Gebäude auf den Nachbargrundstücken ist infrage gestellt. Sie grenzen unmittelbar an den Park Villa Friedlinde an und die Villa Therese mit Park ist nur wenige Meter entfernt. Zusammen mit dem Eisenmarkt/Saugässchen ist das gesamte Arreal nicht nur historisch bedeutsam, es bietet eine große Chance, die Ortsmitte Lohmars attraktiv weiterzuentwickeln.
| |
|
1884
- 1933 Zunächst war das Reisen den privilegierten bürgerlichen Kreisen vorbehalten. Seit den 1860er-Jahren wurde es auch für andere Schichten populärer und wurde zu einer Art Volksbewegung. Zu erhöhter Mobilität trug insbesondere die Eisenbahn bei. Sie gilt... Zunächst war das Reisen den privilegierten bürgerlichen Kreisen vorbehalten. Seit den 1860er-Jahren wurde es auch für andere Schichten populärer und wurde zu einer Art Volksbewegung. Zu erhöhter Mobilität trug insbesondere die Eisenbahn bei. Sie gilt als Geburtshelfer des frühmodernen Massentourismus. Nach Eröffnung des ersten fertiggestellten Teilstücks Siegburg – Overath – Ründeroth der Aggertalbahn im Jahre 1884 war nun auch Lohmar an den Bahnverkehr bestens angebunden und damit für die Stadtbevölkerung gut erreichbar. Lohmar und Umgebung entwickelten sich aufgrund der sehr guten Verkehrsanbindung, der landschaftlichen bzw. Naturschönheit und der vorhandenen Kulturdenkmäler zu einer der beliebtesten Ferienregionen im Kreisgebiet. Mit dem stetigen Anstieg der Feriengäste ging auch ein Ausbau der touristischen Infrastruktur - Pensionen, Hotels, Gasthäuser oder Restaurants - einher. 1925 gab es in dem Ort Lohmar, der seinerzeit 1250 Einwohner besaß, sieben voll konzessionierte Schankstätten. Von den Anfängen des frühmodernen Massentourismus der sogenannten Sommerfrische und ihrer Entwicklung in Lohmar und Umgebung bis 1933 berichtet die Leiterin des Kreisarchivs Dr. Claudia Maria Arndt in ihrem Beitrag im Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises 2022, siehe Dokument.
| |
|
2009
- 2022 Spaziergänger im Lohmarer Wald stoßen an einigen wenigen Stellen auf religiöse Bildstöcke. Da ihnen Inschriften fehlen, bleiben die Hintergründe und Sinn dieser Kleindenkmale im Verborgenen. Spaziergänger im Lohmarer Wald stoßen an einigen wenigen Stellen auf religiöse Bildstöcke. Da ihnen Inschriften fehlen, bleiben die Hintergründe und Sinn dieser Kleindenkmale im Verborgenen. Bildstöcke sind ein Zeichen der Volksfrömmigkeit und sollen zum Gebet animieren oder an bestimmte Ereignisse erinnern, z. B. an Unfallereignisse. Gerd Streichhardt hat sich in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter 2009 der Bedeutung und Hintergründen der im Lohmarer Wald aufgestellten Bildstöcke gewidmet, siehe Dokument. Er hat herausgefunden, dass einige Bildstöcke in den 1990er Jahren von einem „alten“ Lohmarer errichtet wurden: Josef Breuch, Jahrgang 1932. Aus Dankbarkeit für die Geburt seiner vier gesunden Enkel hat er für jeden einen Bildstock nach alten Vorlagen gebaut und im Wald aufgehängt.
| |
|
1926
- 2022 100 Jahre Karneval in Lohmar sollten in der Session 2021/22 nach den Planungen des Vereinskomitees groß gefeiert werden. War nach der gelungenen Karnevalseröffnung am 11.11.2021 vor dem Rathaus und der Proklamation des Dreigestirns am 20.11.2022 auf... 100 Jahre Karneval in Lohmar sollten in der Session 2021/22 nach den Planungen des Vereinskomitees groß gefeiert werden. War nach der gelungenen Karnevalseröffnung am 11.11.2021 vor dem Rathaus und der Proklamation des Dreigestirns am 20.11.2022 auf der KAZI-Karnevalssitzung die Zuversicht noch groß, machte kurze Zeit später eine weitere Corona-Welle allen Großveranstaltungen wie in der vorausgegangenen Session einen Strich durch die Rechnung. Auch vor gut 100 Jahren hatte es das rheinische Karnevalsbrauchtum schwer. Der 1. Weltkrieg wie auch später der 2. Weltkrieg hatten das Karnevalstreiben zum Erliegen gebracht. Aber auch damals ließen sich die Menschen nicht unterkriegen und den Karneval wieder aufleben. In Lohmar spielte der 1919 aus Männern des Jünglingsvereins gegründete Sportverein eine herausragende Rolle. Er stellte jeweils nach den beiden Weltkriegen die ersten Karnevalistischen Sitzungen auf die Beine: 17. Januar 1926 und 9. Februar 1947.
| |
Seit 2008 befindet sich das Vereinshaus des HGV Lohmar in der Bachstraße neben der Villa Friedlinde. Hier sind einige Exponate zu bedeutsamen historischen Gebäuden und entsprechende Fundstücke ausgestellt. Der 2017 verstorbene Heimatkundler und Autor... Seit 2008 befindet sich das Vereinshaus des HGV Lohmar in der Bachstraße neben der Villa Friedlinde. Hier sind einige Exponate zu bedeutsamen historischen Gebäuden und entsprechende Fundstücke ausgestellt. Der 2017 verstorbene Heimatkundler und Autor zahlreicher Berichte für die Lohmarer Heimatblätter Johannes Heinrich Kliesen hat sie zusammengestellt. Wer sich darüberhinaus für Funde in Lohmar aus der Vorgeschichte (Urgeschichte) interessiert, sei die ausführliche Darstellung, siehe Dokument von Heinrich Hennekeuser "Vorgeschichtliche Funde und Fundplätze in der Stadt Lohmar" empfohlen. | |
Die Postkarte mit dem Poststempel vom 22.7.1902 zeigt im oberen Teil den Blick von Windlöck auf Haus Auel und im Hintergrund auf den Auelerhof in Wahlscheid. Unten links hat man ein sehr gutes Bild von der alten Aggerbrücke mit dem Hotel Schiffbauer,... Die Postkarte mit dem Poststempel vom 22.7.1902 zeigt im oberen Teil den Blick von Windlöck auf Haus Auel und im Hintergrund auf den Auelerhof in Wahlscheid. Unten links hat man ein sehr gutes Bild von der alten Aggerbrücke mit dem Hotel Schiffbauer, heute Gaststätte Auelerhof.
| |
Die Kirche mit dem rund 35 Meter hohen Turm steht inmitten einer Gruppe reizvoller Fachwerkhäuser im sogenannten Kirchdorf, das lange Zeit als der älteste Kern von Lohmar galt. Auf dem Foto, etwa Ende der 1930er Jahre, ist der Pützerhof und der... Die Kirche mit dem rund 35 Meter hohen Turm steht inmitten einer Gruppe reizvoller Fachwerkhäuser im sogenannten Kirchdorf, das lange Zeit als der älteste Kern von Lohmar galt. Auf dem Foto, etwa Ende der 1930er Jahre, ist der Pützerhof und der Neuhof zu sehen. Seit Mitte der 60er Jahre ist der Turm außen verputzt. Die bittere Erkenntnis, dass die Luftverunreinigungen (CO2) den Steinzerfall an historischen Gebäuden ganz besonders begünstigt, hatte sich bereits vor dieser Zeit eingestellt. Der Eingang, ein schlichtes Stichbogenportal, trägt die Jahreszahl 1778 der Errichtung des Turms im Schlussstein. Damalige Maßnahmen beim Verputzen zur Steinfestigung reichten wahrscheinlich nicht aus, denn der Turm und das Langhaus wurden 2006 - 2011 komplett saniert.
| |
|
1910
- 1912 Ecke Kirch- und HauptstraßeEcke Kirch- und Hauptstraße Dort, wo ab 2006 das Projekt „Lohmarer Höfe“ begonnen und ab Ende 2008 teilweise bezogen wurde, errichtete vor rund 110 Jahren der Altenrather Johann Hermann gegenüber der Gastwirtschaft Peter Josef Knipp – auf der anderen Seite der Kirchstraße – das... Dort, wo ab 2006 das Projekt „Lohmarer Höfe“ begonnen und ab Ende 2008 teilweise bezogen wurde, errichtete vor rund 110 Jahren der Altenrather Johann Hermann gegenüber der Gastwirtschaft Peter Josef Knipp – auf der anderen Seite der Kirchstraße – das Hotel Hermanns in der dreigeschossigen Bauweise, wie auf dem Foto ersichtlich. Um 1910/1912 ist das Haus auf Postkarten als „Hotel zum Aggertal“ genannt, im Zweiten Weltkrieg wurde es zerstört und um 1950 als „Hotel Schnitzler“ wieder aufgebaut. Bevor das Grundstück wie oben beschrieben bebaut wurde, ist das Gebäude noch als Gaststätte und das Areal nach dem Abriss des Gebäudes als Interimsparkplatz genutzt worden. Auf der linken Straßenseite ist die Gastwirtschaft bzw. das Hotel „Zur Linde“ zu erkennen. Zur Zeit der Aufnahme um 1928 war Wilhelm Heere (Konzession 3.6.1927) der Besitzer dieser Gast- und Schankwirtschaft. Beide Gebäude hatten einen großen Saal mit Bühne, in dem bei Feierlichkeiten die Vereine ihre Karnevalsveranstaltungen, Kirmesbälle, Tanzvergnügen etc. abgehalten haben.
| |
|
1960
- 1970 Diese viergeteilte Mehrbildkarte (Potpourrikarte) „Gruß aus Lohmar“ zeigt auf der Bildseite vier Abbildungen. Das Motiv links oben zeigt die Villa Therese, in dieser Zeit Bergmann Erholungswerk e.V. Heim Lohmar (Siegkreis). Danach zog die Politische... Diese viergeteilte Mehrbildkarte (Potpourrikarte) „Gruß aus Lohmar“ zeigt auf der Bildseite vier Abbildungen. Das Motiv links oben zeigt die Villa Therese, in dieser Zeit Bergmann Erholungswerk e.V. Heim Lohmar (Siegkreis). Danach zog die Politische Akademie ein. 1985 erwarb die Gemeide Lohmar die Villa, erweiterte sie um einen Anbau für die Gemeindebücherei und richtete einen Saal für Veranstaltungen im ersten Obergeschoss ein. Im Dachgeschoss kam das Kulturamt unter. Bereits 1926 diente die Villa als Erholungsheim für Eisenbahner der Reichsbahn und noch früher war hier eine Gastwirtschaft mit Hotelbetrieb entstanden. Anfang der 1930er Jahre – in der die Villa als Erholungsheim der Reichsbahn-Betriebskrankenkasse Elberfeld diente – weilten während der Sommermonate erholungsbedürftige Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren für jeweils vier Wochen zur Kur. Rechts oben ist eine Gesamtansicht der Ortschaft angeordnet und links unten die Anfänge des Campingplatzes Lohmar Ort, von der Aggerbrücke aus gesehen. Auf der rechten Seite der Agger nahe der Einmündung des Rönkebachs sind auch einige Zelte zu erkennen. Hier badete die Altenrather Jugend. Die Teilansicht rechts unten zeigt die Gaststätte „Schnitzlers Eck“, Hauptstraße 64, Ecke Kirchstraße. Die Gebäude wurden im Baustil der 50er Jahre errichtet. | |
|
2012
- 2018 Grabungen nach alten Fundamenten und Artefakten lassen die Vergangenheit wieder aufleben und führen uns bis zu 10000 Jahre in die Siedlungsgeschichte unserer Orte zurück. Wenige haben bisher statt in die Tiefe in die Gegenrichtung, in den Himmel... Grabungen nach alten Fundamenten und Artefakten lassen die Vergangenheit wieder aufleben und führen uns bis zu 10000 Jahre in die Siedlungsgeschichte unserer Orte zurück. Wenige haben bisher statt in die Tiefe in die Gegenrichtung, in den Himmel geschaut. Selbst in suboptimalen Gegenden wie dem Auelsbachtal in Lohmar gelingt es dem Hobbyastronomen etwa 80 Millionen Jahre in die Vergangenheit zu fotografieren und die Strukturen von fernen Sternen und Galaxien sichtbar zu machen. Mit dem Start ins Rentnerdasein ließ Dr. Franz Maurer ein Jugendhobby wieder aufleben und baute sich in seinem Haus Am Wildtor in Lohmar ein Teleskop mit optimaler Ausrichtung der „Stundenachse“ parallel zur Erdachse auf. Mit einer selbst gebauten Digitalkamera, genannt CB, fotografierte er Galaxien in bis zu 80 Millionen Lichtjahre Entfernung. Erst seit den letzten Jahrzehnten wissen wir, dass unserer Galaxie eine von vielen Milliarden ist. Im 19. Jahrhundert glaubte man noch, dass unser Milchstraßensystem das ganze Universum darstellt. Im Alter von 88 Jahren beendetet Dr. Franz Maurer seine Beobachtungen. Zu seinen letzten Aufnahmen von seiner Sternwarte aus gehören die Bilder von der Mondfinsternis am 27.Juli 2018 . Seine Geschichte der Lohmarer Sternwarte in den Lohmarer Heimatblättern von 2012 schließt Franz Maurer mit einem Spruch von Immanuel Kant auf seinem Grabstein in Kalingrad: „Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.“
| |
In einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter 2016 erinnert Wilhelm Pape an Erich Klein (1920 -1999), der als Büttenredner und Theaterspieler in Lohmar die Menschen unterhielt. Aus russsischer Kriegsgefangenschaft schrieb er Gedichte über seine... In einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter 2016 erinnert Wilhelm Pape an Erich Klein (1920 -1999), der als Büttenredner und Theaterspieler in Lohmar die Menschen unterhielt. Aus russsischer Kriegsgefangenschaft schrieb er Gedichte über seine Heimat Lohmar, die in die 1930er und 1940er Jahre zurückführen. Das letzte schickte er am 1.Januar 1949 nach Hause. Mein Lohmar Kleiner Ort im Aggertal, an dich denk ich so manches Mal. Mein Herz mir immer schneller geht, wenn mir dein Bild vor Augen steht. Wie ein Apfel in der Schale liegt das Kleinod dort im Tale. Von Bergen, Wäldern rings umgeben, drinnen muntre Menschen leben. Leis’ flüstert mir die Aggerwelle, »Lohmar« liegt an dieser Stelle. Und die Wälder rauschen mir zu: „Lohmar, wie einzig schön bist du!“ Teure Heimat, wo ich jung war, sei gegrüßt, du mein Lohmar. All mein Sehnen, mein Verlangen, könnt’ ich dich nochmal umfangen. Namen von Klang Von den Bergen wohl bekannt »Ziegen- (1) und Güldenberg« (2) sei genannt. »Ingerberg« (3) und auch der »Blecken« (4) sich nach Osten hinaus erstrecken. Wo man zur Ernte sein Land bestellt, liegt das »Auels- und Mühlenfeld« (5). Im »Obersten Feld« (6) und in der »Bobetz« (7) man erntet und die Sense wetzt! Auch die »Broichwiese« (8) liegt parat für des kleinen Mannes Mahd. An der »Rodelbahn« (9), sei nicht vergessen, dort wächst auch noch viel zum Essen. Bald vergaß ich eines noch: »Lohmarhohn und Krölenbroich « (10). Wo im Wald »Drei Bänke« stehen (11), kann man schön spazieren gehen. Wo das »Lühmere Jrietche« in den Wald reinbiegt (12), am Waldrand gleich das »Ziegelfeld« (13) liegt. Und am anderen Dorfesende der »Jabach« (14) schlängelt durchs Gelände. Pilgerst zum heiligen Rochus nach Seligenthal, musst über’n »Pützerhau« (15) du alle Mal. Dann ist allen wohl bekannt ein Fleckchen, als die »Hardt« (16) benannt. Kieselhöhe (17) ist ein modernes Wort, »Kneppe« sagt man lieber dort. Hier liegt noch in nächster Nähe das Erholungsheim »Lohmar Höhe« (18). Willst’ nach »Hollenberg« (19) und »Hasselssiefen«(20), wirst du bald im Schweiße triefen. Doch ich wollt schon gerne schwitzen, könnt’ ich bloß nach Hause flitzen. Aber vielleicht dauert das noch lang, drum sind mir diese Namen immer von Klang.Seelentrost durch Himmelschöre,gib Gott, dass ich sie wieder höre! | |
1986 erschien das erste Heft der Lohmarer Heimatblätter. Das Gründungsmitglied und seit November 2021 Ehrenmitglied des HGV Lohmar, Hans Dieter Heimig, veröffentlichte hier seinen ersten Artikel über das Gespenst an der Aggerbrücke. Eine Lohmarer... 1986 erschien das erste Heft der Lohmarer Heimatblätter. Das Gründungsmitglied und seit November 2021 Ehrenmitglied des HGV Lohmar, Hans Dieter Heimig, veröffentlichte hier seinen ersten Artikel über das Gespenst an der Aggerbrücke. Eine Lohmarer Sage, die vermutlich 1900 kurz nach dem Bau der Stahlbogenbrücke über die Agger veröffentlicht wurde. Die Sage handelt von einem Bäcker, der wegen seiner Schandtaten auch im Grab keine Ruhe fand. Als Gespenst erscheint er an der Aggerbrücke und bietet dort seine Teufelswecken an. Mancher scheue sich deshalb bei Nacht, sich der Aggerbrücke zu nahen, da sich mancher vor dem abscheulichen Anblick so sehr erschreckt hat, dass er eine schwere Krankheit davongetragen habe oder sogar gestorben sei. | |
Seit Urzeiten war hinter der Burg Lohmar eine Furt durch die Agger, die seit der Besiedlung durch die merowingischen Franken (um 450n. Chr.) regelmäßig genutzt wurde. 1899 ließ die preußische Militärregierung eine Stahlbogenbrücke bauen, um den... Seit Urzeiten war hinter der Burg Lohmar eine Furt durch die Agger, die seit der Besiedlung durch die merowingischen Franken (um 450n. Chr.) regelmäßig genutzt wurde. 1899 ließ die preußische Militärregierung eine Stahlbogenbrücke bauen, um den Truppenverkehr zum Schießplatz in der Wahner Heide zu erleichtern. Die Brücke wurde in den Mannstedt-Werken in Troisdorf-Friedrich-Wilhelms- Hütte (de Hött) hergestellt. Ende des Zweiten Weltkrieges am Ostersonntag - 1.4.1945 - wurde die Brücke von deutschen Soldaten gesprengt. Die kurz danach errichtete Notbrücke wurde im Winter 1945/46 vom ersten Hochwasser wieder weggespült. 1948 wurde eine 1,5 Meter breite Holzbrücke errichtet, die 13 Jahre lang ihren Dienst tat, bis Anfang der 1960er Jahre eine Stahlbetonbrücke über die Agger gebaut wurde. Mitte der 1970er Jahre wurde die Autobahn A3 von vier auf sechs Spuren erweitert. Dafür musste die Autobahnbrücke aus den 1930er Jahren abgerissen und vergrößert neu gebaut werden. Weil die leichte S-Kurve für die Anbindung an die Aggerbrücke dadurch geringfügig enger geworden wäre und dies eine höhere Verkehrsgefährdung bedeutet hätte, wurde die Aggerbrücke gleich mit erneuert. Nun wurde sie der Linienführung der neuen Autobahnbrücke, die vom Rhein-Sieg- Kreis gebaut wurde, angepasst, so dass man über die Autobahnbrücke in gerader Linie über die neue Aggerbrücke nach Altenrath oder Troisdorf fahren kann. Weitere Infos lesen Sie in dem Dokument. | |
1946 hatte Otto Conrad als Kriegsversehrter eine Arbeit bei der Post in Lohmar erhalten. Die Poststelle befand sich damals im Haus der Familie Henkel Ecke Poststraße/Hauptstraße. Ab 1949 bis 1970 war seine Dienstelle in Donrath in der Poststelle 1,... 1946 hatte Otto Conrad als Kriegsversehrter eine Arbeit bei der Post in Lohmar erhalten. Die Poststelle befand sich damals im Haus der Familie Henkel Ecke Poststraße/Hauptstraße. Ab 1949 bis 1970 war seine Dienstelle in Donrath in der Poststelle 1, im alten „Fährmannshaus“ in der Donrather Straße. 25 km legte Otto Conrad täglich mit dem Fahrrad als Post-, Landzusteller in Donrath und Umgebung zurück. Auch Pakete musste er mit dem Fahrrad zustellen. Ab 20 kg „Übergewicht“ bekam er eine Fahrradentschädigung neben seinem Monatslohn, der am Anfang nur 80 DM betrug bei 53 Stunden Arbeitszeit wöchentlich. Seine Erinnerungen hat Wolfgang Weber festgehalten, siehe Dokument. | |
|
1913
Die Mehrbildpostkarte als „Gruß aus Lohmar“ ist am 8.2.1913 gelaufen. Die Partie aus der Hauptstraße ist von der „Schultes Wiese“ aus (sie war bis um 1950 der Lohmarer Kirmesplatz) fotografiert worden. Man sieht die Waldesruh, den Gasthof Knipp,... Die Mehrbildpostkarte als „Gruß aus Lohmar“ ist am 8.2.1913 gelaufen. Die Partie aus der Hauptstraße ist von der „Schultes Wiese“ aus (sie war bis um 1950 der Lohmarer Kirmesplatz) fotografiert worden. Man sieht die Waldesruh, den Gasthof Knipp, später „Hotel zur Linde“, das „Hotel zum Aggertal“ des Joh. Schnitzler, das Haupthaus des Schultes-Hofes, die dazugehörigen Nebengebäude, die „Schultes Wiese“ und wahrscheinlich die alte Lohmarer Dorflinde, von der es bisher kein Foto gibt. Das andere Foto zeigt die Post um diese Zeit. Sie war im Wohnhaus des Rudolf Borchert untergebracht und wurde von Paulina Hermanns betrieben. In diesem Haus hatte von 1923 bis 1961 der damals einzige Arzt in Lohmar, Dr. Wilhelm Römer seine Praxis. Heute ist dort die Parfümerie „Rüdell“ und verdeckt das ehemalige Post-Haus. Die kaiserliche Postagentur für Lohmar und Donrath war bis 1884 im „Haus Stolzenbach“ in Lohmar-Peisel. Wegen Inbetriebnahme der Aggertalbahn wurde sie im selben Jahr für Donrath in den Böttnerhof verlegt und für Lohmar in die Gaststätte des Johann Hermanns im Schulteshof (Nr. 4), heute „Lohmarer Höfe“. Johann Hermanns aus Altenrath hatte die Gaststätte von Johann Altenhoven gepachtet und betrieb dort als „Hilfsposthalter“ die „Posthilfsstelle“ Lohmar. 1893 baute Johann Hermanns neben den Schultes-Hof auf die Ecke Kirchstraße/Hauptstraße sein „Hotel Restaurant zum Aggerthal“ Nr. 3 und richtete dort im angebauten Saal die Postagentur ein. Nach dem Tode von Johann Hermanns 1906 – seine Ehefrau war schon 1901 verstorben – verkaufte seine Tochter Maria das Hotel an Johann Schnitzler. Die zweite Tochter von Johann Hermanns, Sibilla Paulina, führte die Postagentur weiter – zunächst im Hotel Schnitzler und ab 1908 wieder im Schultes-Hof Nr. 4. Vielleicht wegen einer engeren Beziehung zu Rudolf Borchert, den sie 1917 heiratete, zog Paulina Hermanns etwa 1911/12 mit der Postagentur in das Haus Borchert und führte dort bis zu ihrer Heirat 1917 die Postgeschäfte. Dann wurde die Agentur wieder in das Haus Schultes Nr. 4 verlegt und bis zum 5.10.1923 von Anton Söntgen betrieben. Wegen Vakanz der Stelle sind danach die Postangelegenheiten bis zum 27.5.1924, als Josef Henkel von Herchen nach Lohmar versetzt wurde, von einem Siegburger Beamten verwaltet worden. Auch Josef Henkel residierte noch im Hause Schultes Nr. 4 bis er sich an der Hauptstraße/ Ecke Poststraße (die damals noch Postweg hieß) ein neues Haus gebaut hatte, in das er am 14.1.1929 mit der Postagentur einzog. Hier bearbeitete er bis um 1950 die Postgeschäfte. 1955 waren Werner Trautmann und Heinz Otto aus Oberstehöhe die Postbeamten im Hause Henkel – und das noch bis 1960, als neben dem Schultes-Hof ein neues Haus gebaut wurde, in das dann die Post in größere Räume umziehen konnte. Dort blieb die Post bis etwa im Jahr 2004 das Haus und später auch die „Schnitzlers Eck“ abgerissen wurden, um den „Lohmarer Höfen“ Platz zu machen. | |
|
2008
- 2016 500 Meter vor der Mündung des Naafsbachs in die Agger, im Ort Kreuznaaf befand sich eine Mahl- und Ölmühle, die „Noffemöll“ oder auch „Frackenpohl’s Mühle“, so genannt nach dem Mühlenbesitzer. Alles begann 1870. Wilhelm Frackenpohl betrieb in der... 500 Meter vor der Mündung des Naafsbachs in die Agger, im Ort Kreuznaaf befand sich eine Mahl- und Ölmühle, die „Noffemöll“ oder auch „Frackenpohl’s Mühle“, so genannt nach dem Mühlenbesitzer. Alles begann 1870. Wilhelm Frackenpohl betrieb in der Gegend ein Fuhrgeschäft für Getreide sowie einen Getreidehandel. Die Unternehmen liefen so gut, dass er den Betrieb erweitern und einen großen Mühlenkomplex in zeitgenössischem Stil errichtet konnte. In den Jahren 1870-1875 wurde aus Hangelarer Feldbrandziegeln der große Bau mit Wohnhaus errichtet. Durch die neue Mühle und Gebäude war man nun in der Lage, das Getreide selbst zu mahlen und auch zu lagern. Wilhelm Frackenpohl, hatte mit vier nebeneinander stehenden Mühlsteinen die Mühle betrieben. (zum Teil für verschiedene Mahlgänge: Feinmehl – Weizenvermahlung, Backschrotgang, zwei Futterschrotgänge und eine Haferquetsche). Eine Königs-Antriebswelle erstreckte sich vom Sockelgeschoss bis ins 2. Stockwerk. 1923 wurde die Mühle auf Turbinen umgestellt, d.h. alle die schönen sichtbar getriebenen ober-, mittel- und unterschlächtigen Wasserräder verschwanden. Die (Hafer-) Quetsche war eine feste Einrichtung der Mühle, wo der Hafer samt Spelze zwischen den eingestemmten Rillen der Mahlsteine (oberer Läuferstein und unterer fester Bodenstein) zerrieben – gequetscht – wurde. Je größer der Abstand zwischen den beiden Steinen – später gab es Schrotmühlen mit geriffelten Hartgusswalzen – je gröber wird das Mahlgut zu Back- oder Futterschrot gemahlen. Für das grobe Mahlen zu Schrot genügt ein Durchlauf (Mahlgang). Als Schrotmühe galt nach Verordnung jede Vorrichtung die zum Mahlen, Schroten und Quetschen von Getreide, aber auch Buchweizen-, Hafer- und Gerstengrütze, geeignet ist, mag sie für Hand- oder Kraftbetrieb eingerichtet, beweglich oder fest eingebaut sein. Später kam noch eine Bäckerei hinzu. In den 1950er Jahren kam das Brot als Aggertaler Brot in die Geschäfte. Das Unternehmen bestand bis 1975 und wurde geschlossen, als kein Nachfolger gefunden wurde. Eine Tradition, die über vier Generationen bestand, ging zu Ende. Auf dem Bild Ort Kreuznaaf erkennt man den Ort mit der alten Straßenführung, ein enges Gässchen hinter der Mühle vorbei an kleinen Fachwerkhäusern unterhalb des ehemaligen Seminargebäudes Steineck von Faber-Castel, hinauf auf den Bergrücken des Rotsberg entlang der Kreisstrasse K 34 nach Hausen, Hausdorp und Höffen. Heute ist dieses Gebäude eine dem rohbaugleiche Bauruine..Der Lohmarer Stadtanzeiger berichtete im Juli 2013, dass das „Castell Steineck durch eine Bergisch Gladbacher Firma ersteigert worden sei und das frühere Tagungshotel weitgehend in seinem jetzigen Zustand erhalten und nach Sanierung zum hochwertigen Quartier für Wohnen und Arbeiten werden soll. Danach wurde die Immbilie weiter verkauft. Wer die Natur erleben will, soll das romantische Naafbachtal mit seinen fast versteckten Ansiedlungen sowie den tier- und pflanzenreichen Niederungen durchwandern, das in Kreuznaaf oberhalb des Mühlenteichs von der heutigen Straßenführung rechts abzweigt. Der Weg durch dieses ruhige Tal folgt überwiegend dem sich windenden Bachlauf. In der Ortschaft Kreuznaaf, unterhalb der Bauruine Castel Steineck, beginnt der Wanderweg ins Naafbachtal. Er führt als Talweg zunächst bis Ingersauel und dann ins zweite Naafbachtal ggfls. bis Blindennaaf oder zur Fischermühle und weiter ins Quellgebiet des Kleinen- und Großen Naafbachs. Das dritte Bild zeigt den Weiler Weeger Mühle am Ausgang des Wenigerbachtals ins Naafbachtal in südöstlicher Richtung von den Viehweiden unterhalb vonHausdorps aus betrachtet. Die Weeger Mühle wurde im Rahmen erster 69 Planungsüberlegungen zur Naaftalsperre – da sie sich im späteren Stauraum der Talsperre befinden würde - vom Aggerverband aufgekauft, entsiedelt und bereits in den 1960er/70er Jahren abgerissen.
| |
|
10. November 1929
In seinem Buch Heimatliche Winterzeit – Erinnerungen hat Bernhard Walterscheid – Müller über die Lohmarer Winterzeit in den 1920er Jahren geschrieben. Ein jahrhundertealtes heimatliches Brauchtum fand am Vorabend des 11. November statt: Der... In seinem Buch Heimatliche Winterzeit – Erinnerungen hat Bernhard Walterscheid – Müller über die Lohmarer Winterzeit in den 1920er Jahren geschrieben. Ein jahrhundertealtes heimatliches Brauchtum fand am Vorabend des 11. November statt: Der Martinszug. Ausführlich wird der Martinzug von 1929 geschildert. Träger war die Lohmarer Freiwilige Feuerwehr. Die Kinder mit ihren Eltern und Lehrern bereiteten mit Begeisterung das Martinsfest vor. Im alten „Backeshoff“ in der heutigen Straße Im Backesgarten wurden zwei pferdebespannte Plateauwagen zu Gänsewagen umgebaut. In der Wagenmitte eines Wagens war ein Drahtkäfig mit drei lebenden Gänsen, die nach dem Martinszug in einer Gaststätte verlost wurden. Die Attraktion auf dem anderen Wagen war eine aufmontierte überdimensionale Martinsgans, die übers Jahr im Feuerwehrhaus in der Kirchstraße gelagert wurde. Der Zug formierte sich an der Aggerbrücke an der Spitze mit Brandmeister Johann Pape, flankiert vom Polizeisergeanten Johann Krawzczyk, eine Siegburger Blaskapelle und das Lohmarer Tambourcorps. Dann kamen die kleinsten fackeltragenden Schulkinder und der erste Wagen mit der großen Martinsgans und den Gänsemädchen. Es folgte der zweite Gänsewagen mit aufgeregt flatternden Gänsen. Um den Käfig herum standen die Gänsejungen und – mädels. Der Strecke des Martinszuges verlief aus der Kirchstraße über die Hauptstraße zum Unterdorf, dann über die Bachstraße, Mühlenweg, Hauptstraße bis zur Schneiders Wiese (heutiges Rathaus), wo das Martinsfeuer abgebrannt wurde. Zum Ende zogen die Kinder zur alten Schule in der Kirchstraße, wo die Martinswecken in Empfang genommen wurden. Sie waren von den Lohmarer Bäckern Karl Halberg, Johannes Knipp und Peter Kraheck kostenlos gebacken worden. Die Feuerwehrmänner setzten nach dem Löschen der glimmenden Reste des Martinsfeuers die Löscharbeiten im Gasthof „Zur Linde" bei Wilhelm Heere und im Hotel „Zum Aggertal“ bei Johann Schnitzler fort.
| |
Am Fuß des Griesberges, der heutigen Kieselhöhe liegt das stattliche und gepflegte Fachwerkhaus Kieselhöhe 1. Im Volksmund heißt die Kieselhöhe Knippen (Nase eines Hügels). Es ist aufgrund von Überlieferungen sehr wahrscheinlich, dass hier an der... Am Fuß des Griesberges, der heutigen Kieselhöhe liegt das stattliche und gepflegte Fachwerkhaus Kieselhöhe 1. Im Volksmund heißt die Kieselhöhe Knippen (Nase eines Hügels). Es ist aufgrund von Überlieferungen sehr wahrscheinlich, dass hier an der spitzwinkligen Einmündung der Straße Kieselhöhe in den Mühlenweg direkt an einem der früheren Fernwege aus Richtung Siegburg nach Hochkeppel (heute Hohkeppel) über die jetzige Alte Lohmarer Straße, die Bachstraße und den Mühlenweg in Richtung Donrath über den Heppenberg nach Scheiderhöhe und weiter über die Höhen ins Bergische (auch »Polizeiweg« genannt), sich eine Gastwirtschaft mit Herberge befunden hat. Das damalige Haus lag schräg gegenüber dem Schmitter-Hof (Schmiede), umgeben von den Parzellen Schmittengarten, Mühlengarten mit Mühle, Auf der Clause, Auf dem Greil und dem Klusengarten. Der Denkmalpflegeplan der Stadt Lohmar weist den gesamten Bereich Kieselhöhe, Mühlenweg als erhaltenswerten Ortsbereich aus. Das Haus wird erstmals im Jahr 1823 durch „Vermessungsgehilf Brodler“ schriftlich erwähnt. Eigentümer war ein gewisser Wilhlem Pütz. Aufgrund der Gefügestruktur des Haupthauses ist von einer zweiphasigen Errichtung des Baukörpers auszugehen. Dendrochronologische Untersuchungen haben als Entstehungszeit zumindest für den Dachstuhl und den westlichen Teil des Hauses die Jahre 1802/03 ergeben. Nach der Familie Pütz war die Familie Pohl Eigentümer des Hauses. Die alten Pohls - Hubert und Gertrud, geborenen Hagen - überlieferten, dass das Haus in ihrer Jugendzeit bei älteren Leuten den Namen „De Koenseck op de Löngk“ (die Schnapsecke auf der Linde) gehabt habe. Ihr Sohn Johannes (1922 – 1983) hat viele Überlieferungen und anekdotische Histörchen über sein Geburts- und Elternhaus zusammengetragen. In den 1950er Jahren sollen der damalige Amts- und Gemeindebürgermeister Willi Schultes und der Amtsdirektor Priel einige Male an ihn herangetreten sein, ob er im alten historischen Fachwerkanwesen wieder eine Gastwirtschaft betreiben wolle.
| |
Peter Kemmerich (Jahrgang 1894) berichtet in seinem Buch „Meine Heimatgemeinde Lohmar um und nach 1900“, dass unterhalb der Kieselhöhe, wo der Mühlenweg in die Rathausstraße mündet, am Auelsbach das „Schmeddemüllersch“ Haus stand. In dem Lohmarer... Peter Kemmerich (Jahrgang 1894) berichtet in seinem Buch „Meine Heimatgemeinde Lohmar um und nach 1900“, dass unterhalb der Kieselhöhe, wo der Mühlenweg in die Rathausstraße mündet, am Auelsbach das „Schmeddemüllersch“ Haus stand. In dem Lohmarer Nachbarschaftsbuch von 1767 wird ein „Schmitterhof“ genannt, wahrscheinlich die erste Dorfschmiede Lohmars. Mit der Historie des Fachwerkhauses setzt sich Johannes Heinrich Kliesen in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter ausführlich auseinander (siehe Dokument). In dem Haus wohnte „das Wiesemölleche“. Seine Tätigkeit bestand u. a. in Mauerflickarbeiten und Kalkanstrichen von Fachwerkhäusern. Sein Sohn Johann Müller entwickelte aus dieser Tätigkeit des Vaters heraus ein Baugeschäft. Er hatte mit seiner Frau Therese, geb. Dellweg, elf Kinder, wovon zwei schon im Kleinkindalter gestorben sind. Von den sieben Söhnen sind drei im 2. Weltkrieg gefallen und der zweitjüngste der Söhne ist kurz nach dem Krieg durch einen Sturz vom Gerüst gestorben. Nachdem Johann 1959 verstarb, führte der älteste Sohn Jean das Baugeschäft. Jean kam 1963 bei einem Autounfall ums Leben. Im Jahr 2021 lebt nur noch Elisabeth Klein (Jahrgang 1924), das zweitjüngste der Müller Kinder. Nach dem Tod von Jean Müller übernahm Walter Inden, der die jüngste Tochter Thea geheiratet hatte, die Baufirma und führte sie als Inden Bau KG weiter. Das Anwesen ist inzwischen an einen Bauinvestor verkauft worden. Der aufgestellte Bauzaun vor dem „Schmeddemüllersch“ Haus lässt darauf schließen, dass hier Baumaßnahmen beabsichtigt sind. In unmittelbarer Nachbarschaft ist 2021 am Mühlenweg mit großzügiger Genehmigung der Stadt Lohmar ein moderner großer Neubau errichtet worden, der ortsspezifische Strukturen unberücksichtigt lässt und ein sensibles Einfügen vermissen lässt. Die Immobilien liegen in einem Bereich, den der am 23. Sept. 2015 vom Stadtrat beschlossene Denkmalpflegeplan als erhaltenswerten historischen Ortsbereich ausweist.
| |
|
2004
- 2006 Nicht nur wegen der Corona Pandemie findet seit 2019 bis heute (2021) kein Stadtfest auf der Lohmarer Hauptstraße mehr statt. Am 21. Mai 2006 wurde mit einem großen Frühlingsfest „Unter den Linden“ die Fertigstellung der neuen Shopping- und... Nicht nur wegen der Corona Pandemie findet seit 2019 bis heute (2021) kein Stadtfest auf der Lohmarer Hauptstraße mehr statt. Am 21. Mai 2006 wurde mit einem großen Frühlingsfest „Unter den Linden“ die Fertigstellung der neuen Shopping- und Flaniermeile gefeiert. Viele tausend Besucher erlebten ein großes Stadtfest mit vielen Attraktionen aus Lohmar und dem Höhepunkt auf der großen Bühne mit den Klostertalern, einer Musikgruppe aus dem österreichischen Voralberg. Der erste Spatenstich zum Umbau der Hauptstraße war nur drei Wochen nach der Eröffnung der Ortsumgehung Lohmar am 21.Juni 2004 erfolgt. Am 27. November 2005 wurde der 98. Lindenbaum gepflanzt und im Februar 2006 mit den letzten Fahrbahnmarkierungen die Umbaumaßnahme abgeschlossen. Die Ereignisse hat Jürgen Morich 2006 in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter festgehalten, siehe Dokument.
| |
|
1983
- 2019 Altenrath hat eine über mehrere Jahrhunderte reichende Siedlungsgeschichte. Es wurde erstmals 1117 urkundlich erwähnt und gehörte ab dem 15. Jahrhundert bis Anfang des 19. Jahrhunderts zum Herzogtum Berg, später zum Amt Lohmar und wurde 1969 bei der... Altenrath hat eine über mehrere Jahrhunderte reichende Siedlungsgeschichte. Es wurde erstmals 1117 urkundlich erwähnt und gehörte ab dem 15. Jahrhundert bis Anfang des 19. Jahrhunderts zum Herzogtum Berg, später zum Amt Lohmar und wurde 1969 bei der kommunalen Neuordnung in die Stadt Troisdorf eingegliedert. Mit dem Erlaß des Reichskriegsministeriums von 1936, Altenrath in den Truppenübungsplatz Wahn einzubeziehen, erfolgte eine Zäsur. Bereits 1817 war der Truppenübungsplatz errichtet worden. Jetzt mussten die Einwohner sich abfinden lassen und die Häuser räumen. Altenrath wurde ein Geisterdorf. Lediglich zu Allerheiligen durften die Gräber der Angehörigen besucht werden. Dies änderte sich mit dem Ende des zweiten Weltkrieges. Am Tag der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8.5.1945 gab die amerikanische Militärkommandantur Altenrath zur Wiederbesiedlung frei. Schon einen Tag später wurde die Familie Schäfer als erste durch den als Treuhänder eingesetzten Amtsbürgermeister Josef Lagier in Altenrath eingewiesen. Anfang der 1980er Jahre kam es zur Teilprivatisierung der Ortschaft. Im April 1983 wurde das erste Haus an die Familie Alexi im Schengbüchel 32 verkauft. Wie beschwerlich die Wiederbesiedlung Altenraths ablief, welche Schicksalsschläge die neuen Siedler zu überwinden hatten und wie Altenrath die Einwohnerzahl von 2300 im Jahr 2021 erreichte und zu neuem Leben erwachte, schildert Manfred Krummenast in seinem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter 2019. Der Autor verstarb im Alter von 84 Jahren am 1.9.2021. Er war Zeit seines Lebens mit Altenrath eng verbunden. Die Siedlungsgeschichte bis 1945 hat Wilhelm Pape ausführlich beschrieben. Beide Berichte sind in dem Dokument zusammengefasst. | |
Auf eine über 100jährige Firmengeschichte blickt die Fa. Walterscheid in Lohmar zurück. 1919 gründete der gelernte Dreher Jean Walterscheid das Unternehmen, indem er mit seinem Freund Adolf Mletzko in einer Waschküche in Siegburg Zahnkränze für... Auf eine über 100jährige Firmengeschichte blickt die Fa. Walterscheid in Lohmar zurück. 1919 gründete der gelernte Dreher Jean Walterscheid das Unternehmen, indem er mit seinem Freund Adolf Mletzko in einer Waschküche in Siegburg Zahnkränze für Fahrräder herstellte. 1923 zog er mit der Firma in das alte Wasserwerk an der Wahnbachtalstraße und 1934 in die Hansamühlen am Mühlengraben um. Hier wurden Achswellen für Pkw und Lkw gefertigt. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde dem Lohmarer Bernhard Müller die Betriebsleitung übertragen. 1952 adoptierte ihn Jean Walterscheid und Bernhard Walterscheid-Müller wurde Mitinhaber des Unternehmens. Zusammen mit dem Ingenieur Kurt Schröter erschließt er ein neues Geschäftsfeld und steigt mit der Entwicklung von Gelenkwellen in die Landtechnik ein. 1955 wurde das Werk in Lohmar errichtet. Auf Initiative von Bernhard Walterscheid-Müller schließen sich sechs Gelenkwellenhersteller aus vier Ländern zusammen und gründen 1964 die Aktiengesellschaft Uni-Cardan. Er selbst bleibt Geschäftsführer von Walterscheid und wird Vorstandsvorsitzender der Uni-Cardan mit dem Verwaltungssitz in Lohmar. In den 1960er Jahren wird am Lohmarer Standort kräftig erweitert. 1972 wird Walterscheid in eine Kapitalgesellschaft (GmbH) umgewandelt. Im selben Jahr stirbt der Firmengründer Jean Walterscheid im Alter von 80 Jahren. In der Uni-Cardan-Gruppe drängt die GKN auf eine größere Beteiligung. Bernhard Walterscheid-Müller überlässt 1971 die Mehrheitsanteile (58,7 %) der GKN. Die Uni-Cardan wird zu einem Tochterunternehmen des englischen Konzerns. Auch Walterscheid gehört jetzt zu GKN. Nachdem im Frühjahr 2018 die GKN im Zuge einer feindlichen Übernahme in den Besitz der Londoner Beteiligungsgesellschaft Melrose gelangt war, wird 2019 Walterscheid an die Beteiligungsgesellschaft One Equity Partners (OEP) verkauft. Im Juli 2021 wird die Walterscheid Group von Comer Industries, Italien übernommen. Sie bilden zusammen einen der weltweit größten Maschinenbaukonzerne für Landwirtschaft. Die Firmengeschichte bis 2003 hat Wilhelm Pape in zwei Artikeln für die Lohmarer Heimatblätter zusammengefasst, siehe Dokument
| |
|
1991
- 1992 Am 21. Juli 2021 jährt sich zum 30. Mal der Todestag von Bernhard Walterscheid Müller. 300 Menschen gaben am 30. Juli 1991 einem der bekanntesten Lohmarer Persönlichkeiten auf dem Lohmarer Friedhof das letzte Geleit. Bernhard Walterscheid-Müller... Am 21. Juli 2021 jährt sich zum 30. Mal der Todestag von Bernhard Walterscheid Müller. 300 Menschen gaben am 30. Juli 1991 einem der bekanntesten Lohmarer Persönlichkeiten auf dem Lohmarer Friedhof das letzte Geleit. Bernhard Walterscheid-Müller wurde am 5. April 1918 in Lohmar geboren. Seine Eltern waren Heinrich und Elisabeth Müller. Nach einer kaufmännischen Lehre bei Josef Schmandt, dem späteren Siegburger Bürgermeister wechselte er zur Firma Walterscheid in Siegburg und wurde dort bereits 1937 zum leitenden Angestellten. 1952 wurde er vom Firmeninhaber Jean Walterscheid adoptiert. Er führte die Jean Walterscheid GmbH zu einem weltweit bekannten Unternehmen der Landmaschinen und Fahrzeugindustrie und größten Arbeitgeber in Lohmar. Viele Auszeichnungen würdigen sein Lebenswerk. Er war Ehrenbürger der Stadt Lohmar. Als Vorsitzender und Ehrenvorsitzender prägte er den Heimat- und Geschichtsverein Lohmar. In der Ausgabe der Lohmarer Heimatblätter von Dezember 1992 hat der Verein in einem Kurzporträt sein Leben und Wirken gewürdigt, siehe Dokument.
| |
|
2013
Es ist kennzeichnend für das Bergische Land und dessen Randgebiete, dass die Siedlungsentwicklung meist von den Höhenzügen ausging, wie z. B. beim Knipscher Hof auf dem Schönrather Höhenrücken, wo zuerst die Quellmulde des Bonnensiefens besiedelt und... Es ist kennzeichnend für das Bergische Land und dessen Randgebiete, dass die Siedlungsentwicklung meist von den Höhenzügen ausging, wie z. B. beim Knipscher Hof auf dem Schönrather Höhenrücken, wo zuerst die Quellmulde des Bonnensiefens besiedelt und von Wirtschaftsflächen umgeben wurde. Die Besiedelung der Täler erfolgte dann in der Regel erst viel später, da man mit den Fuhrwegen und Viehtriften den grundwassernahen, üblicherweise morastigen Talböden bis weit in das 19. Jahrhundert auswich und sich in den Tälern die kulturlandschaftliche Entwicklung erst unter dem Einfluss der Industrialisierung tiefgreifend änderte. Chausseen entlang der Wasserläufe in den großen Tälern – wie z.B. die durchs Aggertal verlaufende Beuel- Overather Kommunalstraße [1845] oder die Sülztalstraße [1933] – wurden erst viel später gebaut und in Betrieb genommen. Charakteristisch für die siedlungsgeschichtliche Namensgebung des Weilers war die Gestalt und Form des Geländes, die Höhenlage der Siedlung bzw. Siedlungsteile des Knipscher Hofes. Diese besondere Geländeform des „Knippens“ zwischen dem Gammersbach- und dem Kupfersiefental geht aus dem Bestimmungswort (Knipp, Knepp, Kneppen, Kneppchen, Knüppen) hervor, in der Bedeutung für höchster steiler Punkt eines Berges, kleiner, spitzer Hügel, besonders hervortretende Stelle im Feld oder Wald, oberster Punkt eines Weges, steiler Anstieg. Der Knipscher Hof wird mit weiteren Höfen als zugehörige Güter, sog. Appertinentien, von Burg Schönrath, zusammen mit dieser, von den Eigentümern, den Eheleuten Goswin Adolf von Heyden und Charlotte von Heyden, am 4. Oktober 1695 an den Mecklenburger Ernst Freiherr von Erlenkamp verkauft. Der Ausverkauf und der Verfall des Hauses Schönrath begann 1750 mit dem Verkauf des Lüghauser Hofes, des Schlehecker Hofes und des Körfer Hofes, der sich 1785 mit dem Verkauf des Georgshofes, des Knipscher Hofes, des Gammersbacher Hofs und schließlich des Rodder Hofes fortsetzte. Ab dem 18. Jahrhundert lässt sich die Entwicklung des Knipscherhofes bis heute über viele Generationen, anhand eines handgeschriebenen Stammbaumes und einer Familienchronik, als Anfang eines Hofbuches, beginnend mit den Eheleuten Godfried Linden, geb. 1736 zu Lind und Gertrudis geb. Lützenkirchen in Stamheim, im Jahre 1738 geboren, zurückverfolgen. Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist der Knipscherhof im Besitz der Familie Hein. 1936 wurde der Hof (30 ha) bei der Erbteilung aufgeteilt. Karl Hein erhielt den unteren Hof (Parzelle 164) und Ferdinand Hein den oberen Hof (Parzelle 158). Nach der Teilung gehörten auch die beiden Höfe zu denen, die zu klein waren, um nach den 1980er Jahren selbstständig weiter zu bestehen. Der obere Hof ist verpachtet, der untere wird im Nebenerwerb bewirtschaftet. Die geschichtliche und baugeschichtliche Entwicklung des Hofes und das bäuerliche Leben der Bewohner sind in dem Dokument ausführlich beschrieben.
| |
Vereinsfahnen schreiben Geschichte überschrieb Peter Hennekeuser seinen Artikel für die Lohmarer Heimatblätter 2011, den er den damaligen sechs Männerchören, die dem Chorverband Rhein -Sieg angehörten widmete: Männerchor Wahlscheid 1879 e.V., MGV... Vereinsfahnen schreiben Geschichte überschrieb Peter Hennekeuser seinen Artikel für die Lohmarer Heimatblätter 2011, den er den damaligen sechs Männerchören, die dem Chorverband Rhein -Sieg angehörten widmete: Männerchor Wahlscheid 1879 e.V., MGV „Eintracht“ Honrath 1882 e.V., Lohmarer Männerchor e.V. 1890, Männerchor „Liederkranz“ Birk 1908 e.V., MGV „Frohsinn“ Höffen e.V. 1913, Männerchor Donrath 1970 e. V.. Mit der Gründung des Gesangvereins und den Festlegungen der Statuten stand die Anschaffung einer Vereinsfahne ganz vorne an. Bei fast jedem öffentlichen Auftritt, bei Konzerten, Theaterabenden und bei Hochzeiten und Beerdigungen von Vereinsmitgliedern war die Fahne dabei. Selbstverständlich trug man auch die Fahne bei Festumzügen. Das Hegen und Pflegen der Fahne mit Krone, Stab und weiterem Zubehör stand in der Verantwortung der gewählten Fahnenträger. Der älteste Lohmarer Männerchor, der Männerchor Wahlscheid erhielt seine erste Fahne 1894. Sie ging im ersten Weltkrieg verloren und wurde 1954 ersetzt. Die erste Fahne des MGV Eintracht Honrath fiel bei einer Reinigung in der Fahnenfabrik Arnold Steiger in Köln einem Brand zum Opfer. Die zweite Fahne verschwand 1918 und tauchte 1954 überraschend wieder auf, nachdem man sie bereits durch eine andere Fahne ersetzt hatte. Die Fahne war im ersten Weltkrieg in die USA zu einem Indianer in Montana gelangt, der sie schließlich einem Bekannten übergab, um sie dahin zu bringen, wo sie herkam. Einige Jahre nach der Gründung des MGV “Frohsinn“ Lohmar 1890 wurde die Vereinsfahne in Auftrag gegeben. Warum wie zunächst vorgesehen der Leitsatz des Chores „Frohsinn, Einigkeit, Lieb und Treue sich stets in uns`rem Lied erneure“ nicht aufgedruckt wurde, ist nicht bekannt. Sänger Gerd Küpper war 40 Jahre lang für die Fahne verantwortlich und bewahrte sie bei sich zu Hause auf. Zu besonderen Anlässen werden Fahnenstange, Krone, Ehrennägel und Schleifen für den Auftritt vorbereitet. Bei Beerdigungen von Sängern und Ehrenmitgliedern trägt die Fahne eine schwarze Trauerschleife. Über dem Grab des Verstorbenen senkt die Fahne sich dreimal in kurzen Abständen. Der MGV „Liederkranz“ Birk weihte seine Fahne im Rahmen eines Stiftungsfestes am 30. Juli 1911 ein und der MGV „Frohsinn“ Höffen feierte am 29. Mai 1921 sein Fahnenweihe-Fest mit einem Festzug vom Auelerhof vorbei an festlich geschmückten Häusern bis zum Vereinslokal nach Höffen.
| |
|
2002
Im Frühling des Jahres 1952 begeisterte Ernst Mester die Pfarrjugend von Neuhonrath für seine Idee zur Gründung eines Musikvereins. So traf sich am Ostermontag, dem 20. April, eine Gruppe Jugendlicher im Gasthof »Zur Baach« und gründete den Verein,... Im Frühling des Jahres 1952 begeisterte Ernst Mester die Pfarrjugend von Neuhonrath für seine Idee zur Gründung eines Musikvereins. So traf sich am Ostermontag, dem 20. April, eine Gruppe Jugendlicher im Gasthof »Zur Baach« und gründete den Verein, dem sie ein Jahr später den Namen »Bergischer Bläserchor Neuhonrath « gab. 1973 wurde der Vereinsname umbenannt in Blasorchester Neuhonrath. Neben dem Initiator Ernst Mester zählten Franz-Josef Altenrath, Karl Frielingsdorf, Clemens Jackes, Johannes Lambertz, Heinz Radau, Karl Tenten sowie Paul-Heinz und Thomas Zimmermann zu den ersten Mitgliedern. Bereits am 25. Oktober 1952 konnten die Bläser zur Einweihung des Neuhonrather Jugendheimes, das sie aus einer alten Scheune mit großem Engagement selbst umgebaut hatten, zum ersten Mal öffentlich auftreten. Hier fanden sie auch in der Folgezeit einen geeigneten Proberaum.Zum ersten Vorsitzenden des neuen Vereins wurde Paul-Heinz Zimmermann gewählt, der im April 1954 von Bernhard Altenrath abgelöst wurde. Nachfolger wurde zwei Jahre später Ernst Mester, der dieses Amt 31 Jahre lang bis 1987 innehatte. Im Jahr 2021 ist Caret Henning (Saxophon) die erste Vorsitzende. Seit den 60er Jahren wurde der Verein von einem kleinen Bläserchor zu einem großen Blasorchester kontinuierlich weiterentwickelt. Er ist nicht nur eine feste Größe im Lohmarer Kulturleben, sondern weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Maßgeblich hierfür war, dass seit 1964 ausschließlich Berufsmusiker als Dirigenten verpflichtet wurden, die das Qualitätsniveau ständig verbessern konnten. Ernst-Josef Mester, der die Musiker 10 Jahre lang bis zum Ende des 40. Jubiläumsjahres 1992 dirigierte, wurde als Dank und Anerkennung zum Ehrendirigenten ernannt. Seit 1999 ist der studierte Musiker Thomas Zerbes (geb. Emons-Gast) Chefdirigent. Die musikalische Leistung des Blasorchesters Neuhonrath wurde 2019 beim Deutschen Musikfest in Osnabrück von der Jury mit „sehr gut“ bewertet. Das Deutsche Musikfest, das nur alle sechs Jahre stattfindet, ist eines der größten musikalischen Ereignisse in Deutschland und zählt für die Blas- und Spielleutemusik zu den bedeutendsten Musikfestivals. Zum 50 jährigen Vereinsjubiläum haben Gregor und Ludger Frielingsdorf die Vereinsgeschichte in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter festgehalten, siehe Dokument. | |
|
1994
- 2008 Die Naafmühle am Naafbach ist eine der am vollständigsten erhaltenen Wassermühlen im Rhein-Sieg-Kreis. Sie war noch bis in die 1980er Jahre in Betrieb und wurde schon im 16. Jahrhundert erwähnt. Bereits in der Ploennis-Karte des Herzogtums Berg aus... Die Naafmühle am Naafbach ist eine der am vollständigsten erhaltenen Wassermühlen im Rhein-Sieg-Kreis. Sie war noch bis in die 1980er Jahre in Betrieb und wurde schon im 16. Jahrhundert erwähnt. Bereits in der Ploennis-Karte des Herzogtums Berg aus dem Jahre 1715 ist sie eingezeichnet. Die heute erhaltene Bausubstanz ist jedoch wesentlich jünger. Neben dem unterschlächtigen Wasserrad auf der Südseite des Hauptgebäudes ist auch das Mühlwerk der Getreidemühle mit zwei Mahlwerken vollständig erhalten. Es ist im südwestlichen Teil des Hauptgebäudes untergebracht. Früher wurde nur Schrot fü Viehfutter gemahlen. Nach dem 2. Weltkrieg stellte man um auf Mehl. Die Naafmühle wird auch Bleifelder Mühle genannt. Die Familie Bleifeld erwarb die Mühle Ende des 19. Jahrhunderts von den Eheleuten Christoph Merklinghaus und Anna-Katharina geb. Kirschbaum. Alle anderen Mühlen im Naafbachtal - Ingersaueler Mühle, Weeger Mühle, „Groninger oder Gromicher Mühle“, „Noffertmühl“ oder Frackenpohl’s Mühle gibt es nicht mehr. Lange Zeit war zu befürchten, nachdem der Aggerverband das Mühlenanwesen gekauft hatte, dass auch die letzte Mühle im Naafbachtal abgerissen wird und der geplanten Trinkwassertalsperre zum Opfer fällt. Die Pläne zum Bau der Talsperre sind weitestgehend vom Tisch. Es wurde gerade noch rechtzeitig in den Substanzerhalt des wertvollen Denkmals „Naafmühle“ investiert, zuletzt durch die Oberbergische Gesellschaft zur Hilfe für psychisch Behinderte mbH (OBG) mit Sitz in Gummersbach, die im Spätsommer 2007 hier mit einer Jugendwohngemeinschaft einzog. Inzwischen sind die Gebäude privat vermietet. In dem Dokument ist die Geschichte der Naafmühle und der Mühlen des Naafbachtals zusammengetragen.
| |
Eine teuflische Geschichte zur Naafmühle im Naafbachtal wurde in einem schon älteren Schulheft entdeckt. Mit ziemlicher Sicherheit stammt die Überlieferung von Konrektor Josef Grunenberg, der bis 1963 in Lohmar wirkte und im Pützerhof im alten... Eine teuflische Geschichte zur Naafmühle im Naafbachtal wurde in einem schon älteren Schulheft entdeckt. Mit ziemlicher Sicherheit stammt die Überlieferung von Konrektor Josef Grunenberg, der bis 1963 in Lohmar wirkte und im Pützerhof im alten Kirchdorf wohnte. Anders als bei der Sage über die Gebermühle, hat die Geschichte allerdings ein „Happy End“. Fein säuberlich noch in alter Sütterlinschrift (nach dem gleichnamigen Schulmann 1865–1917) ist zu lesen: »So geschehen an einem Freitage vor dem Namensfeste des Kirchenpatronns St. Bartholomäus auf dem Berge Anno Domini 1543 zu Naaf an der Korn- und Oel-Mühle verbürgt durch alte Leute. Zu mitternächtlicher Stunde polterte ein Mann mit dem Fuße an die Türe der Mühle mit einem Malter (altes Korn- und Mehlmaß) Gold und Silber Perlen und Edelsteinen. Der Müller »Dreckes (Heinrich) zo Heide« fragte den Fremden nach seinem Begehren. Der sagte alles gehört Dir, wenn Du mir nach deren Tode die Seelen Deiner drei Töchter Anna, Edelgard und Gertrude verschreibest. Der Pächter der Mühle des Johann zu Doerp (Haus Dorp) zündete eilig eine Kerze an und rückte mit einem Krutzifixe in der Hand dem Fremden mit einem garstig Fell, Krallen an den Fingern, einem Pferdehufe und Hörnern auf dem Kopfe zu Leibe. Dieser entfleuchte Angesichtes des Herren Jesu in einer Wolke von Feuer und Schwefel über die Klausen. Dabei verlor er in weitem Bogen alle die dargebotenen Schätze. Der Müller, sein Weib und seine schönen Töchter blieben fromme Leute alle Zeiten. Wer noch heute an einem Tage vor Bartholomä mit dem Kreuze und einer Kerze um Mitternacht zur Mühle geht, kann des Teufels wilde Flüche hören, und wenn er festen Glaubens ist in den Mühlenteichen und unter dem Mühlrade ein Klümpchen Goldes oder einen Edelstein finden.« Bei älteren Einwohnern der benachbarten Dörfer und Höfe geht vereinzelt noch heute die Mär um, in der Bartholomäusnacht zum 24. August trieben Geister mitunter im Bachgrund der Naaf ihr Unwesen.
| |
|
2019
Das Arma Christi Kreuz in Algert wurde zwischen 1790 und 1800 angefertigt und aufgestellt. Der Schöpfer des Kreuzes ist nicht bekannt, aber vermutlich ein hiesiger Handwerker. Man geht davon aus, dass die Stifter des Kreuzes die ehemaligen Besitzer... Das Arma Christi Kreuz in Algert wurde zwischen 1790 und 1800 angefertigt und aufgestellt. Der Schöpfer des Kreuzes ist nicht bekannt, aber vermutlich ein hiesiger Handwerker. Man geht davon aus, dass die Stifter des Kreuzes die ehemaligen Besitzer des Gutes „Haus Freiheit“ in Inger sind. Das Arma - Christi – Kreuz, gelegentlich auch als Waffen - Christi - Kreuz, Passionskreuz oder Kapuzinerkreuz bezeichnet, ist eine Besonderheit der religiösen Kunstgeschichte. Arma-Christi-Kreuze finden sich an Außenwänden von Kirchen und als Flurdenkmäler hauptsächlich in den katholischen Gebieten des süddeutschen Raumes und vereinzelt auch im Rheinland. Bis zum 12./13. Jahrhundert dienten dargestellte Leidenswerkzeuge Christi als Triumph- und Majestätszeichen. Ab dem 14. Jahrhundert ist ein Bedeutungswandel zu beobachten: Die abgebildeten Gegenstände dienten nunmehr der "Passionsfrömmigkeit", dem meditativen Nacherleben der Passion Christi. Seit 1983 steht das Kreuz in Algert unter Denkmalschutz. Es wurde mehrmals restauriert und stand nach der Restaurierung im Jahr 1985 bis 1989 in der evangelischen Auferstehungskirche in Siegburg. Nicht zuletzt durch den Einsatz des Birker Heimatvereins und in Folge einer gerichtlichen Auseinandersetzung bis hin zum OVG Münster wurde es wieder an seinem angestammten Platz in Algert errichtet. Zuletzt wurde das Arma-Christi-Kreuz 2019 aufwendig durch den Diplom-Restaurator Karl Heinz Kreuzberg, Köln aufgearbeitet und mit tatkräftiger Hilfe von Karl Heinz Weiler und Willi Klinkenberg von der Algerter Dorfgemeinschaft und Gerd Streichardt, ehemaliger Vorsitzender des HGV Lohmar, wieder aufgestellt, siehe Dokument. Leidenssymbole:
| |
Die erste urkundliche Nennung für Wahlscheid finden wir am 6.11.1121, als Erzbischof Friederich I. von Köln die schriftlich vorliegenden Verfügungen Abt Kunos I von Siegburg, die dieser zum besseren Unterhalt der sich ständig vergrößernden Zahl der... Die erste urkundliche Nennung für Wahlscheid finden wir am 6.11.1121, als Erzbischof Friederich I. von Köln die schriftlich vorliegenden Verfügungen Abt Kunos I von Siegburg, die dieser zum besseren Unterhalt der sich ständig vergrößernden Zahl der Mönche getroffen hatte, bestätigt: „Nunc itaque de elemosina dicendum est: de Walescheit, quod…". Woher der Name Wahlscheid sich ableitet, ist nicht eindeutig geklärt. Vermutlich kommt Wahl von den Personennamen „Walho oder Walo“ her. Scheid könnte die Bedeutung Grenze, (Wasser-) Scheide oder auch Gemarkungsgrenze haben.In späteren Urkunden sind unterschiedliche Schreibweisen festgehalten. In einem Protokoll vom 20.6.1586 ist die Besichtigung eines Weges von Walscheidt zur Sülzer Brücke, durchgeführt von Wilhelm Nesselroet und Vertretern des „Kirchspeiß Walscheydt beschrieben. In der ältesten Bevölkerungsstatistik aus dem Jahr 1816 heißt es dagegen Walscheid. 1927 wird der Auelerhof, Aggerhof, Müllerhof und Fliesengarten in Wahlscheid umbenannt. Der Ort wird ein Dorf mit 250 (2017: 3125) Einwohnern. Der 2016 verstorbene Studiendirektor und Heimatforscher Wilhelm Pape ist in seinem Buch "Siedlungs- und Heimatgeschichte der Gemeinde Lohmar" der Entstehung der 225 Ortsnamen und deren geschichtlichen Entwicklung nachgegangen - auch dem Ortsnamen Wahlscheid -, siehe Dokument.
| |
Im Jahr 2021 blicken wir zurück auf den Spatenstich vor 70 Jahren am 5. Mai 1951 für das evangelische Altenheim „Mathildenstift“ auf dem Rösemig an der Mathildenstraße in Wahlscheid. Straßenname und Stift erinnern an den Wunsch des Spenders Wilhelm... Im Jahr 2021 blicken wir zurück auf den Spatenstich vor 70 Jahren am 5. Mai 1951 für das evangelische Altenheim „Mathildenstift“ auf dem Rösemig an der Mathildenstraße in Wahlscheid. Straßenname und Stift erinnern an den Wunsch des Spenders Wilhelm Frackenpohl aus Kreuznaaf. Er schenkte am 27. Mai 1903 der Evangelischen Kirchengemeinde Wahlscheid sein Wohnhaus an der Wahlscheider Hauptstraße im Aggerhof mit Garten- und Ackerland, insgesamt 26,12 Ar, verbunden mit 10.000 Mark. Laut notarieller Urkunde soll die Stiftung zum Gedächtnis an die Ehefrau des Wilhelm Frackenpohl »Mathilden-Stift« genannt werden. Der Zweck der Stiftung soll sein, würdigen, alten und schwachen Menschen der Kirchengemeinden Wahlscheid und Honrath sowie der katholischen Kirchengemeinde Neuhonrath Aufnahme zu gewähren. Am 14. Dez. 1951 war die Einweihung. Vier Monate zuvor war der Evangelische-Altenheim Wahlscheid e. V. – der heutige Träger - ins Vereinsregister eingetragen worden. In den Folgejahren wurden immer wieder Erweiterungsbauten vollzogen. 1965 kam eine eigene Hauskapelle „Zum guten Hirten“ dazu. 2003 erfolgten umfassende Neu und Umbauten und zuletzt wurde 2014 der zweite Bauabschnitt des Altenpflegeheims in Lohmar an der Bachstraße fertiggestellt. Wilhelm Pape hat 2002 in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter die Fakten festgehalten, siehe Dokument. | |
|
1924
- 2008 Die Sage von der Teufelsmühle (Gebermühle) im Jabachtal, geht zurück auf eine Erzählung von Richard Busch im Siegburger Kreisblatt von 1924. Sie handelt von der Gebermühle, die sich vor 300 Jahren auch Bicher- oder Bachermühle nannte, und in uralter... Die Sage von der Teufelsmühle (Gebermühle) im Jabachtal, geht zurück auf eine Erzählung von Richard Busch im Siegburger Kreisblatt von 1924. Sie handelt von der Gebermühle, die sich vor 300 Jahren auch Bicher- oder Bachermühle nannte, und in uralter Zeit des schwarzen Wenzels Teufelsmühle war. Der schwarze Wenzel hatte die Stückers Bärbel aus Winkel geheiratet. In der Brautnacht hörte man ein seltsames Spiel von einem schwarzen Geiger, der oben auf dem Dachfirst saß. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes entdeckte Bärbel, dass der schwarze Wenzel einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hatte und seine Kinder im Mühlbach ertränkte, um seinen Reichtum zu erhalten. Die unglückliche Müllerin sprang vor Schmerz und Trauer in die tiefe Mühlenklause und schrie: „Ja, Bach, in deinen kalten Armen trugst du meines Lebens Sonne hinweg! Ja, Bach, du! – Ja – Bach!“ man nannte den Mühlenbach von da an den Jabach, welchen Namen er noch heute trägt.
| |
Die Lohmarer Mühle in der unteren Buchbitze am Auelsbach gelegen war eine oberschlächtige Wassermühle, d. h. das Mühlrad wurde durch das Wasser von oben her angetrieben. Das Wasser kam aus dem künstlich angelegten Mühlbach, der ab dem Wiesental... Die Lohmarer Mühle in der unteren Buchbitze am Auelsbach gelegen war eine oberschlächtige Wassermühle, d. h. das Mühlrad wurde durch das Wasser von oben her angetrieben. Das Wasser kam aus dem künstlich angelegten Mühlbach, der ab dem Wiesental „Saure Wiese“, wo die beiden Bäche Kröhlenbach und Holzbach sich trafen, in das Speicherbecken, die sogenannte Klause führte. Die Mahlmühle gehörte zu den Kameral-Gütern des Herzoglich-Bergischen Amtes Blankenberg. 1907 kaufte Jean Pilgram das Mühlenanwesen. 1974 wurde die Mühle abgerissen und durch ein neues Gebäude ersetzt. In einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter hat Heinz Müller 1992 die wechselvolle Mühlengeschichte beschrieben, siehe Dokument. | |
Im einem lichten Laubwald an der B56 bei Heide finden sich, teilweise versteckt unter Laub, die Reste einer V1-Stellung aus dem Jahr 1944. Mit dem auch Vergeltungswaffe 1 genannten Marschflugkörper versuchte das NS-Regime in den letzten... Im einem lichten Laubwald an der B56 bei Heide finden sich, teilweise versteckt unter Laub, die Reste einer V1-Stellung aus dem Jahr 1944. Mit dem auch Vergeltungswaffe 1 genannten Marschflugkörper versuchte das NS-Regime in den letzten Kriegstagen, die sich abzeichnende Niederlage hinauszögern. | |
Glocken gehören zur Kirche wie das Amen zum Gebet. In Europa fanden sie ab dem 7.Jahrhundert durch iroschottische Wandermönche eine größere Verbreitung. Die Missionare waren für den Gebrauch schmiedeeiserne Handglocken bekannt. Im Mittelalter wurden... Glocken gehören zur Kirche wie das Amen zum Gebet. In Europa fanden sie ab dem 7.Jahrhundert durch iroschottische Wandermönche eine größere Verbreitung. Die Missionare waren für den Gebrauch schmiedeeiserne Handglocken bekannt. Im Mittelalter wurden die Glockentürme der Gemeindekirchen zum Wahrzeichen vieler Orte. Die Lohmarer Kirche Sankt Johannes hatte bereits sehr früh Glocken und das Läuten der Glocken geschah zu allen möglichen Anlässen. Aus dem Weistum (historische Rechtsquelle) des Erbenwaldes geht hervor, dass 1494 der Küster in der „Eckernzeit“ morgens als Zeichen für den gemeinschaftlichen Austrieb der Schweine zur Eichelmast die Betglocke läutete. Im Jahr 1828 wurden unter Pfarrer Wilhelm Joseph von Lieser drei neue Glocken beschafft. In den Zeiten der beiden Weltkriege mussten die Glocken lange schweigen. Im Ersten Weltkrieg wurden in Deutschland 65.000 Glocken zu Kanonen umgegossen. Viele Kirchengemeinden betrachteten das „Glockenopfer" als einen patriotischen Akt. Nachdem auch die Glocken von Sankt Johannes eingeschmolzen worden waren, wurden 1928 neue Glocken zusammen mit der Glocke für die Halberger Kapelle St. Isidor eingeweiht. Die beiden großen Glocken wurden wiederum Kriegsopfer im zweiten Weltkrieg. Die Nazis ließen über 100.000 Glocken einschmelzen, um daraus Kriegsgerät herzustellen. Am 16. Dezember 1951 wurden die beiden Glocken durch zwei neue ersetzt und rechtzeitig zum Weihnachtsfest von Dechant Dr. Becker eingeweiht. Die nunmehr vorhandenen Glocken tragen lateinische Inschriften, die sich mit Fürbitten an „Sanctus Johannes“, „Sancta Maria“ und „S. Barbara“ richten. Auch heute noch schweigen manchmal die Glocken. In der Osterzeit wird in der katholischen Kirche von Gründonnerstag bis in die Osternacht das Glockengeläut eingestellt. Nach der Volkslegende fliegen die Glocken in der Zwischenzeit nach Rom, um den Ostersegen des Papstes zu erhalten. Der verstorbene Lohmarer Ehrenbürger Bernhard Walterscheid-Müller hat in einem Mundartvortrag festgehalten, was seine Mutter „et Liss´je“ den Kindern erzählte: „Dat Jröndonnechdaach, wenn se en de Mess et Gloria senge, och de Jlocke don verklenge, öm no Rom ze vleeje….Am Ostesamsdaach – Nomedaach – kömense wedde heem, die Jlocke… Öm ze saare dat morje Ostere wöe.“ Wilhelm Pape hat 1988 die Geschichte des Kirchturms und der Glocken der Pfarrkirche in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter beschrieben, siehe Dokument.
| |
|
2016
Die Tradition, vor der eigenen Haustür im Fluss zu baden, ist weitgehend Geschichte. Bis etwa 1900 diente das Baden im Fluss der Körperreinigung. Erst 1896 wurden die beiden ersten Badeanstalten an der Sieg in Siegburg eröffnet. Nach Ende des ersten... Die Tradition, vor der eigenen Haustür im Fluss zu baden, ist weitgehend Geschichte. Bis etwa 1900 diente das Baden im Fluss der Körperreinigung. Erst 1896 wurden die beiden ersten Badeanstalten an der Sieg in Siegburg eröffnet. Nach Ende des ersten Weltkrieges 1918 setzte entlang der Agger im Lohmarer Stadtgebiet ein regelrechter Badeboom ein. Ausflügler aus Köln zog es im Sommer zu Tausenden an die Agger. Mit Polizeiverordnungen und festgelegten Badestellen wurden Auswüchse des Badelebens bekämpft. Die Bürgermeister Fritz Pilgram von Lohmar und Max Koch von Wahlscheid bestätigten 1933 dem Landrat des Siegkreises, dass das Baden jetzt einigermaßen geordnet ablief. 1934 gab es in Lohmar drei offizielle Badeplätze: Am so genannten Dornhecker Loch unterhalb Büchel, am Weidchesdamm unterhalb der Sülzmündung und in den Erlen zwischen Lohmarer Brücke und Rudersport. In der Bürgermeisterei Wahlscheid gab es zwei Badeplätze: Die Badestelle Thurnisauel von der Fabrik Aggerhütte abwärts bis zum Thurnisaueler Steg und die Badestelle vom Wahlscheider Sportplatz am sogenannten Scheiderkümpel bis zum Schluss der Schiffahrter Ley. Nach dem zweiten Weltkrieg sank das Interesse der Menschen am Baden in den Flüssen. Es entstanden die Schwimmbäder mit Ihren Becken und Wasserraufbereitungsanlagen.
| |
Von der versunkenen Burg auf dem Scharfeberg erzählte der ehemalige Lohmarer Schulrektor Karl Schmidt in den 1920er Jahren seinen Schülern. Die Sage handelt vom Fluch einer armen Witwe, die mit ihren drei Kindern in einer Hütte in Euelen wohnte und... Von der versunkenen Burg auf dem Scharfeberg erzählte der ehemalige Lohmarer Schulrektor Karl Schmidt in den 1920er Jahren seinen Schülern. Die Sage handelt vom Fluch einer armen Witwe, die mit ihren drei Kindern in einer Hütte in Euelen wohnte und auf Geheiß des Burggrafen die Hütte räumen musste. In ihrer Wut und Verzweiflung sprach sie einen schaudervollen Fluch aus. Daraufhin tat sich der Boden des Berges auf und die Burg versank in der Tiefe. Der Scharfeberg mit einer Höhe von 130 Meter liegt an der Mündung der Sülz in die Agger. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde hier Bergbau betrieben und Kupfererze abgebaut. Ca. 50 Meter unterhalb der Sülzmündung und 10 Meter über der Talsohle lag der Stolleneingang, der einen Erzgang in einer Länge von 11 Meter aufschloss. Weitere 500 Meter südwestlich lag ein Kupfererz führender Gang, der zum Bergwerk „Kant“ der Mittelrheinischen Kupferbergbau-Gesellschaft aus Berlin gehörte. Eine weitere Bedeutung erhielt der Scharfeberg Mitte der 1930er Jahre: Im Zuge des Autobahnbaus wurde für die Anschüttung des Erdwalls der Berg abgetragen. Ein Wanderweg führt heute über die Bergkuppe. Die Hintergründe und Quellen der Sage sind in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter 1987 beleuchtet. (siehe Dokument, Lohmarer Sagen).
| |
|
2017
Im Juni 1930 wurde mit dem Bau der Aggerbrücke in der Nähe der Donrather Kreuzung begonnen. Sie sollte die alte gemauerte Fünfbogenbrücke ersetzen. Die ausführende Firma Bonhagen und Schenk aus Siegburg arbeitete Tag und Nacht, um die Brückenpfeiler... Im Juni 1930 wurde mit dem Bau der Aggerbrücke in der Nähe der Donrather Kreuzung begonnen. Sie sollte die alte gemauerte Fünfbogenbrücke ersetzen. Die ausführende Firma Bonhagen und Schenk aus Siegburg arbeitete Tag und Nacht, um die Brückenpfeiler mit den Widerlagern vor dem nächsten Hochwasser fertigzustellen. Das Bauwerk wurde innerhalb des Zeitplans fertiggestellt und die Firma Dunkel aus Lohmar konnte danach die Anbindung des Straßendammes der neuen Sülztalstraße an die Brücke durchführen. Den Bau der Brücke und die Verlegung der Straßenführung der Sülztalstraße von Donrath bis zur Abzweigung nach Altenrath hatte die Provinzverwaltung aufgrund veränderter Verkehrsverhältnisse gefordert. Die Pläne stießen bei den Pützrather Einwohnern auf heftigen Widerstand. Der Baubeginn verzögerte sich hierdurch. Fertiggestellt wurde die Sülztalstraße Ende 1930. Die alte Donrather Brücke stürzte 1940 in Folge eines Hochwassers ein. Durch die neue Straßenführung entstand die Donrather Kreuzung. Die Jabachtalstraße, die vorher an der Fuchsfarm in Richtung Lohmar abbog, wurde bis zur Kreuzung ausgebaut.
| |
|
1994
Bereits zweimal versuchte eine Gruppe von Frauen und Männern aus Birk die wertvollen Reliquien aus der Siegburger Servatiuskirche nach Birk zu holen. Der Reliquienschatz gilt als einer der bedeutendsten romanischen Kirchenschätze. Nach der... Bereits zweimal versuchte eine Gruppe von Frauen und Männern aus Birk die wertvollen Reliquien aus der Siegburger Servatiuskirche nach Birk zu holen. Der Reliquienschatz gilt als einer der bedeutendsten romanischen Kirchenschätze. Nach der napoleonischen Säkularisation hatte der Düsseldorfer Präfekt im Jahr 1812 entschieden, die kostbaren Kunstschätze aus Siegburg in die Kirche nach Birk zu übergeben. Als eine Birker Abordnung im Mai 1812 die Schätze abtransportieren wollte, spielte sich laut Notiz im Siegburger Pfarrarchiv Folgendes ab: „Und siehe da, in der sicheren Überzeugung, dass die Pfarrkirche am Fuße des Abteiberges ein näheres Anrecht auf die unschätzbare Hinterlassenschaft der verwüsteten Mutterkirche besäße, treten die wackeren Siegburger in Massen zusammen, heben sofort die schon verladenen Reliquienschreine von den Karren und weisen den superklugen Birkern nicht ohne Gegenwehr jene Stelle, wo die Stadtmauer eine Öffnung hatte.“ Unter der Führung von Dr. Jörn Hansen wurde 1994 ein erneuter Versuch, getarnt als Sommerwanderung des Heimatvereins, unternommen. Der Birker Gruppe stellte sich vor dem Portal der Servatiuskirche in Siegburg wehrhaft Dechant Msgr. Johannes Schwickerath ( † 3.08.2020) entgegen. Schließlich einigte man sich auf einen Kompromiss und die Birker erhielten für ihr Bürgerhaus eine Bronzeskulptur und eine Reliefplatte, die an die Streitereien aus dem Jahre 1812 erinnern.
| |
|
August 2005
Ein unvergessenes Großereignis fand vom 15. bis 20. August 2005 in Lohmar statt. 3000 ausländische, überwiegend italienische Jugendliche waren hier Gäste im Rahmen des Weltjugendtages in Köln.1986 wurde zum ersten Mal auf Initiative von Papst... Ein unvergessenes Großereignis fand vom 15. bis 20. August 2005 in Lohmar statt. 3000 ausländische, überwiegend italienische Jugendliche waren hier Gäste im Rahmen des Weltjugendtages in Köln.1986 wurde zum ersten Mal auf Initiative von Papst Johannes Paul II. ein Weltjugendtag veranstaltet. Seitdem findet er jedes Jahr und alle 2 – 3 Jahre als internationaler Weltjugendtag statt. 2005 war Deutschland auserkoren. An der Abschlussmesse im Marienfeld zwischen Kerpen und Frechen mit Papst Benedikt nahmen am Sonntag, 21. August ca. 1,2 Millionen Menschen teil. Die meisten der 3000 jungen Gäste in Lohmar waren in Klassenräumen der Realschule, der Hauptschule und der Grundschule Wahlscheid untergebracht, ca. 600 hatten ihre Schlafplätze in Privatquartieren. Sie wurden herzlich aufgenommen und gaben ebenso herzlich mit italienischem Temperament ein „ grazie mille“ für die Gastfreundschaft zurück. Viele freiwillige Helfer arbeiteten ehrenamtlich mit und auf einem Musikfest im katholischen Pfarrheim waren im Vorfeld Spenden gesammelt worden. Als erste große gemeinsame Veranstaltung fand montagabends die Marienfeier in der Jabachhalle statt, die in einer spontanen Polonäse aller Teilnehmer endete. Als letzte Veranstaltung vor der Abreise nach Köln wurde freitags ein Kreuz auf einem „Kreuzweg“ durch den Ort getragen und ein großes Abschiedsfest mit Musik auf dem Parkplatz an der Jabachhalle gefeiert. In dem Dokument sind die Ereignisse festgehalten.
| |
|
2008
- 2021 Ende 2020 berichtete der Lohmarer Stadtanzeiger über Pläne, das alte Werksgelände der Firma Kudla zwischen der Hauptstraße 31 und der Straße Am Bungert 13 in Lohmar abzureißen und mit einem Geschäftshaus und Mehrfamlienhäusern neu zu bebauen. Seit... Ende 2020 berichtete der Lohmarer Stadtanzeiger über Pläne, das alte Werksgelände der Firma Kudla zwischen der Hauptstraße 31 und der Straße Am Bungert 13 in Lohmar abzureißen und mit einem Geschäftshaus und Mehrfamlienhäusern neu zu bebauen. Seit 1936 war der Geschäftssitz der Firma an der Haupstraße 31. Die Firma Kudla Elektrobau blickt auf eine fast 100jährige Geschichte zurück (siehe Dokument). Fritz Kudla hatte sie 1924 gegründet. Nach seinem Tod 1955 leitete seine Tochter Charlotte mit ihrem Ehemann Hans Krämer den Betrieb. In dem neu errichteten Wohnhaus an der Hauptstraße befand sich im Erdgeschoss ein Geschäft mit Elektroartikeln und weißer Ware (Kühlschränke etc.). In einer neuen Produktionshalle Am Bungert wurde eine Stahlmastproduktion für die öffentliche Beleuchtung aufgebaut. Die Abteilung Elektroinstallation und Freileitung wurde größer. Die Produktion der Stahlrohrmaste wurde später in das Auelsfeld verlegt. Nach dem Tod von Hans Krämer 1974 trat sein Sohn Rainer Krämer mit in die Geschäftsführung ein. Bis 2005 blieb die Firma in dritter Generation im Familienbesitz. Dann übernahm Klaus Schmitz als persönlich haftender Gesellschafter das Unternehmen. Der Name Kudla Elektrobau GmbH & Co KG blieb erhalten. Der Firmensitz befindet sich einigen Jahren im Auelsweg. | |
|
2012
- 2021 Das Gut Lohmarhohn ist seit 2004 im Besitz von Joey Kelly, bekannt als Musiker (The Kelly Family) und Extremsportler. Es wurde 1512 erstmalig als ein Pfarrhof der katholischen Kirche St. Johannes Enthauptung zu Lohmar erwähnt und bis zur Verpachtung... Das Gut Lohmarhohn ist seit 2004 im Besitz von Joey Kelly, bekannt als Musiker (The Kelly Family) und Extremsportler. Es wurde 1512 erstmalig als ein Pfarrhof der katholischen Kirche St. Johannes Enthauptung zu Lohmar erwähnt und bis zur Verpachtung 1955 an die Steyler Missionare in St Augustin zuletzt von der Familie Johann Peter Küpper in drei Generationen landwirtschaftlich betrieben. Einige Kriegsflüchtlinge des zweiten Weltkrieges fanden hier vorübergehend Unterkunft, wie die Familie des 2019 verstorbenen Gemeindedirektors Albrecht Weinrich. Den “Steylern“ diente Lohmarhohn viele Jahre in erster Linie als Erholungsheim für ihre Ordensmitglieder. Aber auch die Bevölkerung feierte hier viele Feste, wie das Feuerwehrfest an den Pfingsttagen auf der Wiese mit den Baracken, die 1955 aufgestellt worden waren und von denen eine vorübergehend als Notkapelle diente. 1956 wurde eine neue Kapelle fertiggestellt und am Ostermontag eingeweiht. Hier fanden Eucharistiefeiern auch für die Öffentlichkeit statt und Brautpaare wurden getraut. Als letzter verbliebener Pater verließ Bruder Josef Rech 2004 das Anwesen. Ihn kannten viele Lohmarerinnen und Lohmarer. Er lebte hier seit 1976 ununterbrochen.
| |
|
1984
Die Karnevalssession 2020/21 fühlte sich an, als wäre am 11.11. Aschermittwoch. Der Lockdown wirkte nicht nur gegen die Ausbreitung des Coronavirus, sondern auch gegen den „virus carnevalis“. Die Ausübung eines Brauchtums, das in Lohmar und Umgebung... Die Karnevalssession 2020/21 fühlte sich an, als wäre am 11.11. Aschermittwoch. Der Lockdown wirkte nicht nur gegen die Ausbreitung des Coronavirus, sondern auch gegen den „virus carnevalis“. Die Ausübung eines Brauchtums, das in Lohmar und Umgebung schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts seinen Anfang mit Tanzveranstaltungen und Kostümbällen nahm, war lahmgelegt. Die ersten Karnevalsitzungen fanden in den 1920er Jahren statt, in Birk (1928) und Lohmar (1929) wurden Prinzen präsentiert. In den Jahren nach dem Ende des zweiten Weltkrieges kam das Karnevalstreiben mit Sitzungen, Prinzenproklamationen und Rosenmontagszügen so richtig in Schwung. 1946 wurde die älteste Lohmarer Karnevalsgesellschaft „Ahl Jecke“ und 1948 der Karnevalistenzirkel KAZI Lohmar, der aus den Reihen des 1919 gegründeten Sportvereins Lohmar hervorging, gegründet. Karnevalisten wie Heinrich Schwellenbach und Paul Zimmermann („ De Schwan“) waren in den 1950er Jahren über die Grenzen Lohmars bekannt und begeisterten mit ihren Auftritten. Die Karnevalsprinzen sind in Lohmar seit 1952 vom Vereinskomitee und seit 1972 in Birk vom Ortsring erfasst. Bernhard Walterscheid Müller schildert das Auf und Ab des Karnevaltreibens in seinen Erinnerungen 1984 (siehe Dokument). Seine Schlussworte: „Wie in den vergangenen Jahrzehnten möge auch weiterhin der sorgenbefreiende Ruf ertönen: Luhme Alaaf“ konnten in Zeiten der Corona Pandemie nicht passender sein. | |
Seit Januar 2021 bilden die evangelischen Kirchengemeinden Lohmar, Birk und Honrath zusammen die Evangelische-Emmaus-Gemeinde. In der Präambel der neuen Satzung heißt es: „Die Gemeindebereiche Birk, Honrath und Lohmar bilden zusammen die Evangelische... Seit Januar 2021 bilden die evangelischen Kirchengemeinden Lohmar, Birk und Honrath zusammen die Evangelische-Emmaus-Gemeinde. In der Präambel der neuen Satzung heißt es: „Die Gemeindebereiche Birk, Honrath und Lohmar bilden zusammen die Evangelische Emmaus-Gemeinde Lohmar. Gemeinsam wollen sie evangelische Kirche in der Stadt Lohmar sein ….. Eine Kirchengemeinde und mehrere Gemeindebereiche, viele Glieder und eine Einheit im Geist.“ Die Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Honrath mit ihren Pfarrern, angefangen von Pfarrer Pistorius 1519 bis hin zur heutigen Pfarrerin Barbara Brill-Pflümer, ist im Findbuch der Kirchengemeinde, das der damalige Archivpfleger Gerhard Stief 2016 fertiggestellt hat, enthalten - Überarbeitungen kommen von seinem Nachfolger Hans-Georg Decker (siehe Dokument).
| |
Am 6. Januar 1121 taucht der Ort Wahlscheid erstmalig in einer Urkunde des Abtes Kuno der Abtei Siegburg auf. In dem Urkundentext wird Wahlscheid zweimal erwähnt als „de Walescheit“ bzw. „de Walscheit“. Zur Erinnerung daran wurde im Rahmen der... Am 6. Januar 1121 taucht der Ort Wahlscheid erstmalig in einer Urkunde des Abtes Kuno der Abtei Siegburg auf. In dem Urkundentext wird Wahlscheid zweimal erwähnt als „de Walescheit“ bzw. „de Walscheit“. Zur Erinnerung daran wurde im Rahmen der Wahlscheider Kirmes 1971 das 850 jährige Jubiläum groß gefeiert. Kirmesmontag fand der Umzug der Ortsvereine statt mit dem Tross des Verkehrs- und Verschönerungsvereins in napoleonischen Uniformen und anschließend das traditionelle Schörreskarrenrennen. Im Mittelpunkt des Festes stand der ökumenische Gottesdienst am Kirmessonntag (29. August) unter der musikalischen Begleitung der vereinigten Männergesangsvereine Wahlscheid, Honrath und Höffen und des Bergischen Bläser-Corps Neuhonrath. Die Festrede (siehe Dokument) hielt Realschuldirektor Otto Treptow. Otto Treptow, der Anfang September 2010 im Alter von 85 Jahren verstarb, war ein passionierter Heimatforscher. Neben der Geschichte Wahlscheids untersuchte er bereits seit den 1950er-Jahren die Frühgeschichte des Siegburger Raumes. Als er gebeten wurde, die Festrede “850 Jahre Wahlscheid“ zu halten, wusste er nicht, dass zur Geschichte der Gemeinde Wahlscheid so gut wie keine Vorarbeiten existierten. Er konnte nicht ahnen, dass die wichtigsten Originalquellen für Wahlscheid verlorengegangen waren. Trotzdem gelang es ihm, jene Zeit aufzuhellen, für die schriftliche Überlieferungen kaum vorhanden sind. Wenn in den früheren Urkunden von „Walscheit“ die Rede ist, so ist damit das Gebiet bezeichnet, dass vor 1000 durch Rodung von anderen Gebieten klar abgegrenzt war: Von der Agger im Westen bis zur Naaf im Osten und von Kreuznaaf im Süden und bis Oberschönrath im Norden. Drei Grundherrn teilten sich den Besitz auf. Es war die Abtei auf dem Michaelsberg in Siegburg, die Grafen von Sayn und das Kloster Meer als größter Grundbesitzer mit seinem Haupthof, dem Münchhof. Oben auf dem Berg an der Bartholomäuskirche mit Marktplatz und Linde war lange Zeit der Kern des kirchlichen und gemeindlichen Lebens. Der Mittelpunkt von Wahlscheid verlagerte sich in dem Augenblick ins Tal als zum ersten Mal in den 20er Jahren die Kirmes am Auelerhof ausgerichtet wurde. Nicht unerwähnt ließ Otto Treptow die Nachbargemeinde Honrath, die bereits 1117 als „villa Hagenroth“ urkundlich festgehalten ist, und die wechselvolle Geschichte, durch die die beiden Gemeinden seit 850 Jahren verknüpft sind. | |
Im Rahmen der allgemeinen Bewegung des „Cäcilienverbandes für die Länder der deutschen Sprache“ von 1868 gründete sich 1882 der Katholische Kirchenchor Lohmar. 1882 begann als erster Chorleiter der 21jährige Roland Piller, mit einer Schar von Sängern... Im Rahmen der allgemeinen Bewegung des „Cäcilienverbandes für die Länder der deutschen Sprache“ von 1868 gründete sich 1882 der Katholische Kirchenchor Lohmar. 1882 begann als erster Chorleiter der 21jährige Roland Piller, mit einer Schar von Sängern Chorgesänge einzustudieren und in Gottesdiensten vorzutragen. Im Ersten Weltkrieg (1914-1918) wurden viele Männer zum Kriegsdienst eingezogen. In den Jahren danach belebte sich das Chorgeschehen wieder. 1930 musste Roland Piller seine Tätigkeit wegen Krankheit beenden. 130 Jahre Chorgeschichte hat Hans Josef-Speer 2012 in einem Artikel für die Lohmarer Heimatblätter festgehalten, siehe Dokument.
| |
|
1984
Im Jahr der Corona Pandemie 2020 gelten für Silvester erhebliche Kontaktbeschränkungen. Maximal fünf Personen aus zwei Hausständen dürfen sich im öffentlichen Raum treffen. Der Verkauf und Erwerb von Feuerwerkskörpern ist untersagt. In den 1930er... Im Jahr der Corona Pandemie 2020 gelten für Silvester erhebliche Kontaktbeschränkungen. Maximal fünf Personen aus zwei Hausständen dürfen sich im öffentlichen Raum treffen. Der Verkauf und Erwerb von Feuerwerkskörpern ist untersagt. In den 1930er Jahren hätte es solcher Verbote jedenfalls in den ländlichen Gegenden nicht bedurft. Überschäumende Silvesterfeste mit großem Feuerwerk um Mitternacht waren nicht üblich und auch nicht finanzierbar. Am Neujahrstag wurden nach dem Kirchgang auf den Straßen und bei Besuchen von Haus zu Haus die Neujahrsgrüße ausgetauscht. Dienstbare Geister wie Briefträger und Zeitungsbote erhielten ein "Neujöeche" (kleines Trinkgeld). Wie die Lohmarer Urahnen den Jahreswechsel begingen ist nur spärlich berichtet. Aus einem Gedingeprotokoll vom 6. Januar 1671 ist zu entnehmen, dass sich die Walderben des Lohmarer Erbenwaldes am Silvestertag des Jahres 1670 vor der Kirchenhalle auf dem Lohmarer Friedhof getroffen hatten und beschlossen, zukünftig alle Jahre das Waldgedinge (Waldgeding = Genossenschaft) nicht mehr am letzten Dezembertag im kalten Winter abzuhalten, sondern am ersten Montag nach der Kreuzfindung (3. Mai). Der Erbenwald war über ein Jahrtausend eine der wichtigsten Existenzgrundlagen der genossenschaftlich verbundenen Lohmarer Einwohner und einiger Bewohner benachbarter Orte. 1968 war das Ende des Erbenwaldes. Mit etwas mehr als eine Millionen DM wurden die waldberechtigten Lohmarer Bürger entschädigt und der Forst wurde zum Gemeindewald. In dem Dokument sind die Erinnerungen an Silvester aus früherer Zeit festgehalten. | |
Am 24. Dezember von 11.00 bis 12.00 Uhr wird auf dem Kalvarienberg in Neuhonrath von einem Bläserensemble aus dem Blasorchester Neuhonrath ein kleines Weihnachtskonzert zur Erinnerung an Johannes Höver gegeben. Johannes Philipp Höver (1816 – 1864)... Am 24. Dezember von 11.00 bis 12.00 Uhr wird auf dem Kalvarienberg in Neuhonrath von einem Bläserensemble aus dem Blasorchester Neuhonrath ein kleines Weihnachtskonzert zur Erinnerung an Johannes Höver gegeben. Johannes Philipp Höver (1816 – 1864) aus Oberste Höhe ist Stifter der Ordensgenossenschaft der Armen Brüder des hl. Franziskus. Fast in Vergessenheit geraten, wurde ihm zu Ehren 1985 wenige Tage vor der Kirchweih, der „Baacher Kirmes“ in Neuhonrath auf dem Kalvarienberg ein Denkmal an seinem ehemaligen Schulweg von Oberstehöhe nach Neuhonrath gesetzt.
| |
|
1984
In seinem Buch „Heimatliche Winterzeit“ erinnert sich Bernhard Walterscheid-Müller (1918 - 19191) an die Chirstmesse am 25. Dezember 1930. Früh um 4.30 Uhr läuteten schon die Glocken der Kirche Sankt Johannes in Lohmar. Der 1930 wiedergegründete... In seinem Buch „Heimatliche Winterzeit“ erinnert sich Bernhard Walterscheid-Müller (1918 - 19191) an die Chirstmesse am 25. Dezember 1930. Früh um 4.30 Uhr läuteten schon die Glocken der Kirche Sankt Johannes in Lohmar. Der 1930 wiedergegründete Kirchenchor hatte unter der Leitung des Organisten und Dirigenten Thomas Kappes mehrstimmige Lieder eingeübt. Der Innenraum der Kirche war mit großen Tannenbäumen geschmückt, die brennende Lichter trugen. Der Kirchenschweizer Karl Nüchel hatte Mühe die vielen Besucher unterzubringen. Lesen Sie den weiteren Ablauf in dem Dokument „Die Christmesse“. | |
Mit einer Gedächtnisausstellung im Jahr 2001 wurde Wilfriedo Becker, sein Wirken als künstlerischer Dokumentarist geehrt. Neben der künstlerischen Bedeutung haben zahlreiche Bilder der Sammlung auch großen heimatgeschichtlichen Wert. Zeigen die... Mit einer Gedächtnisausstellung im Jahr 2001 wurde Wilfriedo Becker, sein Wirken als künstlerischer Dokumentarist geehrt. Neben der künstlerischen Bedeutung haben zahlreiche Bilder der Sammlung auch großen heimatgeschichtlichen Wert. Zeigen die Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Skizzen doch oft Häuser, Dorfwinkel, Brücken, Wege, Wälder und Flussauen, die heute nicht mehr existieren oder sich völlig verändert darstellen. Aus dem am 11. Februar 1886 in Donrath geborenen Maler, Zeichner und Hobbypoeten wurde ein beachtenswerter Chronist seiner Heimat. Er entwarf auch das heutige Stadtwappen. Wilfriedo Becker arbeitete hauptberuflich im Bürgermeisteramt Lohmar. Dort hatte er 1901 eine Lehrstelle angetreten. Die Belegschaft des Amtes bestand damals aus dem Bürgermeister einem Sekretarius, dem Rentmeister und einem Straßenarbeiter. Bis ins hohe Alter war er ein stattlicher Mann. Er verstarb am 29. August 1979. Sein Lebensweg und sein Wirken sind einem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter festgehalten, siehe Dokument. | |
|
2020
Eigentlich hätte der Kunstkreis LohmArt e. V. in 2020 mit der 10. Mitgliederjahresausstellung in der Kunsthalle in Scheiderhöhe, Scheiderhöher Straße 42 ein kleines Jubiläum feiern können. Doch die Corona Pandemie hat alle Pläne durchkreuzt. 2011... Eigentlich hätte der Kunstkreis LohmArt e. V. in 2020 mit der 10. Mitgliederjahresausstellung in der Kunsthalle in Scheiderhöhe, Scheiderhöher Straße 42 ein kleines Jubiläum feiern können. Doch die Corona Pandemie hat alle Pläne durchkreuzt. 2011 hatte der Kunstverein die ehemalige Turnhalle von der Stadt Lohmar übernommen. In vielen Arbeitsstunden und mit finanzieller Unterstützung einiger Sponsoren wurde die für den Abbruch vorgesehene Halle renoviert und zu einer attraktiven Kunst- und Ausstellungshalle umgebaut. Erst drei Jahre zuvor war der Verein „Kunstkreis LohmART e. V.“ gegründet worden, hervorgegangen aus einer Initiative einer Gruppe von Künstlern der "Lokale Agenda 21, Lohmar" und bereichert seitdem die Kunstszene in der Stadt. Die 1. Vorsitzende Martina Furk hat eine kleine Vereinschronik zusammengestellt, siehe Dokument. | |
|
1995
- 2020 Algert ist ein Ort im südlichen Stadtgebiet und liegt knapp 4 km östlich von Lohmar entfernt. Es gehörte bis 1969 zur amtsangehörigen Gemeinde Inger. Der Name Algert taucht erstmalig in den Aufzeichnungen der 1503 gegründeten Birker... Algert ist ein Ort im südlichen Stadtgebiet und liegt knapp 4 km östlich von Lohmar entfernt. Es gehörte bis 1969 zur amtsangehörigen Gemeinde Inger. Der Name Algert taucht erstmalig in den Aufzeichnungen der 1503 gegründeten Birker Marienbruderschaft auf. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Name Aldenacher auf Algert hinweist und erstmalig in einer Urkunde vom 16. Mai 1395 erwähnt wird. Darin gibt Kunigunde Aldenacher bekannt, dass sie Ländereien des Kirchspiels Lohmar in Erbpacht nimmt. Es gab zu dieser Zeit wohl zwei Höfe unter dem Namen "Aldenacher". Mit der Dorfhistorie setzt sich ausführlich Wilhelm Pape in seinem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter im Jubiläumsjahr 1995 (siehe Dokument) auseinander. Als "großen Sohn unserer Heimat" beschreibt der Heimatforscher Heinrich Hennekeuser Bertram Orth, der 1848 in Algert 14 (heute Bungartsberg 19) geboren wurde. 1872 erhielt er die Priesterweihe und war anschließend als Missionar und Pfarrer in Oregon, USA tätig. Nach seiner Bischofsweihe 1900 wurde er 1903 zum Erzbischof von Vancouver in Kanada ernannt. Gestorben ist er in Fiesole/Italien am 4. Februar 1931. Ein Fenster in der Birker Marienkirche erinnert an Ihn.
| |
|
1994
- 2012 Der Ort Münchhof liegt ca. 500 m östlich der evangelischen Kirche in Wahlscheid an der Bartholomäusstraße. Der Ort Münchhof liegt ca. 500 m östlich der evangelischen Kirche in Wahlscheid an der Bartholomäusstraße. Die Geschichte des Münchhofes und der Bürgermeister "Schmitz" sind in dem Dokument (Artikel Lohmarer Stadtanzeiger von Otto Treptow und Lohmarer Heimatblätter 26 von Elisabeth Klein) zusammengefasst.
| |
|
1981
Während in Birk 2010 das 700jährige Jubiläum gefeiert wurde und Wahlscheid 2021 auf sein 900jähriges Bestehen zurückblicken kann - Wahlscheid wird 1121 als Wahlescheit zum ersten Mal in einer Urkunde des Abtes Kuno I. der Abtei Siegburg erwähnt - ,... Während in Birk 2010 das 700jährige Jubiläum gefeiert wurde und Wahlscheid 2021 auf sein 900jähriges Bestehen zurückblicken kann - Wahlscheid wird 1121 als Wahlescheit zum ersten Mal in einer Urkunde des Abtes Kuno I. der Abtei Siegburg erwähnt - , wurde in Lohmar bereits 1981 das 900jährige Bestehen als größtes Fest der Stadtgeschichte gefeiert. Die älteste, bekannte Lohmarer Urkunde stammt aus dem Jahr 1081, in der Erzbischof Sigewin dem Georgsstift zu Köln einen Grundbesitz von einem „mansus“ (ca. 30-40 Morgen Ackerland) in „Lomere“schenkte.
| |
|
1925
- 2015 Zur Erinnerung an die Kriegstoten und Gewaltopfer aller Nationen wird seit 1952 zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag der Volktrauertag begangen. Seit 1922 ist er ein staatlicher Gedenktag. In der Nazi-Zeit wurde er als "Heldengedenktag"... Zur Erinnerung an die Kriegstoten und Gewaltopfer aller Nationen wird seit 1952 zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag der Volktrauertag begangen. Seit 1922 ist er ein staatlicher Gedenktag. In der Nazi-Zeit wurde er als "Heldengedenktag" gefeiert. Öffentliche Gedenkstätten stehen sowohl in Lohmar als auch in Birk und in Wahlscheid. Berichte in den Lohmarer Heimatblättern zu den Gedenkstätten in Lohmar sind als Dokument zusammengefasst.
| |
|
2006
Warum die bekannte Lohmarer Karnevalgruppe "Lühmere Murrepinn" schon lange vor Corona nicht mehr auftrat, ist in deren Chronik festgehalten. Sie wurde 2006 mit einem letzten Auftritt dem HGV Lohmar übergeben. Zur Überraschung aller Jecken trat bei der Jubiläumsfeier der KAZI-Funken Rut-Wieß am 10. Elften 1979 eine Männergruppe auf und trug Karnevalslieder vor, die sich auf Lohmar bezogen. Sie löste wahre Beifallsstürme aus. Ihre Zugabe "Lühmere Mädche sin bang" wurde zum Hit des Lohmare Karnevals. Im Jahr der 900 Jahrfeier Lohmars 1981 schrieb Bernhard Walterscheid-Müller "Dat Lühmere Murrepinnleed" nach der Melodie "En d´r Kayjaß Nummer Null". Im Mai 1991 wurden die Auftritte zur Geschichte, als die "Murrepinn" in der Gaststätte Bergschänke beschlossen aufzuhören.
| |
|
1993
- 2020 Hatte noch im Jahr 2019 Daniel Schwamborn (Brandoberinspektor bei der Lohmarer Feuerwehr) als St. Martin hoch zu Roß den größten Sankt Martinszug in der Stadt Lohmar mit über 1000 Teilnehmern angeführt, teilte Anfang November 2020 die Waldschule... Hatte noch im Jahr 2019 Daniel Schwamborn (Brandoberinspektor bei der Lohmarer Feuerwehr) als St. Martin hoch zu Roß den größten Sankt Martinszug in der Stadt Lohmar mit über 1000 Teilnehmern angeführt, teilte Anfang November 2020 die Waldschule Lohmar in einem Schreiben an die Schuleltern mit, dass der traditionelle Martinszug leider nicht stattfindet. Der Martinszug, der seit 1926 von der Freiwilligen Feuerwehr organisiert wird, wurde wie andere Brauchtumsveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Damit das Brauchtum an St. Martin nicht ganz zum Erliegen kommt, feiert die Waldschule, wie auch andere Schulen und Kindergärten, den Martinstag am 11.11.2020 in ihrer Einrichtung und verteilt die Martinswecken, die von der Lohmarer Feuerwehr gespendet werden.
| |
In den Zeiten der Lockdowns wegen der Corona-Pandemie befürchten viele Gastronomiebetriebe, dass sie die Einschränkungen wirtschaftlich nicht überleben werden. Im Jahre 2020 kann niemand voraussehen, wie das Angebot an Gaststätten in den nächsten... In den Zeiten der Lockdowns wegen der Corona-Pandemie befürchten viele Gastronomiebetriebe, dass sie die Einschränkungen wirtschaftlich nicht überleben werden. Im Jahre 2020 kann niemand voraussehen, wie das Angebot an Gaststätten in den nächsten Jahren aussieht und ob das "Kneipensterben" dramatisch zunimmt. Viele Jahrhunderte waren sie Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Sigfried Helser hat in seinem Buch "Wie et fröhe woe" für den Wahlscheider Raum beschrieben, wie reich gesegnet die Dörfer mit Gasthöfen waren und hat vieles in Bildern und Anekdoten festgehalten. Ehemalige Gasthäuser mit großen Sälen wie "Zur schönen Aussicht" und Restaurant und Pension Honrath in Honrath oder der Schlehecker- und Wickuhler Hof finden sich ebenso wieder wie ehemalige gemütliche Gasthäuser "Höck" in Schachenauel (Neuhonrath) und Restaurant Vierkötter in Durbusch. Heute noch haben der Aggerhof, Auelerhof, "Haus auf dem Berge", Naafshäuschen, Stolzenbach und "Zur alten Linde" großen Zulauf.
| |
Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatten die Städter ein starkes Erholungsbedürfnis . Nach dem Bau der Eisenbahnlinie im Jahre 1884 kamen viele Stadtbewohner zur Sommerfrische nach Wahlscheid. Während die Gaststätte Aggerhof nur über 2... Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatten die Städter ein starkes Erholungsbedürfnis . Nach dem Bau der Eisenbahnlinie im Jahre 1884 kamen viele Stadtbewohner zur Sommerfrische nach Wahlscheid. Während die Gaststätte Aggerhof nur über 2 Doppelzimmer und 1 Einzelzimmer verfügte, konnten im Auelerhof einschließlich der 2 Dependancen 50 bis 60 Gäste untergebracht werden. Nach dem 1. Weltkrieg setzte in Wahlscheid ein reges Badeleben ein. Die Wirte und der Verkehrsverein drangen damals sehr auf den Bau eines Freibades. In einem Bericht von Bürgermeister Koch aus dem Jahr 1929 habe man allein auf dem Badeplatz Wahlscheid 418 Personen gezählt. Ein Auszug aus einem Wanderbericht von 1900 aus dem Heft "Wanderungen im unteren Aggerthal" von Joseph von der Höhe ist als Dokument festgehalten. Unter dem Pseudonym schrieb Peter-Josef Kreuzberg (1873 - 1939) aus Klasberg. Die Wanderung beginnt in Donrath und geht über Kreuznaaf, Auelerhof, Schloss Auel, Naafshäuschen bis Neuhonrath. Als kleine Episode ist darin der Aufenthalt des Kölners Wilhelm Koch (1845 - 1891), einem der ersten populären Kölner Mundartdichter, im Naafshäuschen beschrieben.
| |
Viele Menschen haben in Zeiten der Corona-Pandemie wieder das Wandern und die Erholung in der näheren Umgebung entdeckt. Lohmar und Umgebung war schon vor über 100 Jahren als Naherholungsgebiet begehrt. 1909 gab der Verschönerungsverein Lohmar einen... Viele Menschen haben in Zeiten der Corona-Pandemie wieder das Wandern und die Erholung in der näheren Umgebung entdeckt. Lohmar und Umgebung war schon vor über 100 Jahren als Naherholungsgebiet begehrt. 1909 gab der Verschönerungsverein Lohmar einen Wanderführer heraus. Tourenvorschläge mit Beschreibungen der Sehenwürdigkeiten und einer Wanderkarte führten durch die Bürgermeisterei Lohmar. Finanziert wurde die Broschüre durch 31 Werbeanzeigen.
| |
Im Jahr 2020 erinnerten wir an 75 Jahre Ende des 2. Weltkrieges. Im Jahr 2022 werden wir an diese Zeiten durch den Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine erinnert. Die Kriegsfolgen von damals hatten erhebliche Auswirkung für die Gemeinschaft... Im Jahr 2020 erinnerten wir an 75 Jahre Ende des 2. Weltkrieges. Im Jahr 2022 werden wir an diese Zeiten durch den Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine erinnert. Die Kriegsfolgen von damals hatten erhebliche Auswirkung für die Gemeinschaft in der Stadt Lohmar. Vertreibung, Flucht, Integration sind die prägenden Themen. Hans Warning hat die Fakten für das ehemalige Amt Lohmar in dem Dokument zusammengetragen. Viele Millionen Menschen verloren durch den von Nationalsozialisten entfesselten Krieg ihre Heimat. Auch das Gebiet der heutigen Stadt Lohmar nahm viele Vertriebene und Flüchtlinge auf. Lohmar erreichte nicht nur einen Bevölkerungszuwachs von etwa 20 Prozent, sondern auch das Zahlenverhältnis der christlichen Konfessionen wurde deutlich verändert. Die Entstehung der evangelischen Kirchengemeinde Lohmar ist geprägt von den Auswirkungen des 2. Weltkrieges nach1945. In Wahlscheid hielt bereits 1557 der evangelische Glaube seinen Einzug. 1614/15 nahm auch Honrath die lutherische Lehre an. Zusammen mit Seelscheid und Volberg (Hoffnungstahl) bildeten sie die 4 lutherischen bergischen Kirchengemeinden. 1645 wurde der letzte katholische Pfarrer Heinrich Klee verdrängt. Erst im Jahre 1710 entstand für die in Honrath und Wahlscheid lebenden Katholiken eine Missionsgemeinde, die von den Minoriten in Seligenthal betreut wurde. Die Schulbildung war gekennzeichnet durch ausgiebige Diskussionen um die Bekenntnisschulen. Erst mit der Schulreform 1968 nahm das Thema ein Ende, als die Gemeinschaftsgrundschulen und die Hauptschulen eingeführt wurden.
| |
|
1969
- 2011 Nach der Kommunalverfassung kann Persönlichkeiten, die sich um die Gemeinde besonders verdient gemacht haben, das Ehrenbürgerrecht verliehen werden. Die Stadt Lohmar hat bisher (2020) sechs Personen mit dieser höchsten Ehrung ausgezeichnet. Fünf... Nach der Kommunalverfassung kann Persönlichkeiten, die sich um die Gemeinde besonders verdient gemacht haben, das Ehrenbürgerrecht verliehen werden. Die Stadt Lohmar hat bisher (2020) sechs Personen mit dieser höchsten Ehrung ausgezeichnet. Fünf Ehrenbürger sind leider verstorben. Der noch lebende Ehrenbürger Dr. Hans Günther van Allen erhielt die Ehrenbürgerrechte der Stadt Lohmar am 16. Mai 2008. Er war von 1975 - 1985 Bürgermeister.
| |
|
1992
Seit 1979 widmet sich der Heimat- und Geschichtsverein Lohmar dem Vogelschutz im Lohmarer Wald durch das Aufhängen und die Betreuung von Nistkästen. Die traditionelle Nistkastensäuberung 2020 fand am 10. Oktober statt. 5 Helfer-Gruppen hatten sich... Seit 1979 widmet sich der Heimat- und Geschichtsverein Lohmar dem Vogelschutz im Lohmarer Wald durch das Aufhängen und die Betreuung von Nistkästen. Die traditionelle Nistkastensäuberung 2020 fand am 10. Oktober statt. 5 Helfer-Gruppen hatten sich aufgeteilt und kümmerten sich um insgesamt 165 Nistkästen. Die inzwischen verstorbenen Vereinsmitglieder Josef Faßbender und Günther Bremer hatten die Aktion ins Leben gerufen, die seit vielen Jahren von Wolfgang Weber fortgeführt und organisiert wird. Er begleitet bei der Säuberungsaktion die Familiengruppe und erzählt den teilnehmenden Kindern, aber auch den Erwachsenen Interessantes und Wissenswertes über unsere heimische Tier- und Vogelwelt. Anhand der Nestformen und des Nistmaterials werden die "Bewohner" bestimmt und in Bestandslisten erfasst. Die Nistkästen werden auch gerne von anderen Tierarten, wie Siebenschläfer, Wald- und Fledermäusen genutzt. Über die vielen Jahre ergibt sich so ein guter Einblick in diese Tierwelt. Im Wesentlichen kommen folgende Vogelarten vor: Kohlmeise; Blaumeise; Tannenmeise; Haubenmeise; Sumpfmeise, Weidenmeise, Baumläufer und Kleiber. Highlight für die Kinder ist natürlich, einen Siebenschläfer aufzuspüren und die aufgefundenen Vogeleier einer Vogelart zuzuordnen. In Berichten für die Lohmarer Heimatblätter ist die Historie der "Nistkästen" festgehalten. Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus 30 Jahren Vogelschutzarbeit wurden 2009 sogar wissenschaftlich bewertet und sind in einem Bericht für die Lohmarer Heimatblätter von Dr. Bernd Freymann und Wolfgang Weber nachzulesen. Auch der Frage nach Auswirkungen des Klimawandels wurde nachgegangen. Es hat sich gezeigt, dass der Nutznießer der Erderwärmung der Siebenschläfer ist und der Verlierer die Kohlmeise. Die Artikel in den Lohmarer Heimatblättern sind als Dokument zusammengefasst. | |
Anfang Oktober ist die Zeit der Erntedankfeste. Leider fallen diese Traditionsveranstaltungen wegen der Korona Pandemie in 2020 aus. Erntedank gab es schon in vorchristlicher Zeit. Einen einheitlichen Termin gab es nicht, außer in der Zeit des... Anfang Oktober ist die Zeit der Erntedankfeste. Leider fallen diese Traditionsveranstaltungen wegen der Korona Pandemie in 2020 aus. Erntedank gab es schon in vorchristlicher Zeit. Einen einheitlichen Termin gab es nicht, außer in der Zeit des NS-Regimes war der Erntedank per Gesetz festgelegt auf den ersten Sonntag nach Michaelis (29.September). In Lohmar findet das erste Erntedankfest traditionell Ende September statt. Es wird von der 1970 gegründetete Dorfgemeinschaft Scheid veranstaltet und hat in der Scheider Tenne beim "Onkel Hugo" seinen Mittelpunkt. Am ersten Oktoberwochenende lädt der Ernteverein Donrath von 1925 nach Donrath ein. Den krönenden Abschluss bildet das Erntefest des Bergischen Heimatvereins "Gemütlichkeit" Oberschönrath von 1896 in Wickuhl. Einmal im Jahr steht ganz Wickuhl Kopf, wenn die Menschen in Scharen den Erntezug sehen wollen und anschließend im Ort abfeiern. Deshalb hatte man 1990 die alte Veranstaltungsstätte die Gastätte "Zum Häuschen" in Oberschönrath durch ein großes Festzelt in Wickuhl ersetzt. Paul Fichtler hat 2011 in einem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter (siehe Dokument) die Geschichten und Anekdoten rund um das Erntedankfest, die Gastwirtschaft "Zum Häuschen" und den Bergischen Heimatverein zusammengetragen und erinnert an alte Zeiten, als 1894 aus Anlass eines Richtfestes und eines Geburtstages in einem Waldsiefen unterhalb des Weilers Knipscherhof die Gründungsstunde der Gesellschaft Gemütlichkeit schlug.
| |
Der erste Bürgermeister der Bürgermeisterei (Marie) Lohmar Freiherr Franz von Gumpertz von Güsten hatte seinen Sitz in der Burg Lohmar und Freiherr Franz von Broe als Bürgermeister von Wahlscheid im Schloss Auel. Die Bürgermeistereien (Marien) wurden... Der erste Bürgermeister der Bürgermeisterei (Marie) Lohmar Freiherr Franz von Gumpertz von Güsten hatte seinen Sitz in der Burg Lohmar und Freiherr Franz von Broe als Bürgermeister von Wahlscheid im Schloss Auel. Die Bürgermeistereien (Marien) wurden in der napoleonischen Besatzungszeit gebildet. Die ersten Bürgermeister unter der preußischen Regierung (ab 1814) waren für Lohmar Balthasar Schwaben, der sein Büro im Guttenhof (Eisenmarkt) hatte und Johann Balthasar Schmitz mit Sitz im Münchhof. In einem Beitrag im ersten Heft der Lohmarer Heimatblätter sind alle Bürgermeister und Amtssitze bis 1986 erfasst (siehe Dokument). Der letzte ehrenamtliche Bürgermeister war Rolf Lindenberg (1989 - 1994). Danach folgten die hauptamtlichen Bürgermeister Horst Schöpe (1994 -2004), Wolfgang Röger (2004-2014) und Horst Krybus (2014-2020). Mit der Stichwahl am 27.09.2020 wurde Claudia Wieja zur Bürgermeisterin in Lohmar gewählt. Seit der Kommunahlwahl 1999 wird nur noch ein hauptamtlicher Bürgermeister gewählt. In der Zeit von 1946 bis 1994 wurden die Städte und Gemeinden durch einen hauptamtlichen Stadt-/Gemeindedirektor (Leiter der Verwaltung) und einen ehrenamtlichen Bürgermeister (Repräsentant) geleitet. Zum ersten Mal rückt mit Claudia Wieja eine Frau an die Spitze der Stadt Lohmar. Am 1. November übernimmt sie für fünf Jahre die Amtsgeschäfte. Ihr Sitz ist das Rathaus in der Rathausstraße. Hier "residieren" die Lohmarer Bürgermeister seit dem Rathausneubau 1966.
| |
|
2013
- 2014 Nicht erst seit Zeiten der Corona Pandemie stellt sich bei vielen Gastronomiebetrieben die Frage nach der Zukunft . Viele Gaststättenbetreiber haben aufgegeben. Die Geschichte der Gaststätten des Birker Umlandes bis zum Jahr 2014 ist in Artikeln von... Nicht erst seit Zeiten der Corona Pandemie stellt sich bei vielen Gastronomiebetrieben die Frage nach der Zukunft . Viele Gaststättenbetreiber haben aufgegeben. Die Geschichte der Gaststätten des Birker Umlandes bis zum Jahr 2014 ist in Artikeln von Heinrich und Peter Hennekeuser für die Lohmarer Heimatblätter festgehalten. Das Gasthaus in der uns bekannten Form entwickelte sich im 19.Jahrhundert. In der Chronik des Birker Pfarres Dr. Aumüller für 1856 ist ausgeführt: "Die Einwohnerzahl im Dorf beträgt gegenwärtig hundertfünfzig, Gastwirtschaften vier!" In den 1950er Jahren gab es in der Birker Kirchengemeinde 11 Gaststätten bei über 1500 Einwohnern. Einige Kneipenschicksale seien kurz erwähnt: Auf dem heutigen Parkplatz an der kath. Kirche stand bis 1930 die Gaststätte und Schnapsbrennerei Scharrenbroich, die von dem Pfarrer Dr. Aumüller nach einer Piusversammlung (Papst PiusIX) 1869 als Piuslokal bezeichnet wurde. Am Standort der Gaststätte Fischer früher Schwamborn (Birkerstr.19) wurde bereits 1791 eine Schnapsbrennerei betrieben. Der Birker Korn entwickelte sich in den 1930er Jahren zum "Birker Nationalgetränk". Ebenso war bereits im frühen 19. Jahrhundert eine Gastwirtschaft an der Stelle der Gaststätte Fielenbach (Birker Straße 13). 1920 kaufte Josef Oligschläger das Anwesen, das dann 1952 von Hermann und Christine Fielenbach übernommen wurde. Die auch sehr bekannte Gaststätte Franzhäuschen bestand bereits 1850 und wurde 1913 von der Familie Anton Salgert übernommen und ausgebaut. In Krahwinkel gibt es die Gaststätte Klink bereits seit 1876. Bekannt wurde sie in den 1960er Jahren als "Bambusbar" mit einem durch Bambusstangen abgegrenzten Raum mit einer Musikbox. Geschlossen wurde 1977 die Gaststätte "Zum alten Panzer" in Geber, die mindesten seit 1864 in Betrieb war. Erhalten geblieben ist in der Nähe von Geber in Gebermühle das Gasthaus "Zum Jabachtal", das am 11.11. 1951 von dem Bierverleger Peter Demmer aus Salgert eröffnet wurde. Geschlossen wurde auch die traditionsreiche Gaststätte Wacker in Breidt, die 1893 eröffnet wurde und Anfang der 1960er Jahr von Franz Josef Wacker und Ehefrau Änni betrieben wurde. Franz-Josef war von 1961 - 1976 auch Bürgermeister der Gemeinde Breidt. Über weitere Gasthausschicksale lesen Sie in dem Dokument.
| |
|
2008
Das Dokument enthält zwei Sagen, die sich um die Burg Lohmar ranken. Sie sind zusammengetragen von Hans Dieter Heimig (Jahrgang 1942) und dem 1991 verstorbenen Bernhard Walterscheid Müller (Jahrgang 1918). Die wunderbaren Illustrationen stammen von... Das Dokument enthält zwei Sagen, die sich um die Burg Lohmar ranken. Sie sind zusammengetragen von Hans Dieter Heimig (Jahrgang 1942) und dem 1991 verstorbenen Bernhard Walterscheid Müller (Jahrgang 1918). Die wunderbaren Illustrationen stammen von Raimund Schüller (1950 - 2018). Sagen sind von Menschen überlieferte Berichte, die an bestimmte Ereignisse oder Tatsachen anknüpfen. Sie spiegeln die Vorstellungswelt der Vorfahren wieder und ihre Einstellung zum Leben. Die Sage "Alte Burg zu Lohmar" geht zurück auf Will Friedland (Siegburger Kreisblatt, 69.Jahrgang, Nr.198), der Lohmar in seiner Einleitung beschreibt: "Und kommst du über einen der Bergpfade her, so mutet sich das Dörfchen drunten im Tale an, wie ein Baum- und Blütenwerk gezaubertes, wunderliches Häusergenist, dessen Giebel verstohlen über den Baumgipfeln hervorlugen. Der Kirchturm nur gibt mächtiger und lauter von seinem Dasein Kunde". Bei der Überlieferung der zweiten Sage "De ongeerdesche Jäng en Luhme" haben viele alte Lohmarer mitgewirkt. Die Erzählungen sind vom Autor Bernhard Walterscheid-Müller zusammengefasst und auch ins Hochdeutsche übersetzt worden. Johannes Heinrich Kliesen ist 2004 der Frage nachgegangen, was dran ist an der Fama vom unterirdischen Geheimgang von der Burg aus bis zum Chor der katholischen Kirche, ob die zugemauerten Rundbögen der Burg zu einem Geheimgang führten. Sein Bericht ist in der Bilderreihe enthalten. | |
|
1959
- 2019 Auf Initiative der beiden Löschgruppen Birk und Breidt der Freiwilligen Feuerwehr Lohmar wurde im Juni 2019 das Friedenskreuz in Birk wieder aufgestellt. Es war nach 60 Jahren Anfang 2019 aus Sicherheitsgründen abgebaut worden. Das Eichenholz war... Auf Initiative der beiden Löschgruppen Birk und Breidt der Freiwilligen Feuerwehr Lohmar wurde im Juni 2019 das Friedenskreuz in Birk wieder aufgestellt. Es war nach 60 Jahren Anfang 2019 aus Sicherheitsgründen abgebaut worden. Das Eichenholz war marode geworden. Das neue Friedenskreuz aus Eichenholz hat die Ausmaße von 9 Meter des Längsbalken und 3,50 Meter des Querbalkens. Die Inschrift „CHRISTUS UNSER FRIEDEN“ sollte im neuen Kreuz nicht aus dem Holz herausgearbeitet werden, da dies die Lebensdauer negativ beeinflussen würde. Stattdessen wurden V4A-Bleche gelasert und gekantet. In einer Ökumenischen Feier fand die Neuerrichtung des Friedenskreuzes am 25.08.2019 unter großem Zuspruch der Bevölkerung einen feierlichen Abschluss. Das Friedenskreuz war damals das erste im Erzbistum Köln. Der Platz an der Ecke Pastor Biesingstraße /Auf der Löh war noch freies Feld. Die Bebauung kam später hinzu. Der Standort im Kreuzungsbereich der alten Wege von Birk nach Albach und von Inger nach Hochhausen ist uralt und bereits im Liegenschaftsbuch der steuerbaren Grundstücke der Gemeinde Inger von 1711 so bezeichnet „Aufm Lühe am Creutz“. Selbst die erste, exakte Kartenaufnahme der Rheinlande durch Tranchot und von Müffling von 1803-1820 weist diesen Punkt mit einem roten Kreuzchen nach. An der Stelle stand früher ein Heiligenhäuschen, das von einer mächtigen Trauerweide überragt wurde. Durch einen sommerlichen Wirbelsturm wurden beide 1958 zerstört. Auf Initiative von Pfarrer Otto Biesing sollte dort ein Friedenskreuz der Erzdiözese als neues Zeichen christlicher Gesinnung errichtet werden. Am 18.Oktober 1959 wurde das Kreuz feierlich eingesegnet. Von oben nach unten und von links nach rechts war die Inschrift in Kreuzesform tief eingeschlagen: CHRISTUS – UNSER FRIEDEN.
| |
|
2019
- 2020 Der Lohmarerer Fotokünstler Herbert Döring-Spengler wurde mit dem Rheinischen Kunstpreis 2020 des Rhein-Sieg-Kreises ausgezeichnet. Der Preis zählt zu den begehrtesten seiner Art für Künstlerinnen und Künstler im Rheinland. 417 Künstlerinnen und... Der Lohmarerer Fotokünstler Herbert Döring-Spengler wurde mit dem Rheinischen Kunstpreis 2020 des Rhein-Sieg-Kreises ausgezeichnet. Der Preis zählt zu den begehrtesten seiner Art für Künstlerinnen und Künstler im Rheinland. 417 Künstlerinnen und Künstler hatten sich beworben. Der Mensch ist der Mittelpunkt der Motive von Herber Döring Spengler, dessen Existenz er mit experimentellen fotografischen und zeichnerischen Werkserien ausgeleuchtet und in überraschenden Bildern festgehalten hat, stellt die Preisjury in ihrer Begründung fest. Döring-Spengler hat seit 2008 sein Atelier in Lohmar, im hellblauen Haus KiLo an der Hauptstraße 119a. Die Stadt hatte das Haus, das nach dem 2. Weltkrieg als Flüchtlingsunterkunft diente und wo vorübergehend Gemeindedirektor (1968 -1980) Weinrich mit seiner Familie wohnte, 1989 erworben. Nachdem die Stadt zunächst das stark sanierungsbedürftige Haus abreißen wollte, hat sie es dann aber Döring-Spengler überlassen. Er nutzt es seitdem als Atelier und für Kunstausstellungen. Aus Anlass des 75. Geburtstages und des 40. Jubiläums als Fotokünstler erschien in den Lohmarer Heimatblättern 2019 ein Artikel über das Haus KiLo in der Lohmarer Hauptstraße und den Künstler Herbert Döring- Spengler, siehe Dokument. | |
Das Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf meldete gegen diesen Beschluss des Gemeinderates Bedenken an: „Die im unteren Teil des Wappens befindliche Deichsel ähnelt zu sehr einem Meßgewand.“ Der Rat blieb bei seinem Beschluss und erhielt schließlich am 9.3.1972 die Genehmigung des Regierungspräsidenten in Köln, das Wappen zu führen. Darüber amüsiert zeigte sich 2008 der Kölner Kardinal Joachim Meisner, als ihm Bürgermeister Wolfgang Röger bei einem Empfang im Rathaus davon erzählte. Die Geschichte des Lohmarer Stadtwappens erzählt Horst Nieß (bis Ende der 1990er Jahre Leiter des Hauptamtes der Stadt Lohmar) in einem Artikel der ersten Ausgabe der Lohmarer Heimatblätter von 1986, siehe Dokument. | |
|
2009
- 2012 Auf Initiative des Lohmarer Fotokünstlers Herbert Döring-Spengler wurde 2009 der Stolperstein als Mahnmal gegen das Vergessen verlegt. Der Stolperstein liegt im Gehweg der Hauptstraße in Höhe des Hauses Nr. 105 in der Nähe des Kreisels... Auf Initiative des Lohmarer Fotokünstlers Herbert Döring-Spengler wurde 2009 der Stolperstein als Mahnmal gegen das Vergessen verlegt. Der Stolperstein liegt im Gehweg der Hauptstraße in Höhe des Hauses Nr. 105 in der Nähe des Kreisels Bachstr./Auelsweg. Stolpersteine sind kleine Messingwürfel, die in vielen Orten Europas ins Straßenpflaster eingelassen sind. Sie sind Gedenktafeln für die Opfer des Nationalsozialismus. Der Lohmarer Stolperstein fand viele Jahre kaum Beachtung im Gehwegpflaster, da er farblich sehr dunkel geworden war. Im Januar 2020 hat die Projektgruppe "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" des Lohmarer Gymnasiums die Patenschaft über den Stein übernommen und Ihn gereinigt. Der Stein erinnert an den Juden Ernst Hoffmann, der dort wohnte. Das Haus ist heute abgerissen. 1844 hatte die Familie an der Bachstraße/Ecke Hauptstraße Grundbesitz erworben, vermutlich beiderseits des Auelsbachs. Die Parzellen sind in den Quellen nicht vollständig angegeben. Die Urgroßmutter Adelheid hatte hier einen Metzgerladen und einen Getreidehandel. Ernst Hoffmann war verheiratet. Über das Schicksal seiner Frau ist nichts bekannt. Sein Leidensweg führte von Lohmar nach Siegburg. Er flüchtete während des Krieges nach Holland, wurde hier verhaftet und ins Konzentrationslager nach Auschwitz gebracht und dort am 6.3.1944 getötet. Sein Sohn Oscar wurde 1942 nach Minsk deportiert und dort getötet. Von Holland schrieb er am 9.10.1942 an die ihm bekannte Familie Bernauer aus Troisdorf: „Daß ich von meinem lieben Oscar und der Mutter und den Geschwistern etc. nichts mehr gehört habe, ist an sich bei den bekannten Maßnahmen nichts Besonderes, dennoch ist dieses Ungewisse über das Schicksal meiner liebsten Menschen … so deprimierend, dass dies auf meiner Seele lähmend lastet …“ Die Stadtarchivarin Waltraud Rexhaus hat die Geschichte jüdischer Familien in Lohmar in einem lesenswerten Artikel der Lohmarer Heimatblätter (Dokument) festgehalten.
| |
|
1900
- 1938 Die Bilderdokumentation kommt aus dem Fundus von Eva-Maria Neumann vom "Artelier EMN" in der Altenratherstraße in Lohmar. Sie hat die Bildserie, die in einem kleinen Bilderkarton verpackt ist, im August 2020 dem Archiv des HGV Lohmar übergeben. Wer... Die Bilderdokumentation kommt aus dem Fundus von Eva-Maria Neumann vom "Artelier EMN" in der Altenratherstraße in Lohmar. Sie hat die Bildserie, die in einem kleinen Bilderkarton verpackt ist, im August 2020 dem Archiv des HGV Lohmar übergeben. Wer diese Bilderserie aufgegelegt und vertrieben hat ist nicht bekannt. Ebenso ist das Erscheinungsdatum nicht bekannt. Der Zweck dieser Auflage ist auf der Rückseite der Verpackung beschrieben. " Was einst war und was einst geschah, sind Stationen auf dem Weg zu uns. Schaun wir also dankbar zurück und damit zugleich über unsere Gegenwart hinaus in eine Zukunft, die wir selber mitgestalten und mitzuverantworten haben." | |
|
15. Mai 2019
Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Wahlscheid hatte für den 15. Mai 2019, 19:00 Uhr zu einer offenen Mitgliederversammlung in das Matthias-Claudius-Haus an der Ev. Kirche in Wahlscheid eingeladen: Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Wahlscheid hatte für den 15. Mai 2019, 19:00 Uhr zu einer offenen Mitgliederversammlung in das Matthias-Claudius-Haus an der Ev. Kirche in Wahlscheid eingeladen:
| |
Der südliche Teil des Lohmarer Waldes zwischen Lohmar und Siegburg ist ein von Wanderern und Radfahrern stark frequentiertes Erholungsgebiet. Besonders reizvoll sind die Teichlandschaften entlang der Wegestrecken. Wie diese Landschaft zur Zeit... Der südliche Teil des Lohmarer Waldes zwischen Lohmar und Siegburg ist ein von Wanderern und Radfahrern stark frequentiertes Erholungsgebiet. Besonders reizvoll sind die Teichlandschaften entlang der Wegestrecken. Wie diese Landschaft zur Zeit Beethovens in seinen Bonner Jahren (1770 – 1792) ausgesehen hat, beschreibt Ingmar Gorissen im Jahrbuch 2020 des Rhein Sieg Kreises. Etwa 30 % der Fläche würde Beethoven heute wohl kaum wiedererkennen. Einige Flächen haben sich auch ohne bauliche Maßnahmen dramatisch verändert. Viele Jahrhunderte gab es zwischen Siegburg und Lohmar eine zusammenhängende offene Heide- und Moorlandschaft über 500 Hektar groß. Sie war einzigartig im Rheinland. Der großflächig tonige Untergrund und einige Quellen waren ideal für eine unendliche Zahl an Teichen und Moorgewässern, sowie Sümpfen und Bruchwäldern. Nicht nur in den norddeutschen Hochmooren, sondern auch hier, wurde in dieser Zeit Torf gestochen. Vermutlich wurde auch vom zuständigen Kloster auf dem Michaelsberg der Gagelstrauch regelmäßig abgeerntet. Gagel war früher als „Brabanter Myrthe“ ein in vielerlei Hinsicht wichtiger Strauch: pharmazeutisch, Bier-Ersatz, Mottenkraut. Die Entwicklung dieser bedeutenden historischen Kulturlandschaft und das Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur hat Ralf Schneider in seinem Artikel „Weiher im Wertewandel“ für die Lohmarer Heimatblätter beschrieben. Ausführlich geht er auf das Geflecht zur ehemaligen Abtei auf dem Michaelsberg und dem Töpferhandwerk auf der Aulgasse ein. Sein Fazit: Mit seinen zahllosen Weihern präsentiert dieser Forstbezirk mit seiner Fülle naturkundlicher und standortspezifischer Highlights ein besonders typisches Identifikationsmerkmal der alten Abteistadt Siegburg und seines uralten Nachbardorfes der heutigen Stadt Lohmar. So wird an die Abtei auf dem Michaelsberg nicht nur der gleichnamige Berg mit seinen Gebäuden erinnern, sondern auch ein Teil der unter ihrem Einfluss entstandenen Kulturlandschaft.
| |
|
2017
- 2018 Die Kirche St Mariä Geburt in Birk ist eine der ältesten noch bestehenden Marienkirchen in der Umgebung. Mitte des 13. Jahrhunderts wurde an einen älteren romanischen Bau der schlanke frühgotische Chor (Altarraum) errichtet. Die Kirche St Mariä Geburt in Birk ist eine der ältesten noch bestehenden Marienkirchen in der Umgebung. Mitte des 13. Jahrhunderts wurde an einen älteren romanischen Bau der schlanke frühgotische Chor (Altarraum) errichtet.
| |
Aus diesem Verzeichnis lassen sich die Einwohner der Gemeinde Wahlscheid mit Namen und Berufen im Jahre 1934 entnehmen. Aus diesem Verzeichnis lassen sich die Einwohner der Gemeinde Wahlscheid mit Namen und Berufen im Jahre 1934 entnehmen. | |
Der nachstehende Zeitungsartikel zeigt, dass die Agger den Schachenauelern früher große Sorgen bereitete. Der nachstehende Zeitungsartikel zeigt, dass die Agger den Schachenauelern früher große Sorgen bereitete. | |
Oben rechts auf der Abbildung sieht man „de Baach“ mit Kreuzberg bzw. Kalvarienberg. Oben rechts auf der Abbildung sieht man „de Baach“ mit Kreuzberg bzw. Kalvarienberg. In Neuhonrath wohnten im Jahre 1871 insgesamt 31 Personen in 5 Häusern. | |
In 1871 wohnten im Aggerhof 77 Personen in 17 Wohngebäuden. Personen von links: 2. wahrscheinlich „Brass Hann“; 4. Gastwirt und Brennereibesitzer Peter Wester; daneben weitere Angehörige der Familie Wester; ganz rechts: Gustav Hohn, Aggerhof (Vater... In 1871 wohnten im Aggerhof 77 Personen in 17 Wohngebäuden. Personen von links: 2. wahrscheinlich „Brass Hann“; 4. Gastwirt und Brennereibesitzer Peter Wester; daneben weitere Angehörige der Familie Wester; ganz rechts: Gustav Hohn, Aggerhof (Vater der Gebrüder Otto und Emst Hohn). In dem „Brennes“ befindet sich heute eine Imbißstube. Der Dachaufbau ist nicht mehr vorhanden. Emst Hohn, Aggerhof, weiß noch, daß der Schornstein Stein für Stein abgebrochen wurde. Auf einer Riesenrutsche glitten die Steine nach unten. Der Hohner-Bach plätscherte damals noch durch den Aggerhof (heute verläuft der Bach vom Hause Dr. Lohmar bis zum Hause Boddenberg unterirdisch). Die auf dem Bild erkennbaren Schutzmauem (aus Sandstein) grenzten die Chaussee von dem Hohner-Bach ab. Auf den beiden Mauern ließ sich früher Wahlscheid’s Jugend gerne nieder. Hier legten die Katechumenen und Konfirmanden die mit einem Lederriemen zusammengebundenen Unterrichtsutensilien wie Bibel usw. ab, wenn sie auf Pfarrer Kauert warteten. Im „Mathilden-Stift“ (heutiges Wohnhaus des Emst Hohn), das noch im 2. Weltkrieg alte Menschen beherbergte (Vorgängerin des evangelischen Altenheimes), fand damals der Katechumenen- und Konfirmandenunterricht statt. Die „Pueschde“ (Burschen) von Wahlscheid machten sich ein Vergnügen daraus, in gebückter Haltung durch den Kanal unter der Straße zu laufen. Neben der rechts erkennbaren Mauer führte eine Treppe hinunter zum Hohner-Bach; hier kühlten die „Hohn’s Jonge“ die in Kannen befindliche Kuhmilch. Der Platz vor dem Aggerhof, den man in Anspielung auf den 3. Ehemann vom „Brass Hann“ im Volksmund auch „Nöres-Platz“ nannte, war unter den Nationalsozialisten zeitweise Propaganda-Zentrum. Zu Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft verfugten die wenigsten Haushalte über ein Radio. Andererseits legte Hitler Wert darauf, daß seine Reden auch den letzten Bewohner eines Dorfes erreichten. Um dies zu ermöglichen, installierten die Nationalsozialisten im Giebel des Aggerhofes einen Lautsprecher und ließen die Reden Hitlers über den Vorplatz durch die Straßen Wahlscheid’s erschallen. | |
|
1941
Links steht das „Heckhuusen-Huus“ des früheren Feld-(Land-) Messers Heckhausen. Das Haus wurde als Gaststätte und Metzgerei (Wilhelms,Klein und Zapp) genutzt.Vor Emil Wilhelms führte Josef Wester (ein Bruder von Peter W.) in dem Haus eine Gaststätte. ...Links steht das „Heckhuusen-Huus“ des früheren Feld-(Land-) Messers Heckhausen. Das Haus wurde als Gaststätte und Metzgerei (Wilhelms,Klein und Zapp) genutzt.Vor Emil Wilhelms führte Josef Wester (ein Bruder von Peter W.) in dem Haus eine Gaststätte. Nach dem 2. Weltkrieg waren die Gaststätten Klein und Leffelsender in Peisel als Fernfahrergaststätten sehr beliebt. Vor den beiden Häusern reihte sich LKW an LKW. Walter Steinsträßer hat erzählt, daß sich die jungen Turner auf ihrem Heimweg von den Übungsabenden im Auelerhof eine Wurst bei dem Metzger Wilhelms angelten. Dazu schoben sie einen Spazierstock durch das offene Oberlicht. Die Wurst wurde später auf dem „Kanal“ (Mauerbrüstung) am Hohnerbach im Aggerhof verzehrt. | |
Auf einem historischen Rundwanderweg des Heimat- und Geschichtsvereins führen uns Hermann Wenzel und Hans-Martin Pleuger von Höffen über Neuhonrath, Grünenborn, Saal, Ingersauel, Naaf, Heide (Aiselsfeld) nach Höffen. Auf dieser geschichtsträchtigen... Auf einem historischen Rundwanderweg des Heimat- und Geschichtsvereins führen uns Hermann Wenzel und Hans-Martin Pleuger von Höffen über Neuhonrath, Grünenborn, Saal, Ingersauel, Naaf, Heide (Aiselsfeld) nach Höffen. Auf dieser geschichtsträchtigen Wanderung kommt man an der Gaststätte „Auf dem Berge“ vorbei. Urkundlich erwähnt wurde das Haus erstmals 1829. Damals hieß die Gaststätte noch „Zum weißen Pferde“ und diente als Poststation für die Verbindung von Bonn nach Gummersbach. Die alten Poststraßen führten zu dieser Zeit hauptsächlich über die Höhenrücken, da die Flüsse und Bäche noch nicht reguliert waren. Es gab viel sumpfiges Gebiet. Hochwasser kam im Jahr häufig vor und versperrte den Weg. . Der Wanderweg passiert die recht unbekannte Hubertuskapelle und die katholische Pfarrkirche Sankt Mariä Himmelfahrt in Neuhonrath. Diese Kirche ist von 1732 bis 1738 erbaut worden, nachdem Honrath (um 1614) und Wahlscheid (um 1645) im Zuge der Reformation evangelisch geworden waren. Die Wanderung führt uns schließlich ins Naafbachtal, ins idyllische Ingersauel mit seinen vielen alten Fachwerkhäusern. Man wandert dort nun auf dem „Eisvogelweg“ des Sauerländischen Gebirgsvereins und dem Bergischen Streifzug Nr. 19 „Kräuterweg“ des Bergischen Wanderlandes und erreicht schließlich die denkmalgeschützte Naafer Mühle.Über Aiselsfeld führt der Weg dann wieder nach Höffen zurück. Die Streckenführung: Höffen, Krebsauel, Neuhonrath, Grünenborn, Saal, Ingersauel, Naaf, Heide (Aiselsfeld), Höffen Länge der Strecke: 9,1 km ohne Besichtigungen Höhenmeter: auf und ab: 267 m | |
Mit Beginn der Industrialisierung und dem Bevölkerungswachstum in Städten und Gemeinden nach dem II. Weltkrieg wurden Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen immer dringlicher. In größeren Städten waren Straßenreinigung und Müllabfuhr erst gegen... Mit Beginn der Industrialisierung und dem Bevölkerungswachstum in Städten und Gemeinden nach dem II. Weltkrieg wurden Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen immer dringlicher. In größeren Städten waren Straßenreinigung und Müllabfuhr erst gegen Ende des 19. Jhrdts. befriedigend. In vielen Gemeinden – so auch in Lohmar – gab es nur eine Kippe, teilweise wurde auch illegal der Müll auf der grünen Wiese abgelagert. Abfälle wurden bis zur Schaffung des ersten Abfallgesetzes 1972 neben der geordneten Hausmüllkippe meist in ungeordnete Deponien gebracht. Hohlwege, Bombentrichter und Erdgruben wurden verfüllt, aber auch Steilhänge und Böschungen wurden zur illegalen Entsorgung genutzt. Diese Müllkippen wurden in den 1940-1960er Jahren immer mehr zu einem Problem, Schwelbrände, seuchenhygienische Gefahren und Verunreinigungen des Grundwassers durch Sickerwasser waren die Hauptsorgen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Gemeindearbeiter Josef Bücher mit der Müllentsorgung beauftragt. Bücher wohnte im Ziegelfeld und fuhr täglich mit seinem Muli mit Karren durch Lohmar und entsorgte den Hausmüll. Er kippte diesen auf mehrere in Lohmar angelegte Deponien. Eine große Deponie war das von der Familie Höndgesberg stillgelegte Sandloch oberhalb der Schmiedgasse/Fichtenweg. Hier wurde auch Industriemüll von Lohmarer Firmen entsorgt. Eine weitere Deponie war in der heutigen Danziger Straße in Lohmar-Süd. Eine wilde Deponie befand sich zwischen Lohmar und Donrath an der damaligen Bahnstrecke, etwa wo heute die Straße „Zur Jabachbrücke“ in die Hauptstraße abzweigt. Oft wurden der Unrat und das Papier und der Kunststoff illegal abgebrannt. Wenn das Feuer zu stark wurde, griff oft die freiwillige Feuerwehr von Lohmar ein und kippte Löschwasser auf den Brand. Eine Nutzungsgebühr oder eine Genehmigung, um den Müll abzukippen, gab es nicht und so konnte jedermann nach Belieben seinen Dreck und Unrat dort entsorgen. Die Gemeinde Lohmar wuchs ständig und so beauftragte die Gemeindeverwaltung Lohmar zu Beginn der 1952er Jahre den Landwirt und Fuhrunternehmer Josef Becker mit der Entsorgung des Hausmülls. Josef Becker, damals 31 Jahre alt, fuhr mit Pferd und Karren an den Häusern vorbei und entleerte die Aschetonnen. Bezahlt wurde er damals von der Gemeinde Lohmar. Etwa im Jahre 1956 erwarb Becker einen Traktor, der das Pferd ersetzte und seine Arbeit erleichterte. Die Städte und Gemeinden rund um Lohmar hatten bereits staubfreie Mülleimer angeschafft und so wurde mit Schreiben der Gemeinde Lohmar am 1.10.1957 angekündigt, dass jeder Haushalt verpflichtet sei, einen staubfreien Mülleimer mit einem Inhalt von 35 Litern, alternativ von 50 Litern anzuschaffen. Die Anschaffungskosten lagen bei DM 17.50/35 l bzw. DM 19.50/50 l. Alternativ konnte man auch den Mülleimer auf Mietbasis erwerben. Ab dem Jahre 1958 war die Zeit der wilden Kippen endgültig Vergangenheit. Alle im Ort Lohmar befindlichen Deponien wurden geschlossen. Die Firma Broicher & Grünacher aus Overath setzte moderne Kippwagen ein und entsorgte über die neuen Mülleimer den häuslichen Unrat. Viel später erst gab es getrennte Mülltonnen für Grünabfälle/Papier und Kunststoffe. Heute entsorgt die RSAG AöR, Siegburg den Lohmarer Hausmüll. | |
|
2015
Fährt man von Lohmar nach Overath, kommt kurz nach Wahlscheid die Straße nach Hoffnungsthal. Biegt man in diese Straße ein, liegt etwa nach hundert Meter auf der linken Seite, ein wenig versteckt zwischen Sträuchern und Bäumen, ein wunderschönes... Fährt man von Lohmar nach Overath, kommt kurz nach Wahlscheid die Straße nach Hoffnungsthal. Biegt man in diese Straße ein, liegt etwa nach hundert Meter auf der linken Seite, ein wenig versteckt zwischen Sträuchern und Bäumen, ein wunderschönes Fachwerkhaus, das Wohnhaus des ehemaligen Gutes Rosauel. Die Geschichte dieses Hofes geht weit zurück ins Mittelalter, vermutlich bis ins vierzehnte Jahrhundert, als die Gegend hier besiedelt wurde. Höher gelegen und dadurch geschützt vor dem Hochwasser der Agger und in unmittelbarer Nähe eines Baches und von Teichen war die Lage des Hofes der ideale Siedlungsplatz. Der älteste nachgewiesene Eigentümer von Rosauel war die Familie von der Sülz zu Diepenthal. Die längste Zeit wurde das Gut landwirtschaftlich (Vieh, Getreide etc.) genutzt. Heute wird das Gut nach erfolgter Sanierung ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt. Elisabeth Klein stellt in ihrem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter die geschichtliche Entwicklung des Gutes Rosauel mit seinen Eigentümern und Pächtern vor. Berichtet wird auch über gesellschaftliche Höhepunkte, die z.B. in den 60/70er Jahren des letzten Jahrhunderts stattgefunden hatten: Mehr erfahren Sie in dem Beitrag von Elisabeth Klein. | |
Die Rundwanderung startet in Wahlscheid am Pompeyplatz verläuft über Neuhonrath, Honsbach und Honrath zurück nach Wahlscheid. Die Streckenlänge beträgt 12,9 km. Sie führt an Schauplätze, um die sich vier Sagen und Geschichten drehen, die uns unsere... Die Rundwanderung startet in Wahlscheid am Pompeyplatz verläuft über Neuhonrath, Honsbach und Honrath zurück nach Wahlscheid. Die Streckenlänge beträgt 12,9 km. Sie führt an Schauplätze, um die sich vier Sagen und Geschichten drehen, die uns unsere Vorfahren überliefert haben und vom HGV Lohmar in dem Buch Lohmarer Sagen und Geschichten festgehalten wurden: Der tapfere Bauer Stader von Neuhonrath, Das Teufelsloch zu Honsbach, De Aachehongk am Kammebärch und Joist Lünincks Brautfahrt. Die genaue Wegebeschreibung und die Erzählungen sind in dem Beitrag (Dokument) für die Lohmarer Heimatblätter festgehalten. | |
|
2015
In Deutschland sind zurzeit 81 Libellenarten heimisch. Ganz in unserer Nähe, in Lohmar und der angrenzenden Wahner Heide wurden in den letzten Jahren 53 verschiedene Libellenarten beobachtet, also 2/3 aller in Deutschland überhaupt vorkommenden... In Deutschland sind zurzeit 81 Libellenarten heimisch. Ganz in unserer Nähe, in Lohmar und der angrenzenden Wahner Heide wurden in den letzten Jahren 53 verschiedene Libellenarten beobachtet, also 2/3 aller in Deutschland überhaupt vorkommenden Arten. Es gibt hier Arten die Fließgewässer und andere, die stille Teiche oder Moore vorziehen, Groß- und Kleinlibellen, weit verbreitete und seltene Arten, einige, die erst in den letzten Jahren hier wiederaufgetaucht sind, und auch mediterrane Arten, die sich mit dem Klimawandel zunehmend bei uns heimisch fühlen. So sind z.B. fünf Arten der g r ü n - m e t a l l i s c h glänzenden Binsenjungfern heimisch und sehr häufig kommt die Blaugrüne Mosaikjungfer vor. In dem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter gibt Christoph Kämper einen Gesamtüberblick über die Libellen in unserer näheren Umgebung. | |
Eine regionale Tageszeitung in den 1960-1970er Jahren brachte täglich eine Komik-Serie unter der Überschrift: „Oskar, der freundliche Polizist“. Hier wurde in Zeichnungen das gute Zusammenwirken zwischen Bevölkerung und Polizei dokumentiert. Dies... Eine regionale Tageszeitung in den 1960-1970er Jahren brachte täglich eine Komik-Serie unter der Überschrift: „Oskar, der freundliche Polizist“. Hier wurde in Zeichnungen das gute Zusammenwirken zwischen Bevölkerung und Polizei dokumentiert. Dies kann man in etwa vergleichen mit dem Polizeibeamten Ernst Penquitt, der von 1946 bis zum Jahre 1967 seine Dienste im Ort Lohmar verrichtete. Unter zunächst ärmlichen Verhältnissen wohnte die Familie zuerst im Auelsweg, später bei der Familie Steimel an der Jabach. Die damalige Polizeistation war in der ehemaligen Gemeindeverwaltung an der Hauptstraße untergebracht. Hier waren Räume für Büroarbeiten und Verwaltung, aber auch schon ein Besprechungszimmer, das auch zu Verhören benutzt wurde. Selbst ein kleines Gefängnis im Keller diente als Sicherung für Diebe und Räuber. Ernst Penquitt machte sich in seinen 21 Dienstjahren bei der Lohmarer Bevölkerung einen guten Namen. Er war stets freundlich, hilfsbereit und zuvorkommend, ein Polizist zum Anfassen. Oft war er zugegen bei Festen und Veranstaltungen, sicherte die großen Fronleichnams-Prozessionen und war bei der Lohmarer Kirmes stets darauf bedacht, dass Ordnung und Sicherheit gewährleistet waren. Außerdem gab er Unterricht für Sicherheit im Straßenverkehr in den Schulen. Stets hatte er ein offenes Ohr für die Anliegen der Lohmarer Bevölkerung. Aber er konnte auch hart durchgreifen. Ernst Penquitt starb am 27.5.1975 im Alter von 68 Jahren. Beigesetzt wurde er auf dem Friedhof in Lohmar. Wer erfahren möchte, was z.B. im Juli 1947 auf einem Fest des Junggesellenvereins in Lohmar passierte und wie er sich beim Äppelklau von einigen Jungen verhielt, der liest am besten den gesamten Beitrag von Gerd Streichardt für die Lohmarer Heimatblätter.
| |
|
2015
Die Gründung des Kegelclub „Knapp do lanz“ [übersetzt: knapp vorbei] im Jahre 1926 ging der Tatsache voraus, dass in Lohmar 2 neue Kegelbahnen gebaut wurden. Zum einen die Kegelbahn des Gastwirtes Johann Schnitzler, Hotel zum Aggertal [später die... Die Gründung des Kegelclub „Knapp do lanz“ [übersetzt: knapp vorbei] im Jahre 1926 ging der Tatsache voraus, dass in Lohmar 2 neue Kegelbahnen gebaut wurden. Zum einen die Kegelbahn des Gastwirtes Johann Schnitzler, Hotel zum Aggertal [später die Schnitzlers Eck – heute Lohmarer Höfe] zum anderen die Kegelbahn der Gaststätte „zur Fähre“ an der Agger, errichtet von Gastwirt und Tischlermeister Peter Kümpel. Wer zu den ersten Mitgliedern zählte und was im Laufe der Jahre auf und neben der Kegelbahn so alles passierte, erfahren Sie in dem Beitrag von Gerd Streichardt für die Lohmarer Heimatblätter. | |
Der Fachbereich Heimatpflege und Naturschutz des HGV Lohmar hat es sich zur Aufgabe gemacht, frühzeitig Kinder und Jugendliche für die Natur und den Naturschutz zu begeistern. So wurden schon in früheren Jahren Nistkästen an Kindergärten und Schulen... Der Fachbereich Heimatpflege und Naturschutz des HGV Lohmar hat es sich zur Aufgabe gemacht, frühzeitig Kinder und Jugendliche für die Natur und den Naturschutz zu begeistern. So wurden schon in früheren Jahren Nistkästen an Kindergärten und Schulen verschenkt oder Exkursionen mit Schulklassen und Kindergärten in die Natur durchgeführt. Inzwischen werden von dort auch sogenannte „Insektenhotels“ gebaut. Verwendet werden dabei u.a. Altholz, Schilfrohr, Tannenzapfen, Lehm, Hölzer, Holzwolle, Ziegel und Drahtgeflecht. Nach eigenen Ideen erfolgte in einer Art Modulbauweise der Bau der unterschiedlichen Brutbereiche und in der Endbauphase der Zusammenbau zu einem Insektenhotel. Insektenhotels bieten diversen Insekten, wie etwa Wildbienen, Hummeln, Florfliegen, Käfer usw. Lebensraum als Brut-, Wohn- und Überwinterungsstätte. Diese finden schnell in den angebotenen Löchern oder Schilfhalmen einen Platz zur Ablage der Eier. Die Insekten betätigen sich als Bestäuber und biologische Schädlingsbekämpfer. Durch die Aufstellung von Insektenhotels bietet man den Insekten wieder einen halbwegs vernünftigen Lebensraum. Zudem schafft man dadurch ein Lehrmittel, um den Kindern die Biologie der Insekten und den dadurch erzeugten praktischen Naturschutz nahe zu bringen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Umweltbildung und vereinfachen das Beobachten von Insekten in der freien Natur. Die Insektenhotels wurden/werden in verschiedenen Kindergärten in Lohmar aufgestellt. Auf einer Infotafel werden jeweils Informationen zu den Insekten und ihrer Lebensweise dargestellt. | |
Im „schönen“ Ortsteil Schönenberg, findet man das äußerst originelle private Heimatmuseum von Kurt Oberdörster. Schönenberg liegt auf einem Hochplateau oberhalb von Wahlscheid und wurde bereits 1244 im Zusammenhang mit anderen Gütern zu Klefhaus und... Im „schönen“ Ortsteil Schönenberg, findet man das äußerst originelle private Heimatmuseum von Kurt Oberdörster. Schönenberg liegt auf einem Hochplateau oberhalb von Wahlscheid und wurde bereits 1244 im Zusammenhang mit anderen Gütern zu Klefhaus und des Meerer Hofes zu Münchhof urkundlich erwähnt. Kurt Oberdörster hatte zusammen mit seiner Frau Rosemarie die Idee, nach ihrem Berufsleben in der Landwirtschaft, im ehemaligen Stallgebäude und auf dem Scheunenboden ihrer Hofanlage ein privates Heimatmuseum einzurichten. 1984 wurde das Heimatmuseum schließlich eröffnet. In der zum Hof gehörenden Scheune und den Speichern, Remisen, Geräteschuppen, Kuh- und Pferdeställen kann man hautnah miterleben, wie die Menschen auf dem Land früher gelebt haben, wie sie mit Pferd und Pflug ihre Felder bewirtschafteten, wie sie die Hausarbeit verrichteten, wie ihre Kinder in der Schule unterrichtet wurden, wie sie sich kleideten, welches Gerät sie zu welcher Arbeit benutzten, welche Vorsorge sie für schlechte Zeiten trafen, wie sie den ganzen Alltag meisterten, wie sie feierten, und vieles andere mehr. Mittlerweile hat Kurt Oberdörster aus Platzmangel schon drei Mal den Ausstellungsbereich erweitern müssen. Zu den Highlights zählen das voll ausgestattete Klassenzimmer einer Dorfschule der Jahrhundertwende und eine große Sammlung von Oldtimer Motorrädern der Marke „Zündapp“. Im Hof- und Geräteschuppen findet man neben landwirtschaftlichen Geräten aller Art auch eine noch funktionsfähige alte Getreidemühle, die ursprünglich aus der Bäckerei Otto Specht aus Wahlscheid stammt. Auch eine Motorkutsche von 1926 [ehemals Pferdekutsche] ist hier ausgestellt. In der Remise stehen alte Landmaschinen und Geräte: z.B. Dreschmaschinen, eine Häckselmaschine, uralte Holzpflüge [„Hongsplog“], Eisenpflüge, Holzeggen, Kartoffelsortierer, Einachsschlepper, Gras- und Getreidemäher, Wender, Rechen, Düngerstreuer, Sämaschinen, Ackerwagen und und und……. 1998 wurde durch Initiative und in Zusammenarbeit des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Wahlscheid/Aggertal e.V. das Angebot des Museums um ein Backhaus bereichert. Backtag ist einmal monatlich. Und zu Sankt Martin werden z.B. 250 Weckmänner gebacken, die die Kinder vom Backhaus in Schönenberg bekommen. Daneben wird das Backhaus im Rahmen pädagogischer Programme von Schulklassen oder kleinerer Gruppen unter der Leitung von Fachleuten genutzt. Ein Besuch lohnt sich! | |
Auf einer historischen Wanderung des Heimat- und Geschichtsvereins führen uns Hermann Wenzel und Hans-Martin Pleuger von Wahlscheid über Neuhonrath nach Honrath und schließlich wieder zur katholischen Sankt Bartholomäus-Kirche im Tal von Wahlscheid... Auf einer historischen Wanderung des Heimat- und Geschichtsvereins führen uns Hermann Wenzel und Hans-Martin Pleuger von Wahlscheid über Neuhonrath nach Honrath und schließlich wieder zur katholischen Sankt Bartholomäus-Kirche im Tal von Wahlscheid zurück. Auf dieser geschichtsträchtigen Wanderung begegnen uns u.a. die vier Kirchen der Orte, alte Wegekreuze, die Burg Honrath, das alte Pastorat der evangelischen Kirchengemeinde Wahlscheid von 1624, die Honsbacher Mühle und das Baudenkmal „Gut Rosauel“. Auch führt der Weg am schönen Restaurant „Auelerhof“ und am Fachwerkhaus „Im Auelerhof Nr. 2“ von 1783 vorbei. Beide Häuser stehen auch unter Denkmalschutz. Wir durchqueren ferner den Landschaftsgarten Aggerbogen und die Aggerwiesen. Hier in den Aggerwiesen standen früher kleine Eichenwälder, die das Holz für den Bau von Aggernachen lieferten. Diese Nachen wurden als Personenfähren benötigt, denn es gab noch keine Brücken. Im Jahr 2013 wurde hier die neue, geschwungene Fußgängerbrücke gebaut. Die Streckenführung: Länge der Strecke: 12,7 km ohne Besichtigungen Höhenmeter auf und ab: 321 m | |
|
24. Januar 1991
1991 wurde aus der Gemeinde Lohmar die „mittlere kreisangehörige Stadt Lohmar“. An drei Stichtagen hatte Lohmar mehr als 25.000 Einwohner gehabt. Inzwischen hat Lohmar ca. 31.000 Einwohner. Die Stadtwerdung wurde am 24. Januar 1991 in der... 1991 wurde aus der Gemeinde Lohmar die „mittlere kreisangehörige Stadt Lohmar“. An drei Stichtagen hatte Lohmar mehr als 25.000 Einwohner gehabt. Inzwischen hat Lohmar ca. 31.000 Einwohner. Die Stadtwerdung wurde am 24. Januar 1991 in der Jabachhalle gefeiert. In einem Festakt überreichte der damalige NRW-Innenminister Dr. Herbert Schnoor die Ernennungsurkunde an den damaligen Bürgermeister von Lohmar, Rolf Lindenberg. Anwesend waren u.a. auch Dr. Franz Möller, der damalige Landrat des Rhein-Sieg-Kreises und der damalige Regierungspräsident, Dr. Franz-Josef Antwerpes. Der folgende Beitrag (s. PDF-Link) berichtet über den Festakt in Bild und Text. | |
Seligenthal wurde von den "fratres minores" 1231 -1247 gegründet. Die Klostergemeinschaft hatte großen Einfluss auf die Nachbargebiete. Birk wurde bis ins 17. Jahrh. von den Klosterbrüdern verwaltet. In Neuhonrath waren sie von 1710 bis 1803... Seligenthal wurde von den "fratres minores" 1231 -1247 gegründet. Die Klostergemeinschaft hatte großen Einfluss auf die Nachbargebiete. Birk wurde bis ins 17. Jahrh. von den Klosterbrüdern verwaltet. In Neuhonrath waren sie von 1710 bis 1803 tätig.1689 ging nachweislich die erste Fußwallfahrt von Lohmar zum heiligen Rochus nach Seligenthal. Die ersten Bittzüge könnten aber schon im 14./15. Jahrhundert stattgefunden haben, als die ersten großen Pestwellen Nord- und Westeuropa erreichten. Rochus (1275-1327) gilt als Schutzpatron der Pilger und Reisenden und als Nothelfer bei ansteckenden Krankheiten, insbesondere der Pest.1709 wurde die barocke Wallfahrtskapelle Sankt Rochus südwestlich des Klosters Seligenthal errichtet. Die Pilger aus Altenrath, Scheiderhöhe und Lohmar gingen vom alten Lohmarer Kirchdorf über den früheren »Thalweg« (hergeleitet von Seligenthal) oberhalb der heutigen Pützerau, vorbei am heutigen Reiterhof Waldeck zur »Zwölf-Apostel-Buche«, einem uralten Buchen-Stockausschlag mit einer Stammdicke, die fünf Menschen mit ausgestreckten Armen gerade umschlingen konnten. Hier war die erste Wegzehrung mit »Muckefuck« (Malzkaffee aus geröstetem Korn) und Broten mit »Flönz« (Bauern-Blutund Leberwurst) sowie »Klatschkies « (Käse aus handgeschöpfter Sauermilch). Der alte Baumstock ist bis auf kleine vermoderte Reste nicht mehr vorhanden. Neue Buchen wurden am alten Standort angepflanzt. In der Nähe wurden Holzbänke und Tische zur Rast aufgestellt. Über den heutigen Reit- und Wanderweg A 2 vorbei am Haus Rothenbach ging es dann über die Zeithstrasse durch den Kaldauer Wald Richtung »Dall« (Thal). Die Birker Pilger wanderten über Schreck, Schneffelrath und Gut Umschoss »zum Roches«. Über die jahrhundertelangen Fußwallfahrten aus dem Aggertal nach Seligenthal berichtet Johannes Heinrich Kliesen in einem ausführlichen Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter. | |
|
2014
Die Ortschaft Bach liegt im unteren Sülztal nordwestlich von Lohmar, an der Sülztalstraße von Lohmar nach Rösrath. Dort, wo die regionale Verbindungsstraße nach Kellershohn und Feienberg von der heutigen Landstraße L288 abbiegt. Unweit vom Krewelshof... Die Ortschaft Bach liegt im unteren Sülztal nordwestlich von Lohmar, an der Sülztalstraße von Lohmar nach Rösrath. Dort, wo die regionale Verbindungsstraße nach Kellershohn und Feienberg von der heutigen Landstraße L288 abbiegt. Unweit vom Krewelshof und Haus Sülz. Die Hofanlage des Bacherhofs wurde leider in den 1960er Jahren bis auf die Grundmauern abgetragen. Dort wo der Hof war, sind heute zwei Wohnhäuser errichtet worden. Heute ist dort nur noch das Gasthaus „Bacherhof“ vorhanden, das nach umfangreicher Sanierung inzwischen den Namen „Touch down“ trägt. Lothar Fassbender stellt in seinem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter die geschichtliche Entwicklung des Bacherhofes dar. Und gibt uns mit alten Fotos einen Einblick darin, wie der inzwischen verschwundene Hof einmal aussah und wie sich das „Hofleben“ im Laufe der Zeit gestaltete. So waren ausweislich einer Versicherungspolice von 1903 auf dem Hof vorhanden: 1 Pferd, 1 Ochse, 5 Kühe, 5 Stück Jungvieh, 4 Schweine ,50 Hühner und 15 Bienenstöcke. In der damaligen Fachwerkscheune wurden Feldarbeitsgeräte (Wirtschaftswagen und Karren sowie landwirtschaftliche Maschinen), Schüttgut (z.B. Brennholz oder Futterrüben) und Erntefrüchte (Getreide, Hülsenfrüchte etc.) gelagert. Mehr erfahren Sie, wenn Sie den ausführlichen Beitrag (s. beigefügte PDF-Datei) lesen. | |
In einer Reise durch die Jahrhunderte berichtet Elisabeth Klein für die Lohmarer Heimatblätter über die geschichtliche Entwicklung des Gutes Windlöck. Der Hof Windlöck liegt idyllisch eingebettet in einer Talmulde südöstlich von Honrath. Die... In einer Reise durch die Jahrhunderte berichtet Elisabeth Klein für die Lohmarer Heimatblätter über die geschichtliche Entwicklung des Gutes Windlöck. Der Hof Windlöck liegt idyllisch eingebettet in einer Talmulde südöstlich von Honrath. Die Gründung dürfte, wie bei vielen Höfen in unserer Gegend, zwischen 1300 und 1400 gewesen sein, als nach der Rodungszeit immer mehr Siedlungspunkte entstanden. Im Laufe der Zeit haben zahllose Eigentümer- und Pächterwechsel stattgefunden, in denen es auch eine Verbindung zum heutigen Schloss Auel und der Burg Honrath gab. In der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde das heutige, unter Denkmalschutz stehende Wohnhaus, von Windlöck erbaut. Aus dem Bauernhof und später errichteter Gastwirtschaft wurde schließlich ein Gärtnereibetrieb. Das Gut Windlöck überstand auch schwierigste Zeiten. So wütete z.B. 1756 bis 1763 im Bergischen Land der Siebenjährige Krieg. Die abwechselnd durchziehenden hannoveranischen und französischen Heere zwangen die Menschen zu Abgaben und es herrschte Not und Armut in der Bevölkerung. Das Jahr 1761 ging als ein Hungerjahr in die Geschichte ein. Später in der französischen Besatzung unter Napoleon waren dessen Truppen plündernd und brandschatzend durch das Aggertal gezogen. Nach einer Überlieferung soll aber der Ortsvorsteher Schmitz den General mit Geschenken beruhigt haben, so dass Wahlscheid und auch Windlöck verschont blieben. Wenn Sie mehr wissen möchten und welche Folgen ein Vulkanausbruch in 1816 hatte, dann lesen Sie den ausführlichen Beitrag in der beigefügten PDF-Datei. | |
Auf dem gut drei Kilometer langen Abschnitt der Agger zwischen Wahlscheid und Kreuznaaf wurden in den Jahren 2013 und 2014 vier neue Brücken gebaut. Die Baukosten betrugen einige Millionen Euro, die das Land NRW und die Stadt Lohmar trugen. Alle... Auf dem gut drei Kilometer langen Abschnitt der Agger zwischen Wahlscheid und Kreuznaaf wurden in den Jahren 2013 und 2014 vier neue Brücken gebaut. Die Baukosten betrugen einige Millionen Euro, die das Land NRW und die Stadt Lohmar trugen. Alle Brücken enthalten den Werkstoff Holz und jede der Brücken hat eine ganz unterschiedliche Tragkonstruktion. Die spektakulärste der vier neuen Aggerbrücken befindet sich in der Nähe der Naturschule Aggerbogen. In einer eleganten S-Form schwingt sich hier eine an zwei stählernen Pylonen aufgehängte Holzbrücke über die Agger. Diese im Mai 2013 eröffnete Brücke für Fußgänger und Radfahrer soll die Erweiterung des Landschaftsgartens Aggerbogen auf der anderen Flussseite erschließen und die überwiegend kleinen Besucher der Naturschule über die Agger bringen. Auch soll sie das Radfahren im Aggertal verbessern. Mit der Hängebrücke wurden Pfeiler im Flussbett vermieden, die bei Hochwasser die Strömung behindern könnten. Durch die S-Form konnte eine Brückenlänge von 62 Metern untergebracht werden, so dass die Fahrbahn nur eine maximale Steigung von 6% aufweist und damit auch für Rollstuhlfahrer benutzbar ist. Weitere Details zu den neuen 4 Brücken können Sie dem Dokument entnehmen. | |
|
2015
Von der alten Auelsbachmühle, die wahrscheinlich schon im Jahr 1493 von den Lohmarer Burgherren von der Reven gebaut wurde, gibt es heute nur noch unscharfe Fotos und ganz wenige Zeichnungen in Tusche und verblassten hellen Farben. Das einzige 29x24... Von der alten Auelsbachmühle, die wahrscheinlich schon im Jahr 1493 von den Lohmarer Burgherren von der Reven gebaut wurde, gibt es heute nur noch unscharfe Fotos und ganz wenige Zeichnungen in Tusche und verblassten hellen Farben. Das einzige 29x24 cm kleine Kunstwerk wurde durch Zufall im Frühjahr 2008 in einer privaten Familiensammlung in Lohmar vom Autor dieses Beitrages entdeckt. Leider ist aber der Name des Malers unbekannt geblieben. Im Signum unter dem Bild ist lediglich das Datum von 1869 zu entziffern. 1907 kaufte Jean Pilgram als letzter Müller das ganze Anwesen und zog mit seiner Familie von Köln-Mülheim nach Lohmar an den Auelsbach. Aufgrund seiner schelmischen Art und weil er leidenschaftlich gerne Pfeife rauchte, wurde er im Volksmund "Piefekopp" genannt. Er verstarb 1946. In seinem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter erinnert Johannes Heinrich Kliesen an die weggebaggerte Mühle am Auelsbach, an den letzten Müller Jean Pilgram und an die Mühlenquelle. | |
Die Geschichte von Lohmar von der Frühgeschichte bis 1991 haben die Heimatchronisten Bernhard Walterscheid-Müller (* 1918, †1991) und Heinrich Hennekeuser in der Sonderausgabe der Lohmarer Heimatblätter, die anlässlich der Verleihung der Stadtrechte... Die Geschichte von Lohmar von der Frühgeschichte bis 1991 haben die Heimatchronisten Bernhard Walterscheid-Müller (* 1918, †1991) und Heinrich Hennekeuser in der Sonderausgabe der Lohmarer Heimatblätter, die anlässlich der Verleihung der Stadtrechte im Jahr 1991 herausgegeben wurde, zusammengefasst. Der Beitrag enthält auch eine Zeittafel, die vor 400 Millionen Jahren v. Chr. beginnt und 1991 mit der Stadtwerdung endet. | |
|
11. Mai 2014
Am 11. Mai 2014 wurde im Beisein des Innenministers des Landes NRW Ralf Jäger die feierliche Enthüllung einer neuen Bronze-Skulptur am Saugässchen gefeiert. „Wir legen heute ein Stück Heimatgeschichte offen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Röger bei... Am 11. Mai 2014 wurde im Beisein des Innenministers des Landes NRW Ralf Jäger die feierliche Enthüllung einer neuen Bronze-Skulptur am Saugässchen gefeiert. „Wir legen heute ein Stück Heimatgeschichte offen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Röger bei der Enthüllung der Skulptur vor einigen Hundert Festgästen im Park Villa Friedlinde/Saugässchen. Dem vorausgegangen war der Gedanke von Paul Hoscheid und Gerd Streichart (Vorsitzender des HGV), wonach in Lohmar nur noch wenig Erinnerung an den jahrelangen Schweineauftrieb durch die Saugasse in den Lohmarer Erbenwald besteht. Vor allem vermisse man irgendwo einen Hinweis darauf. Gerd Streichhardt und Dr. Johannes Bolten starteten eine Spendenaktion und beauftragten schließlich den Bonner Künstler Friedemann Sander mit der Anfertigung der Schweine-Skulptur, siehe Dokument. Der geschichtliche Hintergrund: | |
|
400
- 500 In seinem interessanten Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter skizziert Johannes Heinrich Kliesen (* 1924, † 2017) den Ablauf der Siedlungsgeschichte mit dem Schwerpunkt der fränkisch-merowingischen Erstbesiedlung ab etwa 450 n. Chr.. Er hält es für... In seinem interessanten Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter skizziert Johannes Heinrich Kliesen (* 1924, † 2017) den Ablauf der Siedlungsgeschichte mit dem Schwerpunkt der fränkisch-merowingischen Erstbesiedlung ab etwa 450 n. Chr.. Er hält es für sehr wahrscheinlich, dass die ersten bodenständigen Siedler im fünften Jahrhundert von Westen her aus dem Köln-Bonner Raum in Trecks über die Aggerfurt nahe der heutigen Gaststätte „Zur alten Fähre“ bei der Brücke in Richtung Troisdorf kamen. Bis in die Zeit der Völkerwanderung mit dem Niedergang des Römischen Reiches wurden die mitunter undurchdringlichen Sümpfe, Hang- und Auenwälder und Heideflächen gemieden und nur von vorzeitlichen Sammlern und Jägern, den sogennanten Wildbeutern, sporadisch durchzogen. Der älteste Hinweis darauf wurde im Sülztal nahe Lohmar gefunden. Beim Bau der Autobahn wurde ein Steinschaber zur Fellbearbeitung ausgebaggert, der aus der mittleren Altsteinzeit um 300.000 bis 40.000 v. Chr. stammt. Ausführlich geht der Autor auf die Frage ein, wie die nachrömisch-fränkische „Landnahme“ vonstatten gegangen ist, ob der der Fronhof, im alten Kirchdorf in Lohmar gelegen, schon vor der der Christianisierung als einzelnes Anwesen existiert hat und wo Gräber aus der Frankenzeit als Beleg für die Siedlungsvergangenheit zu lokalisieren sind. | |
Hans Heinz Eimermacher, Jahrgang 1939 erinnert sich in seinem Bericht für die Lohmarer Heimatblätter an die letzten Kriegswochen in Lohmar. Er schildert die Wochen im März 1945, wo Lohmar unter Beschuss lag bevor die Amerikaner mit ihren Panzern... Hans Heinz Eimermacher, Jahrgang 1939 erinnert sich in seinem Bericht für die Lohmarer Heimatblätter an die letzten Kriegswochen in Lohmar. Er schildert die Wochen im März 1945, wo Lohmar unter Beschuss lag bevor die Amerikaner mit ihren Panzern einrückten. Sie kontrollierten alle Straßen und machten Hausdurchsuchungen. Die Bewohner der Hermann-Löns-Straße mussten ihre Häuser verlassen. Sie wurden von den amerikanischen Soldaten belegt, die nach einigen Tagen aber schon weiterzogen. | |
|
1945
Über die letzten Kriegstage in Lohmar und die ersten Monate danach berichtet Erwin Henseler (geb. 1928, verst. 2013) in seinem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter (Dokument). Über die letzten Kriegstage in Lohmar und die ersten Monate danach berichtet Erwin Henseler (geb. 1928, verst. 2013) in seinem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter (Dokument).
| |
Nach fünfeinhalbjähriger Bauzeit und umfangreichen Sanierungsarbeiten konnte die Kirche am 17. Dezember 2011 wieder ihrer Bestimmung übergeben werden. In einem großen Festgottesdienst feierten die Pfarrangehörigen, zusammen mit Weihbischof Dr. Heiner... Nach fünfeinhalbjähriger Bauzeit und umfangreichen Sanierungsarbeiten konnte die Kirche am 17. Dezember 2011 wieder ihrer Bestimmung übergeben werden. In einem großen Festgottesdienst feierten die Pfarrangehörigen, zusammen mit Weihbischof Dr. Heiner Koch, die Wiedereinweihung ihres Gotteshauses. In 2006 war ein herabstürzender Schlussstein des Gurtbogens zwischen Orgelempore und Turm Anlass für diese Baumaßnahme gewesen. Mehr erfahren Sie in dem Beitrag für die Lohmarer Heimatbläter, siehe Dokument. | |
Die Bachermühle, die schon früh Eigentum adeliger Familien von Schloss Auel war, wurde Mitte des 17. Jahrhunderts erstmals urkundlich erwähnt. Die heute erhaltene Bausubstanz, das zweigeschossige Mühlengebäude, dürfte jedoch wesentlich später, so um... Die Bachermühle, die schon früh Eigentum adeliger Familien von Schloss Auel war, wurde Mitte des 17. Jahrhunderts erstmals urkundlich erwähnt. Die heute erhaltene Bausubstanz, das zweigeschossige Mühlengebäude, dürfte jedoch wesentlich später, so um 1800 entstanden sein. Die Mühle ist in der Denkmalliste der Stadt Lohmar eingetragen. Die Wasser-Kornmühle, unterhalb des Kammerbergs am rechten Aggerufer, erhielt das Wasser für den Betrieb der Mühle mittels eines Obergrabens als Abzweig der angeströmten Fläche des Honsbacher Wehres (sog. Oberwasser) aus der Agger. Bis in die 1950er Jahre hinein war die nun elektromotorenbetriebene Mühle noch in Betrieb. Die Bachermühle liegt nordöstlich von Wahlscheid, an der Kreuzung der Bundesstraße 484 und der Kreisstraße 16 nach Neuhonrath. Mehr erfahren Sie in dem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter Nr. 25, siehe Dokument. | |
Es gab auch in Lohmar und in Wahlscheid Familien, die sich in den Jahren von 1846-1884 aufmachten, um in das gelobte Land „Amerika“ zu kommen. So hat sich auch Michael Schiffbauer aus Schönrath im Jahre 1851 mit seiner Familie auf den langen,... Es gab auch in Lohmar und in Wahlscheid Familien, die sich in den Jahren von 1846-1884 aufmachten, um in das gelobte Land „Amerika“ zu kommen. So hat sich auch Michael Schiffbauer aus Schönrath im Jahre 1851 mit seiner Familie auf den langen, beschwerlichen Weg in die neue Heimat gemacht. Er erreichte schließlich am 4. November 1851 mit dem Zweimastschoner „Clotilde“ den Hafen von New York. Mehr erfahren Sie in dem folgenden Beitrag. Hier finden Sie auch eine Auflistung der Auswanderer-Familien. | |
Die Scherben eines sehr seltenen, reich verzierten, 4500 Jahre alten schnurkeramischen Gefäßes wurden Ende 2009 im Stadtzentrum gegenüber den „Lohmarer Höfen“ ausgegraben. In diesem interessanten Bericht erfahren Sie wie mit Bagger und Schaufel die... Die Scherben eines sehr seltenen, reich verzierten, 4500 Jahre alten schnurkeramischen Gefäßes wurden Ende 2009 im Stadtzentrum gegenüber den „Lohmarer Höfen“ ausgegraben. In diesem interessanten Bericht erfahren Sie wie mit Bagger und Schaufel die Geschichte von Lohmar neu geschrieben wurde. | |
Zweimal im Jahr überfliegen die Kraniche Lohmar. Einmal ziehen sie am Ende des Jahres in ihr Südquartier und am Beginn des neuen Jahres in ihr Nordquartier. Im Bericht, siehe Dokument, erfahren Sie mehr über Arten, Zug- und Rastgebiete dieses sehr... Zweimal im Jahr überfliegen die Kraniche Lohmar. Einmal ziehen sie am Ende des Jahres in ihr Südquartier und am Beginn des neuen Jahres in ihr Nordquartier. Im Bericht, siehe Dokument, erfahren Sie mehr über Arten, Zug- und Rastgebiete dieses sehr imposanten Vogels. Vielleicht so eine Art "Wappenvogel" von Lohmar? | |
Die ersten Lohmarer Karnevalssitzungen wurden nach dem Ersten Weltkrieg Mitte der 1920er Jahre veranstaltet. Die Anfänge gingen von dem 1919 gegründeten Sportverein Lohmar aus. Der Zweite Weltkrieg unterbrach das karnevalistische Treiben bis 1947.... Die ersten Lohmarer Karnevalssitzungen wurden nach dem Ersten Weltkrieg Mitte der 1920er Jahre veranstaltet. Die Anfänge gingen von dem 1919 gegründeten Sportverein Lohmar aus. Der Zweite Weltkrieg unterbrach das karnevalistische Treiben bis 1947. Ermutigt durch eine gelungene Karnevalsveranstaltung schloss man sich zu einem karnevalistischen Zirkel zusammen und meldetete am 15. Januar 1948 den KaZi bei der Amtsverwaltung Lohmar an. Die Chronik hat Hans - Josef Speer in einem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter festgehalten. | |
Die Agger mit ihren naturnahen Auen gehört zu den interessantesten Lebensräumen unserer näheren Heimat. Die Agger mit ihren naturnahen Auen gehört zu den interessantesten Lebensräumen unserer näheren Heimat. Der Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter beschreibt die ökologische Bedeutung dieses Landschaftsraumes und ihre kulturhistorische Entwicklung in den Jahrhunderten. | |
|
2008
Weegen liegt im südwestlichen Teil Lohmars und hat heute ca. 850 Einwohner. Umliegende Ortschaften und Weiler sind Donrath und Höngen im Norden, Halberg und Ellhausen im Nordosten, Salgert und Gebermühle im Osten sowie Lohmar-Ort im Süden bis Westen. ...Weegen liegt im südwestlichen Teil Lohmars und hat heute ca. 850 Einwohner. Umliegende Ortschaften und Weiler sind Donrath und Höngen im Norden, Halberg und Ellhausen im Nordosten, Salgert und Gebermühle im Osten sowie Lohmar-Ort im Süden bis Westen. Weegen war im 17. Jahrhundert eine Hofanlage mit zwei Häusern, die zu Eichen gehörte. Der „Eycher weegh“ wurde bereits 1644 erstmals erwähnt und ist die Grundlage der Namensgebung des heutigen Ortsteils Weegen. Der Name Weegen ist aus der Bezeichnung „zu Eichenwegen“ (Taufbuch von 1683), „Von den Weegen“ (Heiratsregister von 1727) oder „Auf den Weegen“ (Einwohnerverzeichnis des Kirchspiels von Lohmar 1750) entstanden. Bereits 1817 wurde die Ortsbezeichnung Weegen in den Flurkarten eingetragen. Dort sind 1824 drei Häuser (2 Wohnhäuser, 1 Gesindehaus) ausgewiesen. Bereits 1843 zählte Weegen fünf Häuser und 22 Einwohner. Anfang der 1920er Jahre kaufte das Ehepaar Bucher das Fachwerkhaus auf der Weegener Str. Nr. 8, vor dem die Söhne Mitte der 20er Jahre einen Brunnen bauten. Dies ist und war der einzige Brunnen in Weegen. Vor dem Krieg gab es ein Lebensmittelgeschäft im Ort. 1945 wurde das Geschäft der Familie Langel geschlossen. Anfang der 50er Jahre wurden alle Straßen und auch die meisten Feldwege asphaltiert; Anfang der 60er Jahre wurde Weegen an die kommunale Wasserversorung angeschlossen. Nachdem der alte Ortskern dicht besiedelt war, wurdeMitte der 1960er Jahre südöstlich ein erster Siedlungsabschnitt mit Flachdachbungalows gebaut, die 1967 bezogen werden konnten. Etwa 1965 wurde die Fläche zwischen Elsternweg und Meisenweg erschlossen und 15 Baugrundstücke zur Verfügung gestellt. In den 70er Jahren wurde auch das „alte Weegen“ bebaut und die ursprünglichen Fachwerkhäuser abgerissen. In den 1980er Jahren wurde der Ort zuerst – von Eichen kommend – rechts der Weegener Straße und anschließend rechts des Elsternweges bebaut und erweitert. Etwa 1995 wurde die Dr.-Kallen-Straße gebaut. Mit ihr entstanden der Milanweg und der Weihenweg. Zeitgleich wurde die Straße Eichen ausgebaut. Diese war bis Mitte der 90er die Hauptzufahrt in den Ort Weegen hinein. Zur Schule gingen die Weegener Kinder bis 1857 nach Lohmar, danach in die Bergschule nach Ellhausen. 1968 wurde das 1. bis 4. Schuljahr in die Grundschule Donrath sowie das 5. bis 8. Schuljahr in die Hauptschule Lohmar integriert. Die heutigen Stadtteile Weegen, Heppenberg, Donrath, Hallberg, Ellhausen, Grimberg und Naaferberg bildeten bis 1969 (kommunale Gebietsreform in NRW) eine eigene Gemeinde. Diese war nach dem kleinsten Ort Halberg benannt. 1969 siedelte sich ein weiteres Lebensmittelgeschäft mit Metzgerei in Weegen an. Dieses wurde 1993 wegen Unrentabilität geschlossen. In Kreuzhäuschen wurde sogar eine eigene Poststelle für Weegen, Eichen und Halberg betrieben. Im Oktober 1969 wurde die Poststelle aufgelöste und der Ort wird nun von Lohmar aus versorgt. Die Verwaltungsangelegenheiten wurden bis 1851 im Wohnhaus des jeweiligen Bürgermeisters erledigt. Bis 1908 war das Bürgermeisteramt in Donrath die Anlaufstelle für die Bürger. Erst danach wurde ein neues Bürgermeisteramt in Lohmar gebaut. Nähere Informationen siehe Dokument.
| |
|
2008
Mit diesem Artikel wird die Geschichte der ehemaligen Wasserburg beschrieben, die ihm 14. Jahrhundert errichtet wurde und heute in Teilen immer noch erhalten ist. Beleuchtet wird ferner das Adelsgeschlecht „von Reven“, dass die Burg 200 Jahre... Mit diesem Artikel wird die Geschichte der ehemaligen Wasserburg beschrieben, die ihm 14. Jahrhundert errichtet wurde und heute in Teilen immer noch erhalten ist. Beleuchtet wird ferner das Adelsgeschlecht „von Reven“, dass die Burg 200 Jahre bewohnte. | |
|
1924
- 1988 1924 wurde sozusagen der Grundstein gelegt für einen der ersten Industriebetriebe in Lohmar, als Johann Fischer im Keller seines Wohnahauses eine Werkstatt eröffnete. Angefangen mit Gravierarbeiten kamen später die Herstellung von Armaturen (z. B.... 1924 wurde sozusagen der Grundstein gelegt für einen der ersten Industriebetriebe in Lohmar, als Johann Fischer im Keller seines Wohnahauses eine Werkstatt eröffnete. Angefangen mit Gravierarbeiten kamen später die Herstellung von Armaturen (z. B. Post-, Telefonstecker), Produktionsmaschinen, Werkzeugen und zuletzt die Kunststoffverarbeitung hinzu. Über die Entwicklung vom Handwerk- zum Industriebetrieb berichtet Wilhelm Pape ausführlich in dem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter (Dokument).
| |
|
1930
- 1945 Wie hat sich die katholische Kirchengemeinde in Lohmar in der Nazi-Zeit verhalten? Eine Schülerin (Jahrgangstufe 12) des Gymnasiums Lohmar gibt in einem Fachbeitrag für den Grundkurs Geschichte aus dem Jahr 2006 eine Antwort darauf: Anders als in... Wie hat sich die katholische Kirchengemeinde in Lohmar in der Nazi-Zeit verhalten? Eine Schülerin (Jahrgangstufe 12) des Gymnasiums Lohmar gibt in einem Fachbeitrag für den Grundkurs Geschichte aus dem Jahr 2006 eine Antwort darauf: Anders als in Wahlscheid war der größte Teil der Lohmarerer Bevölkerung katholisch und Anhänger der Zentrumspartei. Die evangelische Kirchengemeinde wurde erst nach dem Krieg gegründet. Bei der Reichstagswahl im März 1933 erhielt die NSDAP hier nur 21 % der Stimmen (in Wahlscheid: 69,9 %). Trotz öffentlicher Aufrufe der Nationalsozialisten aus der Kirche auszutreten, gab es in der Zeit des Dritten Reiches in Lohmar keine Kirchenaustritte zu vermerken. In Ihrer Beschreibung der Lohmarer Verhältnisse in dieser Zeit kommt die Autorin zu dem Fazit, dass für die Lohmarer Kirchengemeinde die Ausübung religiöser Riten und Traditionen vor dem Gehorsam gegenüber den Nationalsozialisten stand und sie versuchte, sich dem Druck der Nazis nicht zu beugen. Der HGV Lohmar hat den Artikel von Alessa Günther in den Lohmarer Heimatblättern veröffentlicht (Dokument). | |
|
1933
- 1945 Schon kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) versuchten die Nazis die Arbeit der freien Jugendorganisationen zu verhindern. Kinder- und Jugendliche sollten sich der Hitlerjugend anschließen.... Schon kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) versuchten die Nazis die Arbeit der freien Jugendorganisationen zu verhindern. Kinder- und Jugendliche sollten sich der Hitlerjugend anschließen. Parteigebundene Jugendorganisationen der Sozialdemokraten und Kommunisten wurden sofort verboten. Im Jahre 1937 wurde jüngeren Mitgliedern in katholischen Jugendorganisationen eine Doppelmitgliedschaft in der Hitlerjugend (HJ) und in einer katholischen Jugendorganisation verboten. Erlaubt war nur noch eine enge religiöse Jugendarbeit. Vor diesem Hintergrund beleuchtet Hans Warning in seinem Beitrag (Dokument) die Auswirkungen auf die katholischen Jugendvereine im Amt Lohmar. | |
8. November 1950. Die Lohmarer Volksschule blieb geschlossen. Lohmarer Bürger nahmen einen Tag Urlaub: Die Bevölkerung von Lohmar feierte die Diamantene Hochzeit (60 Jahre) von Katharina und Wilhelm Kurtsiefer aus dem Mühlenweg in Lohmar. Lesen Sie... 8. November 1950. Die Lohmarer Volksschule blieb geschlossen. Lohmarer Bürger nahmen einen Tag Urlaub: Die Bevölkerung von Lohmar feierte die Diamantene Hochzeit (60 Jahre) von Katharina und Wilhelm Kurtsiefer aus dem Mühlenweg in Lohmar. Lesen Sie mehr darüber in dem Dokument. | |
|
2014
Um die Historie der Zwölf-Apostelbuche in der Nähe des Reitstalls in Lohmar ranken sich einige Geschichten und Legenden. Die alte Buche hatte eine Höhe von 27 Meter und einen Umfang von 7,50 Meter und wurde in den 1970er Jahren durch Blitz und Sturm... Um die Historie der Zwölf-Apostelbuche in der Nähe des Reitstalls in Lohmar ranken sich einige Geschichten und Legenden. Die alte Buche hatte eine Höhe von 27 Meter und einen Umfang von 7,50 Meter und wurde in den 1970er Jahren durch Blitz und Sturm umgeworfen. 1979 wurden zwölf Buchenzöglinge neu gepflanzt. Über seine Recherchen berichtet Johannes Heinrich Kliesen in dem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter (Dokument). | |
|
2006
Wegen des "sensationellen" Fundes aus der Merowingerzeit an der Bachstraße in Lohmar ergriffen der Bauherr des Altenpflegeheims - evangelisches Altenheim Wahlscheid e.V. - , Architekt Michael Bruckner und die Stadt Lohmar die Initiative zum Bau... Wegen des "sensationellen" Fundes aus der Merowingerzeit an der Bachstraße in Lohmar ergriffen der Bauherr des Altenpflegeheims - evangelisches Altenheim Wahlscheid e.V. - , Architekt Michael Bruckner und die Stadt Lohmar die Initiative zum Bau eines Fundortmuseums im Keller des Gebäudes. Die Kosten beliefen sich auf geschätzte 370.000 € und wären nur über Fördergelder zu finanzieren gewesen. Leider waren weder Stiftungen noch der Landschaftsverband Rheinland bereit, das Projekt zu unterstützen. Das Altenpflegeheim wurde dann ohne Unterkellurung und ohne Museum gebaut. | |
|
2005
Auf der gesamten Fläche der Grabung wurden Funde des 5./6. Jh. bis hin zum 15./16. Jh. aufgedeckt. Wölbwandtöpfe, Schalen und Reibschüsseln als rauwandige Gebrauchskeramik machen den Großteil der Funde aus. Daneben wurde Ess- und Trinkgeschirr in... Auf der gesamten Fläche der Grabung wurden Funde des 5./6. Jh. bis hin zum 15./16. Jh. aufgedeckt. Wölbwandtöpfe, Schalen und Reibschüsseln als rauwandige Gebrauchskeramik machen den Großteil der Funde aus. Daneben wurde Ess- und Trinkgeschirr in Form von kleinen Schalen, einem Knickwandbecher und der Scherbe eines Sturzbechers geborgen. Durch ihre Formen datiert die Keramik in diezweite Hälfte des 5. Jh. bis in die erste Hälfte des 6. Jh. Nach der Aufgabe der ältermerowingerzeitlichenGebäude wurde die Siedlung in Lohmar-Unterdorf wahrscheinlich weiter nach Norden verlegt. Damit keine Tiere in die bis zu 1,50 m tiefen Löcher stürzten, verfüllte man sie. | |
Bei der Grabung im Sommer 2005 durch das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege wurde an der Bachstraße in Lohmar u. a. eine merowingerzeitliche Siedlung aufgedeckt. Auf der gesamten Fläche wurden Befunde und Funde des 5./6. Jh. bis hin zum 15./16.... Bei der Grabung im Sommer 2005 durch das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege wurde an der Bachstraße in Lohmar u. a. eine merowingerzeitliche Siedlung aufgedeckt. Auf der gesamten Fläche wurden Befunde und Funde des 5./6. Jh. bis hin zum 15./16. Jh. aufgedeckt. Von der ländlichen Siedlung der Merowingerzeit konnten auf der gesamten Grabungsfläche nur die Nebengebäude festgestellt werden. Bei den Nebengebäuden handelt es sich um drei Grubenhäuser der Zeit um 500 n. Chr. Diese waren 2,30 x 2,80 m bis 2,70 x 3,80 m groß und hatten ein Reet gedecktes Dach, das auf sechs Pfosten ruhte. Der Boden bestand aus einer verdichteten Kiestenne, in der sich Pfostenspuren abzeichneten. Der Pfostendurchmesser variiert zwischen 30 und 40 cm. Bei einem Grubenhaus (Stelle 50) zeigte sich ein seitlicher Eingang im Süden, zu dem in den Boden geschnittene Stufen hinunterführten. Die Nutzung der Grubenhäuser als Wohn- oder Wirtschaftsbauten bleibt aufgrund des vorhandenen Materials ungeklärt. Das Hauptgebäude konnte auf der untersuchten Fläche nicht lokalisiert werden, da die oberflächennahenBefunde (Pfosten- und Schwellbalkenbauten) durch Erosion abgetragenwurden. Diese große archäologische Ausgrabung weist daraufhin, dass die ersten bodenständigen Siedler schon in der frühen zweitenHälfte des fünften Jahrhunderts so gut wie sicher von Westen her aus dem Köln-Bonner Raum in kleinen oder auch schon größeren Trecks über die Aggerfurt nahe dem heutigen Gasthaus „Zur altenFähre“ bei den Brücken Richtung Troisdorf–Altenrath kamen. Schon vor der Ausgrabung merowingischer Siedlungsbeweise an der Bachstraße im Jahr 2005 spricht der Leiter des Overather Denkmalamtes auf Gut Eichthal Dr. Michael Gechter im Jahr 2001 bereits von Hinweisen auf merowingerzeitliche Besiedlung in Lohmar. Er schreibt dazu: „Es handelt sich um Gräber in der Nähe der ältesten Lohmarer Kirche.Diese Gräber müssen zu einem Hof aus dem 6./7. Jahrhundert gehört haben, der in der Nähe der Aggerfurt errichtet worden war.“ Die genannten mehreren Skelettgräber eines Hofes könnten von ebendiesen frühen Ripuariern herrühren. Diese Körpergräber lagen nach unterschiedlichen Angaben östlich der katholischen Kirche im Areal der heutigen Altenrather Straße.
| |
|
1898
| |
| |
|
1960
| |
| |
| |
| |
| |
|
1950
- 1959 Die achtgeteilte Mehrbildkarte (Potpourrikarte) des „Luftkurort Lohmars, das Tor zum Sülz- und Aggertal“ (Abfahrt von der Autobahn Köln – Frankfurt bei Kilometer 18, Busfahrt ab Köln oder Bonn ca. 35 Minuten) mit idyllischen Zelt und Campingplätzen... Die achtgeteilte Mehrbildkarte (Potpourrikarte) des „Luftkurort Lohmars, das Tor zum Sülz- und Aggertal“ (Abfahrt von der Autobahn Köln – Frankfurt bei Kilometer 18, Busfahrt ab Köln oder Bonn ca. 35 Minuten) mit idyllischen Zelt und Campingplätzen mit Wald, Wiese und Wasser von etwa Mitte der 1950er Jahre, zeigt verschiedene Partien der Agger. Oben im Bild: die Anfänge des Campingplatzes Lohmar-Ort von Süden gesehen. Beide Flussseiten waren mit einem Holzsteg verbunden, der links auf dem mittleren Bild zu sehen ist, unten links flussaufwärts von der Aggerbrücke aus auf den Obstbungert hinter der Burg Lohmar gesehen. Oben Mitte: ein Blick vom Kinderdorf Haus Hollenberg aus auf die mit Lindenbäumen bestandene Allee, vom praktisch noch unbebauten Donrather Dreieck, zum nördlichen Ortseingang mit dem Verbindungsweg von der Hauptstraße 1, des Polizeipostens, zur Fuchsfarm im Jabachtal, die Bewohner des Hauses Nr. 1 waren die Familie Pack, deren beiden Töchter in Lohmar zur Schule gingen. Rechts oben der Blick auf die Aggerbrücke vom Spätenbergberg aus ins Sülztal mit Rottland und Pützrath. In der Mitte rechts ein Blick vom Auelsfeld Richtung Lohmar-Ort. Im Hintergrund die Hardt mit der Waldkulisse des Lohmarer Waldes. Rechts unten eine Partie an der Agger in Höhe der Einmündung der Sülz: während es heute im Umkreis von Lohmar und Wahlscheid genügend Schwimmbäder gibt, war es früher Gang und Gäbe, im Sommer an warmen Tagen in der Agger schwimmen zu gehen. Beliebte Stellen waren für die meist jugendlichen Badegäste des Kirchdorfs und des Oberdorfs, wie der Bildausschnitt zeigt, an der linken Uferseite unterhalb des Scharfeberges, dort wo die Sülz in die Agger mündet. Die Altenrather Jugend blieb auf der Altenrather Seite, der rechten Uferseite, sie badeten Nahe der Einmündung des Witzenbachs. Der zunehmenden Freizeit- und Erholungswert, der auch heute noch und im Prinzip zu allen Zeiten, von Campingfreunden in weiten Flächenteilen der Uferregion der Agger wie auf der Karte zu sehen ist, als idyllisch angesehen wird, unterliegt heute einer kritischen Betrachtung. Die Campingplätze bzw. mittlerweile ja bereits feste Wochenendhaussiedlungen mit festinstallierten Wohnwagen sollen aus dem Auenbereich weiter ins Landesinnere verlegt werden. Entlang der Agger soll gemäß dem Gewässerauenkonzept Agger von Dezember 2004 ein Dynamikraum für eine freie Gewässerentfaltung ausgewiesen werden. Dies wurde bei dem ehemaligen Campingplatzgelände in Donrath Mitte der 1990er Jahre bereits vorgreifend durchgeführt. Der Platz wurde aufgegeben und die baulichen Anlagen beseitigt. | |
|
1955
Das Bild der Agger – gesehen von der Lohmarer Seite in Höhe des heutigen Campingplatzes in Richtung Troisdorfer Seite – zeigt am linken Ufer die Anfänge des Campingplatzes Lohmar, Mitte der 1950er Jahre. Beide Flussseiten waren mit einem hier nicht... Das Bild der Agger – gesehen von der Lohmarer Seite in Höhe des heutigen Campingplatzes in Richtung Troisdorfer Seite – zeigt am linken Ufer die Anfänge des Campingplatzes Lohmar, Mitte der 1950er Jahre. Beide Flussseiten waren mit einem hier nicht sichtbaren Holzsteg verbunden. Die Postkarte, Luftkurort Lohmar i. Aggertal, ist am 18.7.1962 nach Amsterdam gelaufen. Die damalige Pächterin des Campingplatzes Lohmar, Katharina Heimig, hatte sie unter der Nr. 5802/4 drucken lassen. | |
|
1930
- 1939 Eine Postkarte aus den 1930er Jahren zeigt den Park des früheren Kindererholungsheims „Haus Lohmarhöhe“. Ebenfalls aufschlussreich sind die Fotos von Gerd Streichardt aus den Archiven vom armen Kinde Jesu in Aachen. Das Kindererholungsheim ist in den... Eine Postkarte aus den 1930er Jahren zeigt den Park des früheren Kindererholungsheims „Haus Lohmarhöhe“. Ebenfalls aufschlussreich sind die Fotos von Gerd Streichardt aus den Archiven vom armen Kinde Jesu in Aachen. Das Kindererholungsheim ist in den 1920er Jahren von der Aachener „Kongregation vom armen Kinde Jesus“ am Mühlenweg in Lohmar errichtet worden war. Die Aachener Kongregation ist ein Laienschwester-Orden, der 1844 von Clara Fey gegründet wurde. Nach ihr ist die kleine Straße benannt, die von der Hauptstraße aus nach Lohmarhöhe führt. Der Orden errichtete um 1924 auch ein Schwestern-Erholungsheim am Haus Hollenberg in Donrath, aus welchem in den 1960er Jahren das Kinderdorf Hollenberg entstand. 1966 wurde das Grundstück Lohmarhöhe an die Gemeinde Lohmar verkauft und wurde inzwischen mit modernen Wohnhäusern bebaut. Die Geschichte des Parks von 1900 bis 2014 ist in dem Beitrag (Dokument) von Gerd Streichadt für die Lohmarer Heimatblätter nachzulesen. | |
|
1920
- 1929 Die Ehrentafel der im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten des Turnvereins Breidt stammte in etwa aus den 1920er Jahren, der Inflationszeit, wo so manch einer seine Spareinlagen verloren hatte. Von 23 gefallenen Soldaten der Gemeinde waren alleine 14... Die Ehrentafel der im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten des Turnvereins Breidt stammte in etwa aus den 1920er Jahren, der Inflationszeit, wo so manch einer seine Spareinlagen verloren hatte. Von 23 gefallenen Soldaten der Gemeinde waren alleine 14 Tote vom Turnverein Breidt zu beklagen. | |
|
1935
- 1939 Das Foto auf dieser Postkarte aus den 1930er Jahren wurde vom Heppenberg aus in halber Höhe über der Dornhecke gemacht. Auf der Rückseite der Postkarte steht: Besucht die herrlichen Sommerfrischen des Aggertales. Man sieht Nr.1 die Jabachtalstraße,... Das Foto auf dieser Postkarte aus den 1930er Jahren wurde vom Heppenberg aus in halber Höhe über der Dornhecke gemacht. Auf der Rückseite der Postkarte steht: Besucht die herrlichen Sommerfrischen des Aggertales. Man sieht Nr.1 die Jabachtalstraße, Nr. 2 das Sägewerk Braun, Nr. 3 und 4 die Häuser Krumbe und Peter Broich, Nr. 5 das Haus von Willibert Jakobs, Nr. 6 das Haus Hasselssiefen auf der Kuttenkaule, Nr 7 das Haus Siebertz (ehemal. Bürgermeisteramt), Nr. 8 Haus Weingarten (de Krockpaasch), Nr. 9 Gaststätte „Altes Haus“?, Nr. 10 Haus Kreuz, Nr. 11 das alte Fährhaus (Fahr Wellem) und 12. das Haus Frecking. Verlag P. Pape, Fotograf, Lohmar-Rhld. (er hatte sein Fotogeschäft im späteren Eissalon auf der Hauptstraße, später in der Kirchstraße Nr. 4 – sein Nachfolger war Willy Küpper) | |
Dieses Foto, eine Postkarte aus der Zeit um 1930 zeigt Donrath mit Blick vom Heppenberg aus nach Donrath und zum Jabachtal. Im Vordergrund ganz rechts hinter dem Gebüsch Haus Marx und van der Viefen, dahinter am rechten Bildrand der Kreuzerhof in... Dieses Foto, eine Postkarte aus der Zeit um 1930 zeigt Donrath mit Blick vom Heppenberg aus nach Donrath und zum Jabachtal. Im Vordergrund ganz rechts hinter dem Gebüsch Haus Marx und van der Viefen, dahinter am rechten Bildrand der Kreuzerhof in Sottenbach, der auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Er wurde bereits im frühen 16. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Die alte fünfbogige Brücke über die der alte Verlauf der Straße vom Sülztal über Pützrath und Rottland zum Aggertal verlief, kann man über der rechten Hälfte des langgestreckten Fachwerkgebäudes erkennen. Dort wo die Brückenrampe auf die B 484 die Straße ins Aggertal führte war rechter Hand die Krautfabrik von Johann Weingarten. Hinter den Bäumen kommt das Krüppelwalmdach des Görreshofs, auch Jörgeshof genannt, hervor. Weiter links sind Haus Sieberts und das Hotel, Restaurant „Zur Aggerburg“, hell verputzt nur zu erahnen. Ganz links das Sägewerk von Paul Braun (heute Overath). Im Hintergrund oberhalb der Kuttenkaule und Falmerswiese, die noch vollkommen unbebaut ist, erkennt man Haus Hasselssiefen, dass eine Zeitlang Erholungsheim für erholungssuchende Priester war und später Rektor Klein gehörte, dieser vermachte es 1909/10 an die Augustiner Chorfrauen aus Essen. | |
|
15. August 1909
In die Marianische Kongregation der Jungfrauen wurde aufgenommen Sibilla Küpper Präfektin: Maria Eschweiler Weiheakt. Heilige Maria, Muttergottes und Jungfrau! Ich Sibilla Küpper erwähle dich... In die Marianische Kongregation der Jungfrauen wurde aufgenommen Sibilla Küpper Präfektin: Maria Eschweiler Weiheakt. Heilige Maria, Muttergottes und Jungfrau! Ich Sibilla Küpper erwähle dich heute zu meiner Gebieterin, Beschützerin und Fürsprecherin, und nehme mir fest vor, dich nie zu verlassen und weder selbst je etwas gegen dich zu sagen oder zu thun, noch zuzulassen, daß von meinen Untergebenen je etwas wider deine Ehre geschehe. Ich bitte dich daher, nimm mich an zu deiner ewigen Dienerin; stehe mir bei in allen meinen Handlungen und verlaß mich nicht in der Stunde meines Todes. Amen. ~~~~~~~~~~~~~~
| |
|
2. Januar 1899
„Die besten Glückwünsche zum neuen Jahr sendet Frau Jacobs.“ Die Absenderin wohnte in Winkel und ließ wohl die Karte von einem ihrer Kinder zur Postagentur Birk beim Gastwirt Matthias Weber in Neuenhaus bringen. Von dort ist die Karte laut... „Die besten Glückwünsche zum neuen Jahr sendet Frau Jacobs.“ Die Absenderin wohnte in Winkel und ließ wohl die Karte von einem ihrer Kinder zur Postagentur Birk beim Gastwirt Matthias Weber in Neuenhaus bringen. Von dort ist die Karte laut Poststempel am 2. Januar 1899, vormittags zwischen 7 und 8 Uhr abgegangen. Die Postbeförderung zwischen Birk und Köln verlief, dank der Eisenbahn ab Siegburg, erstaunlich schnell, denn am gleichen Tag drückte das Postamt der Empfängerin „Cöln –Nippes 2“ den dortigen Stempel mit dem Datum 2.1.99, 7-8 N (Nachmittag – Abend) auf. Die hübsche Karte mit Rankenwerk in Rokokomanier und Blümchen, verlegt von J. Heinz, Alter Markt 64, Köln, war vom Gastwirt Robert Schwamborn spätestens 1898 in Auftrag gegeben worden. Sehr fantasievoll stellt er sein Gasthaus mit der „Dampf-Kornbranntweinbrennerei“ vor. Ein dünnes Rohr soll vermutlich den Dampf ablassen, während ein hoher Schlot mächtigen Rauch entlässt, der gleichzeitig eine fabrikähnliche Situation vermitteln soll. Dem entspricht auch der zum Transport gelagerte Stapel von Fässern. Natürlich fehlen nicht die Leute vor der Gasthaustür, Preußens und des Reiches Fahnen auf dem Dach und die Kutsche eines vornehmen Gastes, vielleicht die des Bürgermeisters Baron Carl von Francken. Eine Empfehlung des Mitgliedes der „Bürgermeistereiversammlung Lohmar“ R. Sch. an seinen Ratsvorsitzenden ist wohl dessen Rittergut Haus Freiheit in Inger. Die prächtigen 500-jährigen Linden, die bis 1958 immer noch gleichaltrig blieben, die klassische Dorfansicht mit Kirche, Schule, Gasthof zum Kaisersaal und umgebender Bebauung beschließen die Miniatur und Idylle und lassen noch einen kleinen Raum für wenige Worte übrig. | |
|
2. Januar 1899
„Die besten Glückwünsche zum neuen Jahr sendet Frau Jacobs.“ Die Absenderin wohnte in Winkel und ließ wohl die Karte von einem ihrer Kinder zur Postagentur Birk beim Gastwirt Matthias Weber in Neuenhaus bringen. Von dort ist die Karte laut... „Die besten Glückwünsche zum neuen Jahr sendet Frau Jacobs.“ Die Absenderin wohnte in Winkel und ließ wohl die Karte von einem ihrer Kinder zur Postagentur Birk beim Gastwirt Matthias Weber in Neuenhaus bringen. Von dort ist die Karte laut Poststempel am 2. Januar 1899, vormittags zwischen 7 und 8 Uhr abgegangen. Die Postbeförderung zwischen Birk und Köln verlief, dank der Eisenbahn ab Siegburg, erstaunlich schnell, denn am gleichen Tag drückte das Postamt der Empfängerin „Cöln –Nippes 2“ den dortigen Stempel mit dem Datum 2.1.99, 7-8 N (Nachmittag – Abend) auf. Die hübsche Karte mit Rankenwerk in Rokokomanier und Blümchen, verlegt von J. Heinz, Alter Markt 64, Köln, war vom Gastwirt Robert Schwamborn spätestens 1898 in Auftrag gegeben worden. Sehr fantasievoll stellt er sein Gasthaus mit der „Dampf-Kornbranntweinbrennerei“ vor. Ein dünnes Rohr soll vermutlich den Dampf ablassen, während ein hoher Schlot mächtigen Rauch entlässt, der gleichzeitig eine fabrikähnliche Situation vermitteln soll. Dem entspricht auch der zum Transport gelagerte Stapel von Fässern. Natürlich fehlen nicht die Leute vor der Gasthaustür, Preußens und des Reiches Fahnen auf dem Dach und die Kutsche eines vornehmen Gastes, vielleicht die des Bürgermeisters Baron Carl von Francken. Eine Empfehlung des Mitgliedes der „Bürgermeistereiversammlung Lohmar“ R. Sch. an seinen Ratsvorsitzenden ist wohl dessen Rittergut Haus Freiheit in Inger. Die prächtigen 500-jährigen Linden, die bis 1958 immer noch gleichaltrig blieben, die klassische Dorfansicht mit Kirche, Schule, Gasthof zum Kaisersaal und umgebender Bebauung beschließen die Miniatur und Idylle und lassen noch einen kleinen Raum für wenige Worte übrig. | |
|
1930
- 1939 Diese Mehrbildkarte, im oberen Bild als Gesamtansicht zeigt Lohmar der 1930er Jahre von Südosten. Links unten weist die Fotografie die Kolonialwarenhandlung der Eheleute E. Oligschäger aus Lohmar auf, die 1907 von den Eltern von Karl Scheiderich... Diese Mehrbildkarte, im oberen Bild als Gesamtansicht zeigt Lohmar der 1930er Jahre von Südosten. Links unten weist die Fotografie die Kolonialwarenhandlung der Eheleute E. Oligschäger aus Lohmar auf, die 1907 von den Eltern von Karl Scheiderich erworben wurde. Das Anwesen stand unmittelbar rechts neben dem Verbindungsweg (im Volksmund „Saujässje“ genannt), der auf dem Bild nicht sichtbar ist. Bis Mitte der 1980er Jahre betrieben die Eheleute Carl und Elisabeth Scheiderich hier eine Kolonialwarenhandlung mit Drogerie und später spezialisierten sie sich auf Weine und Spirituosen. Heute ist hier das Wohn- und Geschäftshaus von Adi Arz errichtet. Rechts unten ist das 1908 fertiggestellte Amtsgebäude des Bürgermeisters Polstorff zu sehen. Es diente bis zum Bau des neuen Rathauses 1966 als Bürgermeister- und Standesamt. | |
|
26. März 1935
Johann Otten aus Weegen, der sich 1930 – von Köln kommend – mit seinem Zelt in der Dornhecke in Donrath an der Agger niederließ, wurde „der erste Camper an der Agger“ genannt. Das könnte als Anhaltspunkt dienen für den etwaigen Beginn der... Johann Otten aus Weegen, der sich 1930 – von Köln kommend – mit seinem Zelt in der Dornhecke in Donrath an der Agger niederließ, wurde „der erste Camper an der Agger“ genannt. Das könnte als Anhaltspunkt dienen für den etwaigen Beginn der Campingbewegung an der Agger. Wenn die dann, wie auf dieser Postkarte von vor 1935 (der Poststempel ist vom 26.3.1935) zu sehen ist, in ein paar Jahren so rasant zugenommen hatte, dass die Wiesen beidseits der Agger voller Erholungssuchenden waren, hatte die Gemeinde Lohmar diesen Trend schnell erkannt. Das Foto wurde von der Aggerbrücke flussabwärts gemacht. Rechts auf der Troisdorfer Seite ist auf der Mitte der Wiese ein Banner gehisst und am Waldrand scheinen auch schon kleine Toilettenhäuschen vorhanden zu sein. Die Camper waren überwiegend Kölner, die an Wochenenden oder Feiertagen mit dem Fahrrad, motorisiert oder mit der Bahn anreisten. Anfangs fuhren die meisten abends wieder nach Hause. Doch je mehr Camper sich ein Zelt leisten konnten, desto mehr blieben auch über Nacht. Auf dem Foto sind immerhin schon 15-20 Zelte zu erkennen. | |
Diese Postkarte ist ein Foto mit Blick vom Ziegenberg auf Lohmar-Mitte von etwa 1937. Vorne rechts ist das Fichtenwäldchen neben der Burg in dem der „Kradepool“ (Krade = Frösche) war, ein kleiner sumpfiger Weiher, auf dem die Kirchdorfskinder im... Diese Postkarte ist ein Foto mit Blick vom Ziegenberg auf Lohmar-Mitte von etwa 1937. Vorne rechts ist das Fichtenwäldchen neben der Burg in dem der „Kradepool“ (Krade = Frösche) war, ein kleiner sumpfiger Weiher, auf dem die Kirchdorfskinder im Winter gerne Eishockey spielten. Darüber das Kirchdorf mit Pützerhof, Neuhof und Scheune des Küsterhauses und darüber am rechten Bildrand das Sägewerk Pfennig. Links neben dem Kirchturm ist das Pastorat (das Wohnhaus des Pfarrers), etwas höher die neueren Häuser des Kirchdorfes und links davor das Doppelhaus Henseler / Heß (Altenrather Str. 1/3). Weiter links ist die Altenrather Straße mit den frisch bezogenen Häusern der von Altenrath übergesiedelten Familien Eschbach (Nr. 6), Bürvenich (Nr. 8) und Ennenbach (Nr. 10). Im Hintergrund, „Auf der Hardt“, sind nur vereinzelt Häuser zu sehen, davor sind bis zur Bachstraße nur Felder, Wiesen und ein Obstbungert. | |
Der obere Teil dieser Mehrbildkarte, um 1950 herum entstanden, zeigt den Blick ins Aggertal auf die Weiler Müllerhof und Aggerhof im damaligen „Jronk“ (Grund) des heitigen Zentralortes Wahlscheid. Links unten ist die Scheiderhöher Straße der... Der obere Teil dieser Mehrbildkarte, um 1950 herum entstanden, zeigt den Blick ins Aggertal auf die Weiler Müllerhof und Aggerhof im damaligen „Jronk“ (Grund) des heitigen Zentralortes Wahlscheid. Links unten ist die Scheiderhöher Straße der gleichnamigen Ortschaft Scheiderhöhe. Hier gab es zwei „Tante-Emma-Läden“, zwei Gasthäuser mit angeschlossenen Tanzsälen und am Ende auf der rechten Seiten die Kirche. Der hauptsächliche Erwerbszweig der Ansiedlung waren Ackerbau und Grünlandwirtschaft. Die Firma ABS-Pumpen hat den Wandel dieses landwirtschaftlich geprägten Ortes wesentlich bestimmt. In den 60er und 70er Jahren wuchs das Unternehmen, angesiedelt mitten im Dorfzentrum, enorm, schaffte Arbeitsplätze und ließ immer mehr Menschen sich in der Umgebung ansiedeln und Scheiderhöhe dadurch wachsen. | |
|
1950
- 1959 Die Agger (achera, acher von althochdeutsch.: Aha, gothisch: ahva = Wasser, Fluss) entspringt etwas südlich von Meinerzhagen im Grenzgebiet zwischen Bergischem Land und südlichem Sauerländer Bergland. Das Aggertal, wie diese Postkarte der 50er Jahre... Die Agger (achera, acher von althochdeutsch.: Aha, gothisch: ahva = Wasser, Fluss) entspringt etwas südlich von Meinerzhagen im Grenzgebiet zwischen Bergischem Land und südlichem Sauerländer Bergland. Das Aggertal, wie diese Postkarte der 50er Jahre zeigt, gehört zu den schönsten und wechselreichsten Tälern des Bergischen Landes. Der Vers im rechten unteren Eck „Wer einmal an der Agger war, den hat’s noch nie gereut, verbringt man doch, wie jedes Jahr, dort seine schönste Urlaubszeit“ betont diese Reize des Tals. Eine kleine Teilansicht zeigt die Staumauer der Aggertalsperre bei Bergneustadt. Bis Oktober 1928 gingen die Baumaßnahmen an der Staumauer zügig voran. Doch dann ereignete sich ein tragischer Unfall, bei dem fünf Arbeiter den Tod fanden. Erst am 18.10.1929 war es dann so weit und man konnte mit dem Einstau beginnen. Die alte Ortschaft Becke im Genkelarm und ein Teil der Ortschaft Bruch wurden überflutet. Weitere Ausschnitte zeigen eine Ansicht des Aggertals, im Vordergrund Neuhonrath, Honsbach, Naafshäuschen, den Stausee mit dem Wasserkraftwerk Ehreshoven II und ein Stück Badestrand in Lohmar. | |
|
1950
Foto oben: Ansicht Birk von „Auf der Löh“ mit der alten Schule, der Kirche und einem Maibaum. Auf der damaligen Wiesenfläche stehen heute das neue Schulgebäude und das Bürgerhaus. Ferner befindet sich dort der erweiterte Friedhof. Die Umgebung links... Foto oben: Ansicht Birk von „Auf der Löh“ mit der alten Schule, der Kirche und einem Maibaum. Auf der damaligen Wiesenfläche stehen heute das neue Schulgebäude und das Bürgerhaus. Ferner befindet sich dort der erweiterte Friedhof. Die Umgebung links der Birker Straße ist inzwischen bis nach Inger bebaut. Foto des Ortskerns: links das Kaufhaus Else Ort, in der Mitte die Metzgerei Hubert Müller und rechts die Schlosserei Josef Merten. Foto unten rechts: Die Pfarrkirche von Nordosten mit Zugang zum Pfarrhaus | |
|
1950
- 1959 Das Foto oben zeigt den Aueler Hof aus den 50er Jahren. Im unteren Bildteil zeigt diese Grußkarte den wunderschönen Kurgarten, der sich vom Gasthof bis zur heutigen Tankstelle Wasser erstreckte. Das Rondell in der Mitte war bis in die 50er Jahre ein... Das Foto oben zeigt den Aueler Hof aus den 50er Jahren. Im unteren Bildteil zeigt diese Grußkarte den wunderschönen Kurgarten, der sich vom Gasthof bis zur heutigen Tankstelle Wasser erstreckte. Das Rondell in der Mitte war bis in die 50er Jahre ein Springbrunnen mit Seerosen und Goldfischen, er wurde später, wie auf Bild zu erkennen als Rosenbeet genutzt. Dahinter erkennt man die Konturen der romantischen Rosenlaube mit einem schmiedeeisernen Rankgitter. Im Sommer war die Laube für die Gäste attraktiv, weil man hier ein Ausblick auf den großen Garten und die Gäste hatte. | |
Die Mehrbildkarte von Lohmar der 1950er Jahre zeigt unten rechts das Bergmann-Erholungsheim „Villa Therese“ traufeseitig und links unten giebelseitig mit Parkanlage. Oben links ist die Autobahn Köln-Frankfurt zu sehen. Auf dem mittleren Bild unten... Die Mehrbildkarte von Lohmar der 1950er Jahre zeigt unten rechts das Bergmann-Erholungsheim „Villa Therese“ traufeseitig und links unten giebelseitig mit Parkanlage. Oben links ist die Autobahn Köln-Frankfurt zu sehen. Auf dem mittleren Bild unten sind die Poststation, die Bäckerei Liesenfeld und das Reisebüro Schwamborn. Ein Blick auf Alt-Lohmar, aufs Kirchdorf, findet sich rechts oben. Luftkurort oder staatlich anerkannter Luftkurort ist das in Deutschland am stärksten verbreitete Prädikat für Kurorte. Die Bezeichnung Luftkurort für Lohmar wurde von Anfang der 1920er Jahre bis Mitte der 1950er genutzt. Das Prädikat wurde hauptsächlich deshalb erworben, weil der Tourismus in Lohmar und im unteren Aggertal eine Zeit lang eine große Rolle spielte. In einem Luftkurort kann aufgrund natürlicher klimatischer Umweltreize eine Heilungsbeschleunigung bestimmter Erkrankungen erfolgen. Man spricht von einer Form der Klimatherapie. Gelaufen ist die Karte 1953. | |
|
1950
- 1959 Mitte der 1950er Jahre erschien diese Postkarte der Siedlung Pützerau, im Südosten des Ortes Lohmar gelegen. Das Foto zeigt eine Teilansicht des Talwegs, der seinen Namen von der damals jährlich stattfindenden Rochusprozession, über Rotenbacher Hof... Mitte der 1950er Jahre erschien diese Postkarte der Siedlung Pützerau, im Südosten des Ortes Lohmar gelegen. Das Foto zeigt eine Teilansicht des Talwegs, der seinen Namen von der damals jährlich stattfindenden Rochusprozession, über Rotenbacher Hof und Kaldauen, nach Seligenthal hatte, des heutigen Straßenzugs Pützerau. Die Siedlungsarbeiten der „Alt-Siedlung Pützerhau“ begannen bereits 1933 mit den ersten zwei Doppelhäusern und wurde am 21.2.1935 mit den typischen Blockhäusern und einem Antrag der Bauherrschaft auf Eigentum oder Erbaurecht abgeschlossen. Die mit den Holzhäusern entstandene Siedlung wurde in Verballhornung der Trapper-Blockhütten scherzhaft „Klein-Alaska“ genannt. Die ersten Siedler der rechten Seite waren: Eheleute Jakob Müller / Eheleute Karl Kurtsiefer (1. Doppelhaus), Eheleute Wilhelm Pauli / Eheleute Johann Lüdenbach (2. Doppelhaus), Eheleute Peter Arnold / Eheleute Peter Rottländer (3. Doppelhaus), Eheleute Josef Blum / Eheleute Otto Schug (4. Doppelhaus) und das Einzelhaus der Eheleute Johann Burger (Margarete „Eta“ Burger). Auf der linken Straßenseite wurden zwischen 1950 und 1952 die ersten Doppelhäuser, dieses Mal aus Stein und Beton, gebaut. Die Eigentümer dieser Neubauten waren: Eheleute Paul Fischer / Eheleute Erich Rathmann (1. Doppelhaus), Eheleute Familie Papenfuß / Familie Dzialas (2. Doppelhaus), Familie Haller / Familie Rottländer (3. Doppelhaus), Familie Wermelskirchen / Familie Pick, die Eltern von Hans-Günter Pick (4. Doppelhaus). Heutzutage sind diese Häuser durch umfangreiche Umbaus- und Modernisierungsmaßnahmen bis auf wenige Ausnahmen kaum wiederzuerkennen. | |
|
1950
- 1959 Diese Lithographie aus den 1950er Jahren mit den besten Wünschen zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel mit bekanntem Motiv aus Lohmar zeigt das verschneite Kirchdorf von Südwesten: den Pützerhof, den Neuhof und den Giebel des Fachwerkhofs von... Diese Lithographie aus den 1950er Jahren mit den besten Wünschen zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel mit bekanntem Motiv aus Lohmar zeigt das verschneite Kirchdorf von Südwesten: den Pützerhof, den Neuhof und den Giebel des Fachwerkhofs von Peter Kurtsiefer, heute Hans Keuler | |
|
11. Juli 1955
Auf der Fotopostkarte mit Poststempel vom 11.7.1955 ist in der Mitte das evangelische Altenheim auf dem Rösemig in Wahlscheid abgebildet. Es wurde am 14.12.1951 eingeweiht. 56 alte Menschen zogen in das neue Heim. Inzwischen ist das Haus viermal... Auf der Fotopostkarte mit Poststempel vom 11.7.1955 ist in der Mitte das evangelische Altenheim auf dem Rösemig in Wahlscheid abgebildet. Es wurde am 14.12.1951 eingeweiht. 56 alte Menschen zogen in das neue Heim. Inzwischen ist das Haus viermal erweitert und modernisiert worden. Von 1999-2003 erfolgte der bisher letzte umfassende Neu- und Umbau. Das evangelische Altenheim ist heute mit seinen 88 Einzelzimmern und 12 Doppelzimmern und der modernen Architektur erneut zukunftsweisend. Auf der rechten Bildseite erkennt man einen Güterwaggon an der Verladerampe des Bahnhofs. Die Proteste der Gemeinden Overath, Wahlscheid und Lohmar konnten nicht verhindern, dass der Personenverkehr auf der Strecke „vorläufig“, wie es im damaligen Sprachgebrauch hieß, eingestellt wurde. Am 1.5.1962 kam das endgültige „Aus“ mit der Einstellung jeglichen Verkehrs, auch des Güterverkehrs auf der Strecke Overath bis Donrath. 1962 wurden die Gleise demontiert. Der Bahndamm wurde zum Teil für die Umgehungsstraße von Wahlscheid genutzt. Auf der Laderampe für den Güterverkehr entstand das Forum Wahlscheid. Auf dem nördlichen Teil des ehemaligen Güterbahnhofes wird heute die Wahlscheider Kirmes gefeiert. | |
|
1960
- 1969 Auf der Karte aus den 1960er Jahren ist schon zu erkennen, wie Schachenauel und Neuhonrath zusammenwachsen. Mit der Siedlung an der Pfarrer-Tholen-Straße begann diese Entwicklung. Es folgten weitere Siedlungen am Rotdornweg, die so genannte... Auf der Karte aus den 1960er Jahren ist schon zu erkennen, wie Schachenauel und Neuhonrath zusammenwachsen. Mit der Siedlung an der Pfarrer-Tholen-Straße begann diese Entwicklung. Es folgten weitere Siedlungen am Rotdornweg, die so genannte Pemosiedlung, mit Häusern im holländischen Baustil, und später die Bauernsiedlung für Flüchtlingsfamilien aus Siebenbürgen an der Hermannstädter- und Kronstädter Straße. Heute heißt der Ortsbereich östlich der Agger, angefangen vom Schul- und Sportzentrum bis Honsbach einschließlich Schachenauel, „Neuhonrath“. An die alten Dorfnamen erinnern nur noch die Straßenamen, wie Schachenaueler Straße, Honsbacher Straße, Krebsaueler Straße, Auf der Baach und Bachermühle. | |
Auf der Mehrbildkarte ist links das Hotel Schnitzler vor dem Krieg zu sehen und rechts die „Gaststätte Schnitzler“ in den 1960er Jahren. Johann Hermanns aus Altenrath, der am 1.2.1887 von Johann Altenhofen den späteren „Schulteshof“ (heute „Lohmarer... Auf der Mehrbildkarte ist links das Hotel Schnitzler vor dem Krieg zu sehen und rechts die „Gaststätte Schnitzler“ in den 1960er Jahren. Johann Hermanns aus Altenrath, der am 1.2.1887 von Johann Altenhofen den späteren „Schulteshof“ (heute „Lohmarer Höfe“) als Gaststätte mit Kegelbahn pachtete, baute 1893 daneben auf die Ecke Hauptstraße/ Kirchstraße ein dreistöckiges Gebäude mit angebautem Saal, den „Gasthof zum Aggerthal“. Nach seinem Tod am 13.8.1906 verkaufte seine Tochter Maria den Betrieb an ihren Oberkellner Johann Schnitzler, der ihn „Hotel Schnitzler“ nannte. Johann Schnitzler erhielt am 24.6.1907 die Konzession für sein Hotel. In der Nacht vom 17. auf den 18.3.1945 wurde der Saal von Bomben getroffen und brannte ab. Das Feuer griff auch auf das Haupthaus über, das auch ausbrannte. Dabei fielen große Teile des Gebäudes auf das Nebenhaus Schultes. Johann Schnitzler starb am 24.4.1946. | |
Diese Art von Ansichtskarten war um die Jahrhundertwende sehr beliebt. Der Gruß aus Franzhäuschen lockt mit einem besonderen Angebot, das allerdings nur teilweise realisiert werden konnte. Gegenüber dem Gasthaus westlich der Einmündung der... Diese Art von Ansichtskarten war um die Jahrhundertwende sehr beliebt. Der Gruß aus Franzhäuschen lockt mit einem besonderen Angebot, das allerdings nur teilweise realisiert werden konnte. Gegenüber dem Gasthaus westlich der Einmündung der Franzhäuschenstraße in die Zeithstraße ist ein wahrer „Vergnügungspark“ mit Loggia, mit Pavillon, Karrussel und einem ausgedehnten Biergarten vorgetäuscht. Vorhanden war ein kleiner Kinderspielplatz, in der Loggia wurden Tische und Stühle für den Außenbereich der Gaststätte gelagert. Trotzdem, schön waren sie die Spaziergänge mit den Eltern nach Franzhäuschen, wo es für die Kinder „Zitsch“, das ist Sprudel mit Zitronengeschmack, gab. | |
|
22. August 1901
Die Lithographie mit einem Poststempel vom 22.8.1901 zeigt das alte Kirchdorf Wahlscheid mit der evangelischen Kirche St. Bartholomäuskirche, dem alten Marktplatz mit seiner Dorfl inde und dem Restaurant Breideneichen, heute Akzent-Aggertal-Hotel... Die Lithographie mit einem Poststempel vom 22.8.1901 zeigt das alte Kirchdorf Wahlscheid mit der evangelischen Kirche St. Bartholomäuskirche, dem alten Marktplatz mit seiner Dorfl inde und dem Restaurant Breideneichen, heute Akzent-Aggertal-Hotel „Zur alten Linde“. Das Haus wird in der 3. Generation von der Familie Dowideit betrieben. Bereits 1166 wird die Kirche in einer Urkunde genannt. Die alte, wahrscheinlich noch aus romanischer Zeit stammende Kirche von Wahlscheid, die seit 1557 als evangelisch bezeichnet wurde und 1645 dann endgültig an die Protestanten übergegangen war, befand sich Anfang des 19. Jahrhunderts in einem so schlechten Bauzustand, dass sie im Jahre 1813 wegen Baufälligkeit abgerissen wurde. | |
|
3. Juli 1901
Die Deutsche Reichspostkarte mit Bahnpoststempel vom 3.7.1901 zeigt die Gastwirtschaft und Handlung von Hermann Grotegut an der heutigen L 84 in Durbusch. Die wirtschaftliche Entwicklung änderte sich mit dem Beginn des industriellen Bergbaus um 1830... Die Deutsche Reichspostkarte mit Bahnpoststempel vom 3.7.1901 zeigt die Gastwirtschaft und Handlung von Hermann Grotegut an der heutigen L 84 in Durbusch. Die wirtschaftliche Entwicklung änderte sich mit dem Beginn des industriellen Bergbaus um 1830 im Lüderich. Auch andere Industriebetriebe, wie die Firma Reusch in Hoffnungsthal, brachten neue Erwerbsmöglichkeiten. Damit traten auch Mitte des 19. Jahrhunderts Handwerk und Gewerbe sowie Gastwirtschaften stärker in Erscheinung, besonders an den damals bedeutenden Verkehrsverbindungen, wie der Straße von Scheiderhöhe über Durbusch nach Heiligenhaus. Die Familie Hermann Vierkötter war zuletzt Eigentümer der Gastwirtschaft und des Lebensmittelgeschäftes. Heute wird das Gebäude als Wohnung genutzt. | |
|
24. Juli 1904
Diese am 24.7.1904 mit der Bahnpost gelaufene Postkarte im Jugendstil mit zwei Ansichten von Lohmar, verschnörkelt mit Weinlaub eingefasst, zeigt links das Hotel Restaurant Hermanns und rechts das Kirchdorf, mit Kirche und dem alten Pfarrhaus, das... Diese am 24.7.1904 mit der Bahnpost gelaufene Postkarte im Jugendstil mit zwei Ansichten von Lohmar, verschnörkelt mit Weinlaub eingefasst, zeigt links das Hotel Restaurant Hermanns und rechts das Kirchdorf, mit Kirche und dem alten Pfarrhaus, das der amtierende Pfarrer Düsterwald 1897 errichten ließ. Scheune und Stall wurden erst 1908 angebaut. Das Baukapital beschaffte sich der Pfarrer aus dem Einschlag und dem Holzverkauf des Pfarrwaldes. | |
|
12. Juni 1905
Auf dieser Mehrbildpostkarte von vor 1905 (der Poststempel ist vom 12.6.1905) ist oben links die alte zweibogige Stahlbrücke über die Agger von 1899 und oben rechts eine Totalansicht von Lohmar mit Blick von der Hardt zu sehen. Unten links ist das... Auf dieser Mehrbildpostkarte von vor 1905 (der Poststempel ist vom 12.6.1905) ist oben links die alte zweibogige Stahlbrücke über die Agger von 1899 und oben rechts eine Totalansicht von Lohmar mit Blick von der Hardt zu sehen. Unten links ist das Hotel-Restaurant von Johann Hermanns, später Johann und dann Peter Schnitzler abgebildet. Neben dem Hotel steht das Haupthaus des „Schulteshofes“, in dem Johann Hermanns 1887 – vor dem Bau des Hotels – eine Gaststätte mit Kegelbahn gepachtet hatte. (Johann Altenhofen betrieb zuvor die Gaststätte in eigener Regie.) | |
Die Ansichtskarte ist Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Sie trägt den Poststempel vom 28.5.1907 und ist wohl die älteste Postkarte von Naafshäuschen. 1824 wurde Naafshäuschen erstmals als Gaststätte erwähnt, in der schon in früheren Jahren viele... Die Ansichtskarte ist Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Sie trägt den Poststempel vom 28.5.1907 und ist wohl die älteste Postkarte von Naafshäuschen. 1824 wurde Naafshäuschen erstmals als Gaststätte erwähnt, in der schon in früheren Jahren viele Gäste aus nah und fern einkehrten. Zur Gaststätte gehörte eine Pferdewechselstation für Fuhrwerke aus dem Oberbergischen, mit denen landwirtschaftliche Produkte auf den Markt nach Köln transportiert wurden. Die einzige Steigung auf dieser Strecke zwischen Naafshäuschen und Bachermühle konnte nur mit Vorspannpferden überwunden werden. Damals war diese Provinzialstraße noch nicht befestigt. Es wurden Spursteine gelegt, die vermeiden sollten, dass Spurrinnen gefahren wurden. Vor dem Vorspann wurde natürlich ein Fuhrmannskorn getrunken und bei der Rückkehr mit voller Geldbörse noch einmal eingekehrt. Zur Gaststätte gehörte auch eine Beschlagsschmiede für die Pferde und später auch eine Ziegelei. Den Ton holte man in Schachenauel am heutigen Maarweg. Die Ziegel wurden in einem offenen Schuppen luftgetrocknet. Auch eine Tankstelle und ein Kohlehandel wurden von den Eigentümern der Gaststätte in den späteren Jahren betrieben. Die Eigentümer der Gaststätte hießen Naaf und sie gaben der Gaststätte und dem Ort, der ursprünglich Tournisauel hieß, den Namen. In den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts heiratete die Tochter Amalie Naaf den Franz Otto aus Rosauel. Heute ist Dr. Holger Otto in der 6. Generation Eigentümer von Naafshäuschen. Die Fußbrücke in Naafshäuschen wurde 1846 errichtet. Bis dahin bestand nur die Möglichkeit sich von einer Fähre übersetzen zu lassen. Um den Brückenzoll in Wahlscheid zu sparen fuhren viele Bauern mit ihren Karren entlang des Schiefenberges zwischen Wahlscheid und Schachenauel zum Steg in Naafshäuschen . Hier bauten sie ihre Karren auseinander. Die Waren wurden dann hinüber getragen und die Karren auf der anderen Seite wieder zusammengesetzt. | |
|
1910
Zu sehen ist die Aggerbrücke bei Lohmar mit der ehemaligen Lorenbahn. Hier wurden zunächst Erzeugnisse und Baustoffe von einem kleinen Tonwerk mit Sand- und Kiesgrube in Altenrath zum Güterbahnhof nach Lohmar transportiert. Später nutzte ein... Zu sehen ist die Aggerbrücke bei Lohmar mit der ehemaligen Lorenbahn. Hier wurden zunächst Erzeugnisse und Baustoffe von einem kleinen Tonwerk mit Sand- und Kiesgrube in Altenrath zum Güterbahnhof nach Lohmar transportiert. Später nutzte ein hinzugekommenes Tongewinnungsunternehmen dieses „Bähnchen“ ebenfalls für den Transport. Dieses Foto – eine Reproduktion einer Postkarte vermutlich von A. Wacker – wurde 1910 aufgenommen. Mitte des Ersten Weltkriegs wurde die Feldbahn wieder abgerissen, weil sich die Baustoffgewinnung in Altenrath nicht mehr lohnte. | |
Die Heider Kapelle wurde bereits im Jahre 1735 erstmals errichtet, nachdem an gleicher Stelle ein Jahr zuvor ein Missionskreuz aufgestellt worden war. Das jetzige Gebäude, wie es erstmals in einer vierteiligen Ansichtskarte um 1910 dargestellt ist,... Die Heider Kapelle wurde bereits im Jahre 1735 erstmals errichtet, nachdem an gleicher Stelle ein Jahr zuvor ein Missionskreuz aufgestellt worden war. Das jetzige Gebäude, wie es erstmals in einer vierteiligen Ansichtskarte um 1910 dargestellt ist, wurde im Wesentlichen in den Jahren 1843 bis 1845 errichtet. Das Glockentürmchen mit der gedrungenen Zwiebelhaube ist kurz vor 1900 hinzugefügt worden. Dargestellt sind oben links das Bild des Kapellenpatrons, oben rechts eine Gesamtansicht mit mehreren Personen, unten rechts das Innere mit dem barocken Altar. Das große Kreuz vor dem Altar hängt jetzt in der Birker Kirche. Die Personen im Bild links unten sind das Ehepaar Johann Orth aus Heide, der Briefträger Josef Küpper aus Birk mit Dienstfahrrad und zwei Unbekannte. | |
Auf der Postkarte ist der Innenhof von Schloss Auel vor dem Ersten Weltkrieg abgebildet. „Auel“ ist nach H. Dittmaier ein Namenswort, das sich von „ouva“= Wasserland ableitet und bedeutet „eine von drei Seiten umgebene Flusswiese.“ Auf der Postkarte ist der Innenhof von Schloss Auel vor dem Ersten Weltkrieg abgebildet. „Auel“ ist nach H. Dittmaier ein Namenswort, das sich von „ouva“= Wasserland ableitet und bedeutet „eine von drei Seiten umgebene Flusswiese.“ | |
|
1913
Die mit einem Poststempel von 1913 versehene Mehrbildpostkarte mit Ansichten des Stadtteils Donrath zeigt im oberen Teil ein Blick von der Villa Stolzenhöh (dieser Name für das Wohnhaus von Rektor Klein auf der Burghardt, rechts vom... Die mit einem Poststempel von 1913 versehene Mehrbildpostkarte mit Ansichten des Stadtteils Donrath zeigt im oberen Teil ein Blick von der Villa Stolzenhöh (dieser Name für das Wohnhaus von Rektor Klein auf der Burghardt, rechts vom Hasselssiefenbach, ist heute bei den Donrathern nicht mehr bekannt) auf die Hauptstraße, von rechts: das „Weiße Haus“, mit dem Hotel und Gasthof zur Aggerburg von Josef und Ludmilla Böttner, daneben Haus Sieberts (heute Gatzweiler), früher ebenfalls Ludmilla Böttner und die bis 1942 noch intakte, stolze Aggerbrücke, die 1873 erbaut wurde. Sie wurde vom Hochwasser zum Einsturz gebracht. Daneben die sogenannte „Krockpaasch“, die Krautfabrik für Apfel-, Birnen- und Rübenkraut (eingedickter Obst- und Rübensaft als Brotaufstrich) von Johann Weingarten, gebaut um 1870 und betrieben bis in die 1950er Jahre. Das Foto links unten, sowie die weitere Postkarte zeigt nochmals das Hotel Restaurant und Pension „Zur Aggerburg“ mit Kegelbahn, Kahnfahrten und „Fischereigelegenheit“. In der Aggerburg war das 13. Telefon in der Bürgermeisterei installiert, hier führte Josef Böttner gleichzeitig die Postagentur. Ab dem 30.11.1920 (Datum der Konzession) führte Olga Lönqvist diesen Gasthof weiter. Das Bild rechts unten der Mehrbildpostkarte zeigt eine malerische Wald- und Aggerpartie, in der „Donrather Schweiz, dem „Ruheplatz für Kurgäste“. Ein Stück stromabwärts ist noch der eiserne Aggersteg bei der Dornhecke zu erkennen. | |
Der am 13.3.1910 gegründete Turn-Verein Birk (jetzt Turn- und Sportverein TuS) weihte im Jahre 1913 seine jetzt noch bestehende Vereinsfahne ein und ließ aus diesem Anlass eine Erinnerungskarte drucken. Das Motiv der Vorderseite hat einen besonderen... Der am 13.3.1910 gegründete Turn-Verein Birk (jetzt Turn- und Sportverein TuS) weihte im Jahre 1913 seine jetzt noch bestehende Vereinsfahne ein und ließ aus diesem Anlass eine Erinnerungskarte drucken. Das Motiv der Vorderseite hat einen besonderen örtlichen Bezug: Der Fahne und Eichenlaubkranz schwenkende Turner steht „Auf der Löh“. Im Hintergrund grüßen die Birker Wahrzeichen, nämlich die Kirche und die drei Linden. | |
|
26. April 1913
Die Fotokarte zeigt oben links die Kirche St. Mariä Himmelfahrt, Neuhonrath vor dem Ersten Weltkrieg. Die Karte trägt das Datum 26.4.1913. Hinter der Kirche sind der Friedhof und die Gaststätte „Zur Baach“ zu erkennen. Nachdem die Kirchspiele Honrath... Die Fotokarte zeigt oben links die Kirche St. Mariä Himmelfahrt, Neuhonrath vor dem Ersten Weltkrieg. Die Karte trägt das Datum 26.4.1913. Hinter der Kirche sind der Friedhof und die Gaststätte „Zur Baach“ zu erkennen. Nachdem die Kirchspiele Honrath und Wahlscheid seit dem 17. Jahrhundert überwiegend evangelisch waren, wurde für die wachsende Schar der katholischen Bevölkerung 1738 im „neuen Honrath“ in Neuhonrath, im Volksmund „Auf der Baach“ eine katholische Pfarrkirche gebaut. Die Gottesdienste fanden bis 1716 in der St. Johann Baptist Kapelle in Honsbach und bis 1738 in der St. Johannes Nepomuk Kapelle in Haus Auel statt, in der Fotokarte unten links. Das große Kreuz auf der rechten Bildseite, gestiftet 1900 von der Pfarrgemeinde Neuhonrath, steht noch heute auf dem Kirchhof. | |
Diese Fotokarte zeigt die Kahnstation – „Partie am Rudersport“, flussaufwärts gesehen, mit Bootsverleih der Familie Schultheis im Unterdorf von Lohmar, heute Aggerstraße. Die Gaststätte „Zum Rudersport“ erinnert noch an diesen ehemaligen... Diese Fotokarte zeigt die Kahnstation – „Partie am Rudersport“, flussaufwärts gesehen, mit Bootsverleih der Familie Schultheis im Unterdorf von Lohmar, heute Aggerstraße. Die Gaststätte „Zum Rudersport“ erinnert noch an diesen ehemaligen Bootsverleih, der später von der Familie Brüll weitergeführt wurde. | |
|
13. August 1913
Von ihrer Tour ins Aggertal grüßt am 13.8.1913 mit dieser Postkarte die Mutter ihre Tochter Maria Gieraths, die als Haushaltungspersonal in der Eifel arbeitet. Die Gaststätte Hoeck wurde später von seinem Schwiegersohn Josef Heuser übernommen. Von ihrer Tour ins Aggertal grüßt am 13.8.1913 mit dieser Postkarte die Mutter ihre Tochter Maria Gieraths, die als Haushaltungspersonal in der Eifel arbeitet. Die Gaststätte Hoeck wurde später von seinem Schwiegersohn Josef Heuser übernommen. | |
|
29. Juni 1914
Die Karte trägt den Poststempel vom 29.6.1914 und zeigt die 1845 fertig gestellte Chaussee Siegburg–Overath oberhalb der Agger am Kammerberg. Am Kammerberg wurden Steine gebrochen und als Packlage in Hand- und Spanndiensten durch die Landwirte in die... Die Karte trägt den Poststempel vom 29.6.1914 und zeigt die 1845 fertig gestellte Chaussee Siegburg–Overath oberhalb der Agger am Kammerberg. Am Kammerberg wurden Steine gebrochen und als Packlage in Hand- und Spanndiensten durch die Landwirte in die Chaussee eingebaut. | |
|
1914
Diese zweigeteilte Postkarte aus dem Jahre 1914 zeigt rechts zum einen die Schankwirtschaft von Johann Schultheis in einer offenen Halle auf der Parzelle Flur 7 Nr. 96, das Restaurant „Zum Rudersport“, und zum anderen eine Kahnpartie auf der Agger... Diese zweigeteilte Postkarte aus dem Jahre 1914 zeigt rechts zum einen die Schankwirtschaft von Johann Schultheis in einer offenen Halle auf der Parzelle Flur 7 Nr. 96, das Restaurant „Zum Rudersport“, und zum anderen eine Kahnpartie auf der Agger mit dem Bootesverleih. Die Schankerlaubnis der Behörde war mit einer Beschränkung ausgestellt worden: Der Ausschank war nur in der Zeit zwischen dem 1. April und dem 30. September erlaubt. | |
Auf der Postkarte aus dem Jahre 1914 ist die alte Brennerei, genannt „Ahl Brennes“, und rechts daneben die Gaststätte „Aggerhof“ abgebildet. Auf der Postkarte aus dem Jahre 1914 ist die alte Brennerei, genannt „Ahl Brennes“, und rechts daneben die Gaststätte „Aggerhof“ abgebildet. | |
|
11. Dezember 1917
Das Gasthaus „Zum weissen Pferde“ wurde bereits 1821 als Poststation urkundlich erwähnt. Die Ansichtskarte trägt einen Feldpoststempel vom 11.12.1917. Das Haus wurde damals von Otto Klink geführt. Nach seinem Tode übernahm die Familie Kirschbaum die... Das Gasthaus „Zum weissen Pferde“ wurde bereits 1821 als Poststation urkundlich erwähnt. Die Ansichtskarte trägt einen Feldpoststempel vom 11.12.1917. Das Haus wurde damals von Otto Klink geführt. Nach seinem Tode übernahm die Familie Kirschbaum die Gaststätte. Sie heißt heute „Auf dem Berge“. | |
|
1918
Hier ist der Blick auf Lohmar aus Südosten festgehalten worden. Der Fotograf wird in etwa auf dem Grundstück auf der heutigen Waldschule (dem heute bereits abgerissenen zweiten Bauabschnitt) gestanden haben. Zu sehen ist ein praktisch unbebautes... Hier ist der Blick auf Lohmar aus Südosten festgehalten worden. Der Fotograf wird in etwa auf dem Grundstück auf der heutigen Waldschule (dem heute bereits abgerissenen zweiten Bauabschnitt) gestanden haben. Zu sehen ist ein praktisch unbebautes Gelände der Gewann „Greilsberg“ und „Greilsbusch“ am Übergang zur Flur des Lohmarer Gemarkenwaldes. Das unbebaute Weide- und Ackerland sind die heutigen Straßenzüge „Auf der Hardt“ und „Im Korresgarten“. Hier erkennt man, dass der Ort Lohmar um 1920 und danach landwirtschaftlich ausgerichtet war. Im Hintergrund links sieht man die Burg und den Bachhof. In der Bildmitte ist die Waldesruh, die Villa Friedlinde und der Vogtshof an der Bachstraße zu erblicken und rechts daneben hinter dem kleinen Wäldchen die Kieselhöhe und das Oberdorf. | |
Die Postkarte von 1918 aus nördlicher Blickrichtung zeigt oben die „Baach“ und rechts von der katholischen Kirche die alte Schule, das Pastorat und im linken Bild in der Talaue den Ort Schachenauel. Auf dem unteren Bild vor der Gastwirtschaft ist der... Die Postkarte von 1918 aus nördlicher Blickrichtung zeigt oben die „Baach“ und rechts von der katholischen Kirche die alte Schule, das Pastorat und im linken Bild in der Talaue den Ort Schachenauel. Auf dem unteren Bild vor der Gastwirtschaft ist der Zaun des alten Friedhofes zu sehen. Die Gastwirtschaft „Zur Baach“ ist noch heute im Besitz der Familie Schmitz. | |
Inhaber des Gasthauses Paffrath in Pützrath bei Donrath waren Johann und Elisabeth Paffrath, die am 24.4.1913 die Konzession zum Betreiben einer Gast- und Schankwirtschaft erhielten. Heute ist hier, am Pützrather Weg 1, die Gaststätte, das Café und... Inhaber des Gasthauses Paffrath in Pützrath bei Donrath waren Johann und Elisabeth Paffrath, die am 24.4.1913 die Konzession zum Betreiben einer Gast- und Schankwirtschaft erhielten. Heute ist hier, am Pützrather Weg 1, die Gaststätte, das Café und die Musikkneipe “Flohberg” (ab und an „Schwoof”). Die Sülztalstraße in der heutigen Form gab es noch nicht; diese wurde im Sepember 1933 nach jahrelanger Bauzeit fertiggestellt. Die Postkarte wurde am 29.9.1921 nach Bensberg versendet. | |
|
1920
- 1929 Auf der Postkarte aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist Neuhonrath aus westlicher Richtung aufgenommen. Unten links das Gasthaus Johann Altenrath gesondert dargestellt. Es stand unterhalb der katholischen Kirche, heute an der Straße „Am... Auf der Postkarte aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist Neuhonrath aus westlicher Richtung aufgenommen. Unten links das Gasthaus Johann Altenrath gesondert dargestellt. Es stand unterhalb der katholischen Kirche, heute an der Straße „Am Pfarrhof“. In den Kriegswirren wurde die Gaststätte 1943 zwangsbelegt mit einee Familie, die aus Köln evakuiert worden war. Die Gaststätte wurde aufgegeben, das Kolonialwarengeschäft wurde aber noch bis Ende der 60er Jahre zunächst von der Tochter Magdalena Fassbender und später von Frau Inge Walter weitergeführt. | |
Die Postkarte zeigt die Gaststätte „Zur schönen Aussicht“ in den 20er Jahren. Rechts auf dem Bild sieht man den Saal. Die Säle der Gaststätten trugen meisten einen besonderen Namen. Da der Honrather Saal sehr groß war, hieß er Kaisersaal. Die Leute... Die Postkarte zeigt die Gaststätte „Zur schönen Aussicht“ in den 20er Jahren. Rechts auf dem Bild sieht man den Saal. Die Säle der Gaststätten trugen meisten einen besonderen Namen. Da der Honrather Saal sehr groß war, hieß er Kaisersaal. Die Leute vor dem Saal sind festlich gekleidet, es könnte eine Hochzeitsgesellschaft sein. Vor dem Gasthaus befand sich auch der Kirmesplatz. | |
|
Das Bild zeigt Schachenauel aus südlicher Richtung und auf der Anhöhe im Hintergrund die „Baach“ in den 20er Jahren. Das Bild zeigt Schachenauel aus südlicher Richtung und auf der Anhöhe im Hintergrund die „Baach“ in den 20er Jahren. | |
Diese fünfgeteilte Mehrbildkarte (Potpourri-Karte) des „Luftkurortes Lohmar, Aggertal“ von etwa Mitte der 1920er Jahre zeigt oben im Bild: eine Panoramaansicht von Lohmar von Nordwesten aus gesehen, links: die Ostansicht der Vorburg mit einem Detail... Diese fünfgeteilte Mehrbildkarte (Potpourri-Karte) des „Luftkurortes Lohmar, Aggertal“ von etwa Mitte der 1920er Jahre zeigt oben im Bild: eine Panoramaansicht von Lohmar von Nordwesten aus gesehen, links: die Ostansicht der Vorburg mit einem Detail des Keilsteins der Toreinfahrt mit Wappen der Familie von Groote zu Bach, rechts: der Grenzgraben zwischen Staatsforst und Gemarkenwald, in der Mitte: die Hauptstraße (mit Überlandleitung für die Telephonie mit Keramikisolatoren und Kupferdrähten auf Holzmasten) und unten die Kirchstraße – zwischenzeitlich im Dritten Reich auch mal Bahnhofstraße benannt – beide Straßen sind noch mit einer Schotterdecke und festgewalzter Sand- oder Feinkiesschicht versehen. | |
Diese Ansichtskarte muss als nostalgisch bezeichnet werden, da der freie, früher landwirtschaftlich genutzte Raum zwischen den Orten Lohmar und Donrath mittlerweile durch starke Bebauung recht zugewachsen ist. Die im Jahre 2004 in Betrieb genommene... Diese Ansichtskarte muss als nostalgisch bezeichnet werden, da der freie, früher landwirtschaftlich genutzte Raum zwischen den Orten Lohmar und Donrath mittlerweile durch starke Bebauung recht zugewachsen ist. Die im Jahre 2004 in Betrieb genommene Lohmarer Ortsumgehung und die Neuanordnung des „Donrather Kreuzes“ hat das Landschaftsbild ebenfalls stark verändert. | |
|
9. Dezember 1927
Die Lindenallee der Hauptstraße in Wahlscheid war sicher eine der schönsten in unserer Region. Sie war ein grünes Band zwischen den alten Weilern Auelerhof, Fließengarten, Aggerhof und Müllerhof. Sie prägte den Luftkurort Wahlscheid. Sie war Teil der... Die Lindenallee der Hauptstraße in Wahlscheid war sicher eine der schönsten in unserer Region. Sie war ein grünes Band zwischen den alten Weilern Auelerhof, Fließengarten, Aggerhof und Müllerhof. Sie prägte den Luftkurort Wahlscheid. Sie war Teil der Chaussee Siegburg – Overath, die 1845 gebaut wurde. Vorher verlief die Straße von der Furt durch die Agger in Höhe des alten Pumpenhäuschen im Auelerhof über den Heiligenstock zum Müllerhof. Erst Ende der 20er Jahre pfl asterte man die Hauptstraße wegen der starken Staubentwicklung durch den zunehmenden Autoverkehr mit Basaltsteinen. Auf der linken Bildseite sieht man hinter „Haus Olga“, einer Dependance des Hotels Auelerhof, das neue Bürgermeisteramt von Wahlscheid. Beide Häuser wurden 1924 von der Bauunternehmung Lindenberg aus Hoffnungsthal gebaut, die noch heute besteht. | |
Die Postkarte im Jugendstil (um 1905) mit zwei Ansichten der alten und neuen Kirche von Lohmar zeigt links das älteste bisher bekannte Foto der alten Kirche und in der Gegenüberstellung den neuen dreischiffigen Erweiterungsbau der katholischen... Die Postkarte im Jugendstil (um 1905) mit zwei Ansichten der alten und neuen Kirche von Lohmar zeigt links das älteste bisher bekannte Foto der alten Kirche und in der Gegenüberstellung den neuen dreischiffigen Erweiterungsbau der katholischen Kirche. Von dem romanischen Ursprungsbau ist noch der Chor des 12. Jahrhunderts und der aus Andesit gefertigte Frühstaufische Taufstein erhalten. Das Langhaus wurde Mitte des 18. Jahrhunderts umgebaut. 1778 wurde auch der Turm erneuert. | |
Die Kirche mit dem ca. 35 Meter hohen Turm steht inmitten einer Gruppe reizvoller Fachwerkhäuser im sogenannten Kirchdorf, das lange Zeit als der älteste Kern von Lohmar galt. Im Jahre 1131, am 31. März, bestätigte Papst Innozenz II dem Bonner... Die Kirche mit dem ca. 35 Meter hohen Turm steht inmitten einer Gruppe reizvoller Fachwerkhäuser im sogenannten Kirchdorf, das lange Zeit als der älteste Kern von Lohmar galt. Im Jahre 1131, am 31. März, bestätigte Papst Innozenz II dem Bonner Probst, Gerhard von Aare den Besitz an der Kirche, eines Hofes (der Fronhof) und dem ganzen Zehnten im Kirchspiel Lohmar. Von der Zeit an hat das Bonner Cassiusstift, wie durch Urkunden erwiesen ist, das Zehntrecht in Lohmar ausgeübt. Bis 1803 war die Kirche im Besitz des Cassiusstifts. | |
Die Ansichtskarte aus dem Jahr 1910 zeigt die Kirche und den angrenzenden eingefriedigten Kirchhof zu Lohmar. Die alte Kirche bestand aus dem romanischen Langhaus, das Mitte des 18. Jahrhunderts umgebaut worden ist. 1778 wurde auch der Turm... Die Ansichtskarte aus dem Jahr 1910 zeigt die Kirche und den angrenzenden eingefriedigten Kirchhof zu Lohmar. Die alte Kirche bestand aus dem romanischen Langhaus, das Mitte des 18. Jahrhunderts umgebaut worden ist. 1778 wurde auch der Turm erneuert. | |
|
1913
Diese dreigeteilte Mehrbildkarte (Potpourrikarte) von etwa Mitte der 1910er Jahre zeigt oben Donrath als Panoramaansicht von Südosten aus gesehen, von links: im Hintergrund Sottenbach, jenseits der Agger, dann Haus Sieberts (heute Gatzweiler), früher... Diese dreigeteilte Mehrbildkarte (Potpourrikarte) von etwa Mitte der 1910er Jahre zeigt oben Donrath als Panoramaansicht von Südosten aus gesehen, von links: im Hintergrund Sottenbach, jenseits der Agger, dann Haus Sieberts (heute Gatzweiler), früher ebenfalls Ludmilla Böttner, das Hotel und der Gasthof zur Aggerburg von Josef und Ludmilla Böttner, das „Weiße Haus“ von Fritz Kreutzer aus Donrath, mit dem daneben liegenden Sägewerk von Paul Braun (heute Overath). | |
|
1920
- 1929 Der Ulrather Hof befand sich im Lohmarer Wald nahe der Agger auf dem Weg zum Brückberg in Siegburg. Viele Lohmarer waren um 1900 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges in den Königlichen Werken, das sind die Preußischen Rüstungsbetriebe... Der Ulrather Hof befand sich im Lohmarer Wald nahe der Agger auf dem Weg zum Brückberg in Siegburg. Viele Lohmarer waren um 1900 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges in den Königlichen Werken, das sind die Preußischen Rüstungsbetriebe Feuerwerkslaboratorium und Geschoßfabrik, auf dem Brückberg beschäftigt und gingen zu Fuß oder fuhren mit dem Fahrrad am „Ulerod“ vorbei zu ihrer Arbeit. | |
|
25. November 1920
Diese Postkarte wurde am 25.11.1920 abgeschickt. Auf der Rückseite ist aufgedruckt, dass es sich um das „HotelPensionat Villa Therese, Besitzer Jos. Pult, Lohmar – Tel. No. 9“ handelt. Diese Postkarte wurde am 25.11.1920 abgeschickt. Auf der Rückseite ist aufgedruckt, dass es sich um das „HotelPensionat Villa Therese, Besitzer Jos. Pult, Lohmar – Tel. No. 9“ handelt. Doch auch Pult konnte die Villa nicht halten. Er verkaufte sie 1926 an die Reichsbahn, deren Betriebskrankenkasse Elberfeld das Hotel am 29.5.1926 als Erholungsheim für Reichsbahnbedienstete einweihte. (Quelle: Waltraud Rexhaus, Zur Geschichte der Lohmarer Hauptstraße, Seite 42 und Ludwig Polstorff, Chronik der Landbürgermeisterei Lohmar, Seite 190.) | |
Die Postkarte Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhundert zeigt eine Villenpartie im Lohmarer Norden, hier schließt im Süden der Park „Lohmarhöhe“ der Ordensgemeinschaft „vom armen Kinde Jesu“ an. Der Orden verkaufte seinen gesamten Besitz an die... Die Postkarte Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhundert zeigt eine Villenpartie im Lohmarer Norden, hier schließt im Süden der Park „Lohmarhöhe“ der Ordensgemeinschaft „vom armen Kinde Jesu“ an. Der Orden verkaufte seinen gesamten Besitz an die Zivilgemeinde Lohmar, die zischenzeitlich einen Freizeitpark aus ihm machte, nachdem die Gebäude, mangels anderweitige Nutzung, abgerissen wurden. Der Park ist heute mit Wohnhäusern bebaut. Von links beginnend die Villa Hauptstraße 11, diese ist ebenso wie die benachbarte Villa Hauptstr. 13 um die Jahrhundertwende des letzten Jh. von dem ehemaligen Oberpostinspektor August Wagner aus Köln errichtet worden. August Wagner starb an den Folgen eines Herzschlages am 16.7.1924. Er vermachte sein Haus seiner Haushälterin, die ihrerseits das Gebäude an Rektor Karl Schmidt, der nach 45-jähriger Tätigkeit an der Volksschule Lohmar 1960 den wohlverdienten Ruhestand antrat, verkaufte. Das Haus ist inzwischen abgerissen und durch zwei Mehrgeschossbauten ersetzt worden. | |
Die Postkarte von etwa 1925 zeigt eine „Partie an der Agger“ im Luftkurort Donrath in der Nähe der Dornhecke. Dort betrieb Fritz Weingarten (siehe „Lohmar in alten Zeiten“, Bd. I, Seite 19) für die Donrather Sommerfrischler einen Bootsverleih. Die Postkarte von etwa 1925 zeigt eine „Partie an der Agger“ im Luftkurort Donrath in der Nähe der Dornhecke. Dort betrieb Fritz Weingarten (siehe „Lohmar in alten Zeiten“, Bd. I, Seite 19) für die Donrather Sommerfrischler einen Bootsverleih. | |
Ursprünglich gehörte das Haus, es war Fährhaus und wahrscheinlich auch Forsthaus zugleich, „Zur alten Fähre“ zur Burg Lohmar. Die beiden Schwestern, die Wwe. von Wilhelm Altenhoven und Anna Katharina Zimmermann verpachteten 1873 die Fähre und damit... Ursprünglich gehörte das Haus, es war Fährhaus und wahrscheinlich auch Forsthaus zugleich, „Zur alten Fähre“ zur Burg Lohmar. Die beiden Schwestern, die Wwe. von Wilhelm Altenhoven und Anna Katharina Zimmermann verpachteten 1873 die Fähre und damit auch das Fährhaus an Wilhelm Lehr, Ackerer und Holzschneider aus Lohmar, der sie später an seine Tochter Anna Catharina und deren Ehemann Bertram Kronenberg übergab. Dieser hielt bis zum Bau der neuen, eisernen Aggerbrücke, erbaut 1899, die Fährmannstätigkeit aufrecht. Die Familie Biesenbach war 1899 Eigentümer des Fährhauses. 1902 wurde das Fährhaus an die Familie Rottland verkauft und von dieser erwarb die Familie Schultheiß das Haus, die hier eine Ruderstation betrieb. Zu sehen auf der Postkarte ist der Zustand 1919, Inh. war Peter Kümpel, der das Gebäude nach der Erweiterung und Ausbau zum Gasthaus „Restaurant – Café Zur alten Fähre“ erlangt hatte. Geführt wurde es von seiner Ehefrau Elisabeth. Auf der Wiese zur Agger liegt die ehemalige Fähre vor dem Ausflugslokal. Die Ansicht auf der Abbildung selber ist aus dem Jahr 1927. | |
Die im Original kolorierte Zweibildkarte im liegenden Format zeigt im oberen Bild „Haus Hasselsiefen“ in DonrathKuttenkaule, ein ursprünglich für kranke Priester erbautes Erholungsheim, das später in den Besitz von Rektor Peter Klein überging. Dieser... Die im Original kolorierte Zweibildkarte im liegenden Format zeigt im oberen Bild „Haus Hasselsiefen“ in DonrathKuttenkaule, ein ursprünglich für kranke Priester erbautes Erholungsheim, das später in den Besitz von Rektor Peter Klein überging. Dieser vermachte es 1909/10 den Essener Augustiner Chorfrauen. Links ist das villenähnliche Wohnhaus des Rektors Peter Klein „In der Burghardt“ zu erkennen. Auf dem unteren Foto ist das Fährhaus, die Dachfläche des Bachhofs und die Stahlbrücke über die Agger von 1899 zu sehen. Die Brücke wurde am 1.4.1945, auf Ostersonntag, durch deutsche Soldaten gesprengt. | |
Die ersten beiden Klassen der Waldschule, (das 4. und 8. Schuljahr) im Schatten der um 1920 angepflanzten Fichten, wurden am 21. Juli 1954 übergeben. Im gleichen Jahr etwa erschien diese Postkarte mit einem weiten Ausblick auf den Ort Lohmar –... Die ersten beiden Klassen der Waldschule, (das 4. und 8. Schuljahr) im Schatten der um 1920 angepflanzten Fichten, wurden am 21. Juli 1954 übergeben. Im gleichen Jahr etwa erschien diese Postkarte mit einem weiten Ausblick auf den Ort Lohmar – gesehen vom Schulstandort obere Hermann-Löns-Straße. Heute ist dieser Klassentrakt bereits wieder abgerissen; er musste einem Neubau weichen. | |
|
1970
- 1979 In den 1970er Jahren erschien diese Postkarte des Ortes Lohmar mit charakteristischen Objekten: Die Kirche der evangelischen Kirchengemeinde Lohmar, die Christuskirche mit Glockenturm, die am 12. Juni 1960 eingeweiht wurde, rechts oben die... In den 1970er Jahren erschien diese Postkarte des Ortes Lohmar mit charakteristischen Objekten: Die Kirche der evangelischen Kirchengemeinde Lohmar, die Christuskirche mit Glockenturm, die am 12. Juni 1960 eingeweiht wurde, rechts oben die Aggerbrücke, in der jetzt bekannten Form, 1956 erneuert sowie eine Teilansicht des Talwegs, der heutigen Pützerau, in Fortführung des Wegs Lohmar – Seligenthal über Rotenbacher Hof und Kaldauen, des sog. „Prozessionswegs“. Die Siedlungsarbeiten der „Alt-Siedlung Pützerhau“ begann bereits 1933 mit den ersten zwei Doppelhäusern und wurde am 21. Februar 1935 mit den typischen Blockhäusern, also Holzhäuser fortgeführt (in Verballhornung der Trapper-Blockhütten wurde die gesamte Siedlung scherzhaft „Klein Alaska“ genannt). Die linke Straßenseite wurde 1950 mit dem Bau von Doppelhäuser, dieses Mal aus Stein und Beton hergestellt, begonnen. Heute haben die Häuser bis auf ganz wenige ihr Aussehen wesentlich verändert. | |
|
1970
- 1979 Die Postkarte zeigt das Lohmarer Bahnhofsgebäude der Aggertalbahn. Die Postkarte zeigt das Lohmarer Bahnhofsgebäude der Aggertalbahn. | |
Die Lithographie vor 1900 aus der Perspektive vom Ziegenberg herunter zeigt die nördliche Peripherie Lohmars. Links, am Einschnitt ins Jabachtal, erkennt man Haus Hollenberg, weiter rechts den Jabachhof, dann vereinzelte Häuser des Oberdorfs entlang... Die Lithographie vor 1900 aus der Perspektive vom Ziegenberg herunter zeigt die nördliche Peripherie Lohmars. Links, am Einschnitt ins Jabachtal, erkennt man Haus Hollenberg, weiter rechts den Jabachhof, dann vereinzelte Häuser des Oberdorfs entlang der Chaussee. Im Vordergrund die Flurlagen „Am Wiesen-Pfad“, „Auf dem Weidchen“ und „Vorn in der Pann“ (das heutige RSB-Gebiet) dürften den ursprünglichen Bestand jener Landschaft treffen, nämlich Feldflur und Wiesenflächen. Das untere Bild zeigt die Kahnstation – Partie am Rudersport, flussaufwärts gesehen, mit Bootsverleih der Familie Schultheis im Unterdorf von Lohmar, heute Aggerstraße. | |
|
1911
- 1912 Um 1911/12 konnte man diese Postkarte im „Hotel zum Aggertal von Johann Schnitzler Lohmar (Sommerfrische u. Ausflugsort), Fernruf: Amt Lohmar Nr. 8“ kaufen. Sie zeigt eine Ansicht etwa vom Korresgarten aus auf den Kern des Ortes Lohmar. Für die... Um 1911/12 konnte man diese Postkarte im „Hotel zum Aggertal von Johann Schnitzler Lohmar (Sommerfrische u. Ausflugsort), Fernruf: Amt Lohmar Nr. 8“ kaufen. Sie zeigt eine Ansicht etwa vom Korresgarten aus auf den Kern des Ortes Lohmar. Für die Benennung der Gebäude waren Hubert Hagen und Marieluise Nagel geb. Schopp eine große Hilfe. | |
|
21. Februar 1310
| |
|
2020
Am 1. Mai 2013 trat das Nichtraucherschutzgesetz in Kraft. Seitdem gilt in der Gastronomie ein uneingeschränktes Rauchverbot. Es wurde damals zum Sargnagel der Kneipen erklärt. Biergeruch und Zigarettenqualm gehörten bis dahin unzertrennlich... Am 1. Mai 2013 trat das Nichtraucherschutzgesetz in Kraft. Seitdem gilt in der Gastronomie ein uneingeschränktes Rauchverbot. Es wurde damals zum Sargnagel der Kneipen erklärt. Biergeruch und Zigarettenqualm gehörten bis dahin unzertrennlich zusammen. Heute ist das Rauchverbot längst alltäglich geworden. Mit dem Rauchverbot ist auch das früher in Kneipen weit verbreitetes Werbemittel „Streichholzschachtel“ selten geworden. Eine kleine Sammlung erinnert an die „Strichholzdösje“ und an viele Gasthäuser in Lohmar, von denen eine große Anzahl heute nicht mehr existiert - aber nicht wegen des Rauchverbots. Der Lohmarer Winfried Kann hat sie gesammelt und dazu ein Buch herausgegeben mit Kneipengeschichten. | |
|
1964
- 2024 Anfang der 1930er Jahre plante Pfarrer Michels ein Jugendheim in Birk. Als aber unter dem Nazi-Regime ab 1933 nach und nach solche Heime beschlagnahmt wurden, ließ man den Plan fallen. 1964 gelang dem Pfarrgemeinderat unter dem rührigen Pfarrer... Anfang der 1930er Jahre plante Pfarrer Michels ein Jugendheim in Birk. Als aber unter dem Nazi-Regime ab 1933 nach und nach solche Heime beschlagnahmt wurden, ließ man den Plan fallen. 1964 gelang dem Pfarrgemeinderat unter dem rührigen Pfarrer Biesing ein Jugendheim zu eröffnen in unmittelbarer Nähe des Pfarrhauses. Es wurde bei vielen Anlässen von Jung und Alt genutzt. Die Pfarrheime in Birk und Scheiderhöhe mussten aufgegeben werden, nachdem im Erzbistum Köln das diözesane Projekt "Zukunft heute" 2004 auf den Weg gebracht und die Finanzen gekürzt wurden. Es wurde nur noch das Pfarrzentrum in Lohmar voll bezuschusst. Die vier katholischen Pfarrgemeinden Lohmar mussten zur Pfarrei Sankt Johannes fusionieren. In Kooperation mit der Stadt Lohmar wurde im Birker Pfarrheim 2006 ein Jugenzentrum eröffnet und später die Musik- und Kunstschule. | |
Eine wichtige Stellung im Gemeindeleben nahm die Polizei ein. Schon damals war die Polizei in verschiedene Fachbereiche gegliedert, zum Beispiel Kriminal, Gesundheit, Sittlichkeit. Eine besondere Abteilung war auch "Verkehr". Was man unter Verkehr... Eine wichtige Stellung im Gemeindeleben nahm die Polizei ein. Schon damals war die Polizei in verschiedene Fachbereiche gegliedert, zum Beispiel Kriminal, Gesundheit, Sittlichkeit. Eine besondere Abteilung war auch "Verkehr". Was man unter Verkehr verstand waren allenthalber Pferdefuhrwerke, Radfahrer und vereinzelt Kraftfahrzeuge. Der Ortspolizist war jedoch "Mädchen für alles". Die "Polizeipräfekten" des Siegkreises um 1900 lösten ihre Aufgane mit glänzender Bravour, wenn man dabei bedenkt, dass in Lohmar jahrzehntelang nur ein einziger Polizist strenge Ordnung in der Bürgermeisterei wahrte. Polizeisergant Johann Adam Schug lebte von 1969 - 1931. Der "Mann mit der Plempe" sorgte 40 Jahre lang für Zucht und Ordnung im Gebiet Lohmar, eine Originalität und Persönlichkeit, die in der Geschichte der Gemeinde ihren Platz hat. Er war als Schützer der öffentlichen Ruhe und Ordnung bekannt und geachtet. Landstreicher umgingen sein Gebiet im weiten Bogen. Seine Frau, der er auch ein Strafmandat verpasste, musste die Festgenommenen verpflegen, bevor sie vor den "Kadi" kamen. Eine amüsante Anekdote "Saach Pitter" (siehe Foto) aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg hat Karlheinz Urbach festgehalten, dessen Großvater Peter Urbach als Landbriefträger in Euelen wohnte und gelengentlich seine Einnahmen durch Haareschneiden aufbesserte. Zu seinen ständigen Kunden gehörte der Dorfpolizist Johann Adam Schug. | |
|
1955
- 1990 Die Bilder sind in einer Broschüre zusammengefasst. Sie geben die bauliche Entwicklung der Firma Walterscheid in Lohmar von der Entstehung bis in die 1990er Jahre wieder. Die Bilder sind in einer Broschüre zusammengefasst. Sie geben die bauliche Entwicklung der Firma Walterscheid in Lohmar von der Entstehung bis in die 1990er Jahre wieder. | |
|
1985
- 1987 1986 erwarb die Gemeinde Lohmar die Villa Therese, die als Politische Akademie genutzt wurde und Bundeseigentum war. Für die Gemeinde führte der damalige Beigeordnetete und spätere erste hauptamtliche Bürgermeister Horst Schöpe die Verhandlungen.... 1986 erwarb die Gemeinde Lohmar die Villa Therese, die als Politische Akademie genutzt wurde und Bundeseigentum war. Für die Gemeinde führte der damalige Beigeordnetete und spätere erste hauptamtliche Bürgermeister Horst Schöpe die Verhandlungen. Dazu gehörte ein Auftritt im zuständigen Bundestagsausschus mit Finanzmisnister Gerhard Stoltenberg. Mitbewerber war Wolfgang Overath (Fußballweltmeister 1974) als Immobilienunternehmer. Ausschlaggebend für den Zuschlag an die Gemeinde war, dort eine Bücherei und ein Begegnunszentrum errichten zu wollen. 1987 begannen die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen, die mit Städtebauförderungsmitteln des Bundes und Landes finanziell unterstützt wurden. Neben dem Villengebäude standen auf dem Grundstück von der Hauptstraße aus gesehen links das Gäste- und Personalhaus und rechts ein Wirtschaftsgebäude. Sie wurden beide abgerissen.
| |
|
1968
- 1980 Karneval und Politik sind seit Jahrhunderten eng miteinander verknüpft. Während der fünften Jahreszeit im Rheinland wurde und wird die Obrigkeit gerne zur Zielscheibe des Spottes der Karnevalisten. 1968 war die Wahl des Gemeindedirektors Albrecht... Karneval und Politik sind seit Jahrhunderten eng miteinander verknüpft. Während der fünften Jahreszeit im Rheinland wurde und wird die Obrigkeit gerne zur Zielscheibe des Spottes der Karnevalisten. 1968 war die Wahl des Gemeindedirektors Albrecht Weinrich Motto eines Karnevalswagens im Rosenmontagszug. Albrecht Weinrich war am 6. Dez. 1967 mit knapper Mehrheit von 9 : 8 Stimmen vom Rat zum neuen Gemeindedirektor gewählt worden. Als er 1980 nicht wiedergewählt wurde und durch Horst Vandersander (FDP) abgelöst wurde, schlugen nach einer Büttenrede auf der Prinzenproklamation unter dem Sitzungspräsidenten Werner Knorre die Wogen hoch. Werner Knorre hatte unter großem Jubel der Besucher erklärt, dass, wenn die Vereine das Sagen hätten, Albrecht Weinrich wiedergewählt worden wäre. Der Büttenredner Heinz Rech hatte gefragt: "Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Terroristen und einem Gemeindedirektor?" Antwort: " Der Terrorist hat Sympathisanten." Daraufhin verließen der damlige Bürgermeister Hans-Günther van Allen und der designierte Gemeindedirektor Horst Vandersander fluchtartig die Szene. | |
In den 1950er Jahren hatte der Junggesellenverein "Gemütlichkeit Lohmar" großen Anteil am geselligen Leben im Ort. Ein Stammlokal war beim "Schwamborn" in der Gasstätte Jägerhof an der Hauptststraße. Mit dem Motto des Karnevalswagens 1954 "Lühme... In den 1950er Jahren hatte der Junggesellenverein "Gemütlichkeit Lohmar" großen Anteil am geselligen Leben im Ort. Ein Stammlokal war beim "Schwamborn" in der Gasstätte Jägerhof an der Hauptststraße. Mit dem Motto des Karnevalswagens 1954 "Lühme Muhr" outeten die Junggesellen sich als "echte" Lohmarer. Noch heute wird die Lühme(re) Muhr als Auszeichnung für besondere Verdienste um den Lohmarer Karneval vom Vereinskomitee Lohmar verliehen. | |
|
1908
- 2023 Um 1900 hatten die Eheleute Eduard Oligschläger in dem damals bestehenden Fachwerkhaus (heute Hauptstraße 79) ein Lebensmittelgeschäft. 1907 führte Carl Scheiderich das Geschäft als Kolonialwarenhandlung und Drogerie weiter. Später übernahm sein Sohn... Um 1900 hatten die Eheleute Eduard Oligschläger in dem damals bestehenden Fachwerkhaus (heute Hauptstraße 79) ein Lebensmittelgeschäft. 1907 führte Carl Scheiderich das Geschäft als Kolonialwarenhandlung und Drogerie weiter. Später übernahm sein Sohn Karl den Laden und betrieb bis Ende der 1970er Jahre ein Lebensmittelgeschäft. 2007 wurden die Gebäude abgerissen. Letzte Mieter waren ein Friseur- und ein Drucksachengeschäft. Bauherr Adam Arz errichtete hier ein neues 3 1/2-stöckiges Wohn- und Geschäftshaus, das 2008 fertigestellt wurde. | |
|
1962
Die Trasse der Lohmarer Hauptstraße wurde 1845 beim Bau der Provinzialstraße angelegt. Bis dahin war die Hauptverbindung Siegburg - Lohmar die „Alte Lohmarer Straße“, die in Höhe des Nordfriedhofs durch den Lohmarer Wald über die Bachstraße und den... Die Trasse der Lohmarer Hauptstraße wurde 1845 beim Bau der Provinzialstraße angelegt. Bis dahin war die Hauptverbindung Siegburg - Lohmar die „Alte Lohmarer Straße“, die in Höhe des Nordfriedhofs durch den Lohmarer Wald über die Bachstraße und den Mühlenweg führte und kurz vor dem Jabach am Ortsende von Lohmar auf die jetzige Straße mündete. Um 1900 war die Hauptstraße als Schotterstraße mit einer Breite von 6 m angelegt. Der zunehmende Verkehr brachte für die Bewohner erhebliche Staubbelästigungen mit sich.1929 wurde die Strecke gepflastert. Sie bestimmte bis in die 1960er Jahre das Bild des Ortes. In den Jahren 1962 – 1964 erfolgte ein Totalausbau mit einer ca. 10 m breiten Fahrbahn und einer stabilen Asphalt- bzw. Schwarzdecke. | |
|
1950
- 1956 Die kleinen Lebensmittelgeschäfte (Tante Emma Läden) sind in Lohmar von der Bildfläche verschwunden und durch große Supermärkte verdrängt worden. Schätzungsweise ca.10 solcher Läden gab es in Lohmar. Mitten im Ort gelegen war die... Die kleinen Lebensmittelgeschäfte (Tante Emma Läden) sind in Lohmar von der Bildfläche verschwunden und durch große Supermärkte verdrängt worden. Schätzungsweise ca.10 solcher Läden gab es in Lohmar. Mitten im Ort gelegen war die Kolonialwarenhandlung von Carl und Elisabeth Scheiderich, die bis Mitte der 1980er Jahre betrieben wurde. Etwas südlicher auf der Hauptstraße 62 a (heute 127) befand sich das Lebensmittelgeschäft Distelrath. 1950 war noch kein Schaufenster vorhanden und der Verkauf fand im Wohnraum zur Straße hin statt. Lediglich zwei Schilder wiesen auf das Geschäft hin: MAGGI (Suppenartikel) und IMI (Waschmittel). | |
Zur Tradition gehört, dass zum 1. Mai ein Maibaum aufgestellt wird. Damals war es üblich eine Tanne auszuwählen. Lang musste sie sein und nach Möglichkeit bis zur Höhe der Schalllöcher der Birker Kirche reichen. Der Baum stand auf dem Dorf- oder ... Zur Tradition gehört, dass zum 1. Mai ein Maibaum aufgestellt wird. Damals war es üblich eine Tanne auszuwählen. Lang musste sie sein und nach Möglichkeit bis zur Höhe der Schalllöcher der Birker Kirche reichen. Der Baum stand auf dem Dorf- oder Kirchplatz. Ein Wettbewerb mit den Nachbardörfern war ebenfalls angesagt. Jeder wollte den längsten Baum im Dorf stehen haben. Ein geflochtener Kranz mit bunten Bändern gehörte dazu. Ein übler Brauch, nicht selten, wenn der Baum unbewacht blieb, überstand er die Mainacht nicht und wurde abgesägt. Zum Aufstellen des Baumes wurden Seile und sogenannte Scheren (zusammengbundene Tannenstämme) eingesetzt. Die Dorfjugend schaffte dies mit viel Geschrei und Hallo. | |
|
1940
- 1950 Die Herbstferien hießen früher bis in die 1950er Jahre Kartoffelferien. Die Mithilfe von Kindern und Jugendlichen war selbstverständlich und von den Bauern mit eingeplant. Der Lohn für einen Tag war der Preis eines Zentners Kartoffeln.... Die Herbstferien hießen früher bis in die 1950er Jahre Kartoffelferien. Die Mithilfe von Kindern und Jugendlichen war selbstverständlich und von den Bauern mit eingeplant. Der Lohn für einen Tag war der Preis eines Zentners Kartoffeln. Selbstverständlich gehörte dazu die Kaffeepause mit Zwetschgenkuchen und Platzbroten. Bei einigen Bauern, wo bis zur Dunkelheit geerntet wurde, gab es auch Abendessen mit Buttermilchsuppe mit Zwetschgen. Der Ernteablauf war so, dass die Rodermaschine oder Rodder vom Pferd, später vom Traktor, gezogen wurde. Die Kartoffeln wurden in Zweiergruppen aufgelesen, in Drahtkörbe geworfen und dann weiter in den bereitgestellten Karren geschüttet. Mit dem vollen Karren ging es zum Hof. Dort wurden die Kartoffeln verlesen oder zum Lagern und Trocknen in die Scheune gebracht. Man unterschied zwischen dicken (Reibekuchen-), normalen und kleinen (Pell-) Kartoffeln. Die beschädigten, grünen oder leicht angefaulten brauchte man für die Schweinefütterung.
| |
Im Herbst 2022 starteten der Heimatverein Lohmar und die Kunstschule der Stadt Lohmar ein Kunstprojekt für Kinder unter dem Motto „Was ist Heimat für mich“. Hintergrund des Projektes war, Kinder und junge Menschen für ihren Ort zu interessieren, sich... Im Herbst 2022 starteten der Heimatverein Lohmar und die Kunstschule der Stadt Lohmar ein Kunstprojekt für Kinder unter dem Motto „Was ist Heimat für mich“. Hintergrund des Projektes war, Kinder und junge Menschen für ihren Ort zu interessieren, sich Heimat zu erschließen und bestenfalls sie mitzugestalten. Die Kunstdozentin der Kunstschule Philine Fahl musste den Kindern jedoch erst mal den Begriff Heimat näherbringen. Hilfreich war, wenn sie sich vorstellten, irgendwo im Ausland im Urlaub zu sein und dann Heimweh zu bekommen. Was oder wen vermissten sie? Auf was freuten sie sich am meisten bei der Rückkehr? Die kleinen Kunstwerke sprechen für sich. Die meisten Kinder (6 -11 Jahre) brachten mit Heimat Familie und Freunde und ihr Zuhause in Verbindung. Für einige ist Heimat auch Ort/Dorf, Nation und Verein. Die Gemälde sind auf großflächige Planen aufgedruckt und sollten am 6. August 2023 auf dem großen Fest „Treff im Park“ im Parkgelände der Villa Friedlinde der Öffentlichkeit präsentiert werden. Leider musste die Veranstaltung wegen des schlechten Wetters abgesagt werden.
| |
|
1930
- 1945 Die Fotos vermitteln einen Eindruck von dem das Ortsbild prägenden Gebäude des "Hotel Restaurant zum Aggerthal von Johann Schnitzler" an der Ecke Kirchstraße/Hauptstraße. Das imposante Gebäude wurde gegen Ende des Zweiten Welkrieges in der Nacht vom... Die Fotos vermitteln einen Eindruck von dem das Ortsbild prägenden Gebäude des "Hotel Restaurant zum Aggerthal von Johann Schnitzler" an der Ecke Kirchstraße/Hauptstraße. Das imposante Gebäude wurde gegen Ende des Zweiten Welkrieges in der Nacht vom 17. auf den 18. März 1945 von einer Bombe getroffen und brannte mit Saal ab. | |
|
1933
- 1934 In den Anfängen des Campingbetriebes an der Agger waren die Städter darauf angewiesen, "wild" zu campen oder häufig auch bei Privatfamilien, die ein Grundstück an dem Fluss oder in der Nähe hatten. Damit konnten sich die Eigentümer ein kleines Zubrot... In den Anfängen des Campingbetriebes an der Agger waren die Städter darauf angewiesen, "wild" zu campen oder häufig auch bei Privatfamilien, die ein Grundstück an dem Fluss oder in der Nähe hatten. Damit konnten sich die Eigentümer ein kleines Zubrot verdienen. Einige Leute hatten sich auch am Aggerufer ein kleines Geschäft eingerichtet, wo sie eigene Produkte oder Süßwaren verkauften. Die Camper reisten morgens an und fuhren abends wieder nach Hause. | |
|
1954
Die Fotos geben Teile des Verladebahnhofs wieder. Es handelt sich zum einen um eine Postkarte, die 1954 gelaufen ist. Links liegt der Verladebahnhof mit dem Haltepunkt Lohmar, der 1907 mit dem 3. Gleis ausgestattet wurde. Parallel dazu verlief die... Die Fotos geben Teile des Verladebahnhofs wieder. Es handelt sich zum einen um eine Postkarte, die 1954 gelaufen ist. Links liegt der Verladebahnhof mit dem Haltepunkt Lohmar, der 1907 mit dem 3. Gleis ausgestattet wurde. Parallel dazu verlief die Verladestraße, die heutige Raiffeisenstraße. Rechts am Holzzaun liegen die Büros des Sägewerks und Holzverarbeitungsbetriebes Josef Eich und seiner Söhne Hans und Ferdi. Dahinter liegt der holzverarbeitende Betrieb Paul Pfennig, in der Daubenfässer mit Deckel hergestellt wurden. Im Hintergrund ist das Wohnhaus von Paul Pfennig zu sehen. 1958 übernahm die Firma K. Kurz Hessental KG das Unternehmen. Sie beschäftigte zeitweise 1200 Mitarbeiter in den 3 Zweigstellen in Lohmar, Neckargmünd und Hurlach. Im November 1993 wurde der Betrieb in Lohmar aufgegeben. Zischenzeitlich unterhielt die Holzhandlung Lüghausen aus Siegburg hier eine Zweigstelle, bevor sie 2002 Insolvenz anmelden musste. Ende 2007 wurde mit dem Abriss der alten Gewerbehallen begonnen und es entwickelte sich hier das Gewerbezentrum Auelsweg mit vielen neuen mittelständischen Unternehmen. Das andere Foto zeigt im unteren Teil u.a. die Bahnschienen mit dem Bahnhofsschuppen. Das traufständige Gebäude an der Verladestraße unten links ist das Warenlager der Raiffeisengenossenschaft. Die dunkelfarbigen Gebäude am rechten Bildrand sind das Anwesen Postertz in der Kirchstraße. Gegenüber liegt die Kaplanei mit dem Pfarrheim, angrenzend der alte Schulhof mit den Kastanienbäumen und das Baustofflager Knipp. | |
|
1968
1968 malte Raimund Schüller die Ansicht des Lohmarer Kirchdorfes auf eine Wand im alten Pfarrheim. Im Gebäude des alten Pfarrheims neben der Kaplanei in der Kirchstr. war zu einem späteren Zeitpunkt das Wasserwerk untergebracht. In den 60er und 70er... 1968 malte Raimund Schüller die Ansicht des Lohmarer Kirchdorfes auf eine Wand im alten Pfarrheim. Im Gebäude des alten Pfarrheims neben der Kaplanei in der Kirchstr. war zu einem späteren Zeitpunkt das Wasserwerk untergebracht. In den 60er und 70er Jahren probte der Kirchchor in den Räumen und auch der Chor „We All“ (später „Da Capo“) entstand hier. Die Pfadfinder nutzen ebenfalls die Räumlichkeiten und es wurde auch eine Jugend-Disco veranstaltet oder Filmnachmittage organisiert. 2003 mussten mehrere Gebäude an der Kirchstr. wegen dem geplanten Neubau des Lidl-Marktes abgerissen werden. Darunter die alte Schule, das spätere Feuerwehrhaus und auch das Pfarrheim. | |
|
1932
- 1935 Aus vielen tausend kleinen Holzstücken bastelte Ewald Becker, Jahrgang 1922, ein Modell der Stahlbogenbrücke, die 1899/1900 über die Agger als Verbindung nach Altenrath gebaut und kurz vor Kriegsende 1945 von deutschen Pionieren gesprengt wurde. Das... Aus vielen tausend kleinen Holzstücken bastelte Ewald Becker, Jahrgang 1922, ein Modell der Stahlbogenbrücke, die 1899/1900 über die Agger als Verbindung nach Altenrath gebaut und kurz vor Kriegsende 1945 von deutschen Pionieren gesprengt wurde. Das Modell schenkte er seiner ehemaligen Heimatstadt Lohmar, in der er in der Straße Am Bungert aufgewachsen war. Als Junge war es seine Passion, bei Wind und Wetter über die etwas mehr als nur handbreiten haushohen Eisenträger zu balancieren. Im Sommer, wenn ihm genügend Badegäste am Aggerstrand bewundernd zuschauten, machte er seinen viel beklatschten "Köppes" (Kopfsprung) in den nicht tiefen Fluss. Peter Kümpel der Ältere, der einen Handwerksbetrieb in der "Alten Fähre" hatte, informierte immer wieder den Vater von Ewald Becker über die tollkühnen Sprünge. Zu Hause gab es dann jedesmal eine gehörige Tracht Prügel. Über diese Stahlbogen-Brücke fuhr bis 1918 von den Altenrather Ton- und Sandgruben eine Kleinbahn bis zum Bahnhof in der Kirchstraße. Über die Bogenbrücke pendelte auch Grubenbesitzer Winter täglich mit seinem ersten Automobil hin und her. Als der noch offene Kraftwagen an Kemmerichs Kolonialwarenladen an der Hauptstraße vorbeiknatterte, rief Elisabeth Kannengiesser erschreckt. "Himmel hölp, do fiert en Kah ohne Päed!" (Himmel hilf, da fährt eine Karre ohne Pferd!) Ganz früher gab es nur eine Furt durch die Agger, die noch auf der Militärkarte von Tranchot-Müffling (!803 -1820) eingezeichnet ist. Die Zufahrt führte unterhalb der Burg und dem heutigen Restuarant "Zur Alten Fähre" in einem weiten Bogen durch die Agger von Lohmar weiter über den Eisenweg und dann über den Mauspfad von Altenrath und Troisdorf Richtung Köln. | |
|
1947
- 2022 Die Damenkarnevalsgesellschaft Zweite Plöck blickt 2022 auf ihr 75-jähriges Bestehen zurück. Sie wurde am 11.11.1947 gegründet. Die Damen mit ihrer Vorsitzenden Ulrike Fingerhuth nahmen freudestrahlend bei der Karnnevaleseröffung am 11.11.2022 auf... Die Damenkarnevalsgesellschaft Zweite Plöck blickt 2022 auf ihr 75-jähriges Bestehen zurück. Sie wurde am 11.11.1947 gegründet. Die Damen mit ihrer Vorsitzenden Ulrike Fingerhuth nahmen freudestrahlend bei der Karnnevaleseröffung am 11.11.2022 auf der Bühne vor dem Lohmarer Rathaus die Glückwünsche des Vorsitzendende des Vereinskomitees Lohmar, Johannes Fingerhuth, entgegen. Am Wochenende zuvor waren in der Austellung "100 Jahre Karneval in Lohmar" im Foyer des Rathaus einige Fotos der DKG aus den 1950er Jahren zu besichtigen. | |
"Wenn Menschen schweigen werden Steine reden..." unter dieser Überschrift sind im Haus des Heimatvereins Lohmar zwei steinerne Fundstücke ausgestellt, die zu alten Grabkreuzen gehörten. Es gelang das Gesamtbild der Grabkreuze wiederherzustellen und... "Wenn Menschen schweigen werden Steine reden..." unter dieser Überschrift sind im Haus des Heimatvereins Lohmar zwei steinerne Fundstücke ausgestellt, die zu alten Grabkreuzen gehörten. Es gelang das Gesamtbild der Grabkreuze wiederherzustellen und deren Inschriften zu rekonstruieren. Dabei handelt es sich zum einen um den 1755 mit nur 16 Jahren verstorbenen Anton Höderath vom Schöpcherhof in Scheiderhöhe und zum anderen um die 1730 verstorbene Anna Margaretha Hagens von Scherf (Scherferhof in Wielpütz). | |
Väter und Großväter hatten den Einberufenen oft in euphorischer Stimmung von dem gewonnenen Krieg 1870/71 und der schönen weiten Welt, die sie als Soldat sehen konnten, erzählt. Diese Erzählungen hatten zunächst eine gewisse Begeisterung für das... Väter und Großväter hatten den Einberufenen oft in euphorischer Stimmung von dem gewonnenen Krieg 1870/71 und der schönen weiten Welt, die sie als Soldat sehen konnten, erzählt. Diese Erzählungen hatten zunächst eine gewisse Begeisterung für das Militär bei den jungen Männern ausgelöst. Sie hielt bis zur Musterung an. Als es ernst wurde und die Heimat mit dem Zug verlassen werden mußte, war – wie das Bild zeigt – Freude in den Gesichtem der Einberufenen nicht zu erkennen. Sie verließen Ehefrauen, Kinder und Eltern, die künftig wegen ihrer Abwesenheit noch härter für das tägliche Brot arbeiten mußten. Ab sofort bangte man zu Hause ständig um das Leben der Soldaten.
| |
Auf Initiative und mit finanzieller Förderung des Lions Club Siegburg wurde in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Wald und Holz, der Firma Pilgram GmbH und dem Heimatverein Lohmar im Sommer 2022 im Staatsforst Lohmarer Wald auf einer Lichtung ein... Auf Initiative und mit finanzieller Förderung des Lions Club Siegburg wurde in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Wald und Holz, der Firma Pilgram GmbH und dem Heimatverein Lohmar im Sommer 2022 im Staatsforst Lohmarer Wald auf einer Lichtung ein ehemaliges Moor wieder "vernässt". Es entsteht eine Ruhezone für die Natur und ein Habitat für Tiere und Pflanzen, die Wasser / Feuchtigkeit und viel Licht benötigen. Ferner sind positive Effekte auf Hydrologie und Mikroklima zu erwarten. Dafür wurden Bäume entfernt, Plastikmüll entsorgt und Entwässerungsgräben durch Dämme mit Flechtzaun und regionalen Tonböden geschlossen. Es handelt sich um eine ca 1,3 ha große Fläche im Naturschutzgebiet Giersiefen, westlich der "Zwölf-Apostel-Buche". Sie liegt im Gebiet eines der größten Heidemoor- und Feuchtheidegebiete im Naturraum Bergische Heideterrasse und damit des gesamten südlichen Rheinlandes. Einige Pflanzen- und Tierarten, die laut aktueller Roter Liste vom Aussterben bedroht sind, finden hier eines ihrer letzten Refugien. Daneben gibt es im Lohmarer Wald noch eine von zwei historischen Teichbewirtschaftungen Nordrhein - Westfalens. Die bis ins Mittelalter zurückgehende Teichbewirtschaftung prägt das Geländerelief noch heute. Der Betrieb soll nicht gefährdet werden. Als Ersatz für Arten, die in bewirtschafteten Teichen keine Lebensgrundlage finden, sollen historische Teiche reaktiviert und somit ein annähernd ursprüngliches Grundwasserniveau wiederhergestellt werden.
| |
|
1918
- 1919 Das Foto zeigt die Kirchstraße mit dem Bahnhofsgebäude im Jahr 1918/19 in Höhe des Hotel Restaurant „zum Aggertal“ von Johann Hermanns in Lohmar. Nach den Waffenstillstandsbedingungen war das Amt Lohmar in einem Radius von 30 Kilometer um Köln... Das Foto zeigt die Kirchstraße mit dem Bahnhofsgebäude im Jahr 1918/19 in Höhe des Hotel Restaurant „zum Aggertal“ von Johann Hermanns in Lohmar. Nach den Waffenstillstandsbedingungen war das Amt Lohmar in einem Radius von 30 Kilometer um Köln Besatzungsgebiet für die alliierten Truppen. Zunächst kamen am 12. Dezember die ersten englischen Soldaten, am 13. und 14. Dezember 1918 Kanadier und als das Waldbarackenlager für die Besatzungstruppen im heutigen Ziegelfeld 1919 gebaut war, folgten denen englische, französische und marokkanische Besatzungssoldaten. Halbverdeckt von den Bäumen am Straßenrand sieht man englische Besatzungssoldaten des Regiments „The Queens“. | |
Die historische Ansichtskarte "Gruss aus Lohmar" zeigt verschiedene gezeichnete Ansichten des Ortes in schwarz-weiß: Oben rechts die "Kirche mit Pastorat", oben links Darstellungen von "Villa Esser" und "Villa Therese". Unten findet sich eine... Die historische Ansichtskarte "Gruss aus Lohmar" zeigt verschiedene gezeichnete Ansichten des Ortes in schwarz-weiß: Oben rechts die "Kirche mit Pastorat", oben links Darstellungen von "Villa Esser" und "Villa Therese". Unten findet sich eine Darstellung des Hotel-Restaurants "Zum Aggerthal" von Johann Hermanns, mittig eine Ortsansicht. Die Karte wurde auf der Rückseite in der unteren rechten Ecke beschrieben, offensichtlich schrieb ein Vater an seine Tochter, und trägt das Datum 03.07.1898. Die Rückseite trägt einen Stempel der Bahnpost, als Orte sind "Cöln (Rhein)" und "Bergneustadt" angegeben. Die Karte wurde nach Hennef (Sieg) verschickt. | |
Die Mehrbildkarte zeigt oben links das Gebäude und oben rechts den Innenraum der Gaststätte „Zur alten Fähre“ um etwa 1930. Unten ist ein Blick vom Lohmarberg auf die alte Eisenbrücke über die Agger von 1899 und die Burganlage, den Bachhof, das... Die Mehrbildkarte zeigt oben links das Gebäude und oben rechts den Innenraum der Gaststätte „Zur alten Fähre“ um etwa 1930. Unten ist ein Blick vom Lohmarberg auf die alte Eisenbrücke über die Agger von 1899 und die Burganlage, den Bachhof, das Pastorat und die Pfarrkirche wiedergegeben. Knapp 100 Meter flussaufwärts vom Gasthaus „Zur alten Fähre“ war die Furt durch die Agger nach Altenrath. Um das Überwechseln von einer Seite auf die andere Seite der Agger zu erleichtern bauten etwa Ende der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die damaligen Burgherren Peter Josef Contzen und Ehefrau Elisabeth Schmitz ein kleines Fährhaus mit Fähre, die von Wilhelm Lehr und später mit seiner Ehefrau Sibylla geb. Buchholz zusammen betrieben wurde. Diese unterhielten in dem Fährhaus schon eine Straußwirtschaft. Später kauften sie das Fährhaus und vererbten es ihrer Tochter Anna Katharina, die Bertram Kronenberg heiratete. Nach dem Bau der Aggerbrücke 1899 kam der Fährbetrieb zum Erliegen. 1902 wurde dann das Fährhaus an die Familie Rottland verkauft, von denen es die Familie Schultheiß erwarb, bis schließlich am 5.5.1914 der aus Troisdorf stammende Schreinermeister Peter Kümpel das Fährhaus kaufte, in dessen Familie es sich bis heute befindet. | |
Mitte August 2022 verzeichnen viele Flüsse in Deutschland Rekordtiefstände infolge der Trockenheit und Hitze. Der Rheinpegel in Köln zeigte am 16.8.2022 nur 73 Zentimeter, knapp über dem historischen Tiefstand von 69 Zentimeter im Hitzesommer 2018.... Mitte August 2022 verzeichnen viele Flüsse in Deutschland Rekordtiefstände infolge der Trockenheit und Hitze. Der Rheinpegel in Köln zeigte am 16.8.2022 nur 73 Zentimeter, knapp über dem historischen Tiefstand von 69 Zentimeter im Hitzesommer 2018. An der Agger liegt der normale Pegelstand in Lohmar bei 7o - 80 Zentimeter. Mitte August liegt der Pegelstand unter null; dass Wasser erreicht den Fuß des Pegels nicht. Noch ein Jahr zuvor im Juli 2021 verursachte ein Hochwasser erhebliche Schäden. Unter anderem stand die Gasstätte "Zur Alten Fähre" unter Wasser.
| |
Der Maler Wilfriedo Becker stellte die Ansicht dar, wie sie in der Zeit zwischen 1950 und 1960 bestand. Rechts steht das Marien-Heiligenhäuschen. Ursprünglich stammt es aus dem 19. Jahrhundert. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde hier viele Jahre lang an... Der Maler Wilfriedo Becker stellte die Ansicht dar, wie sie in der Zeit zwischen 1950 und 1960 bestand. Rechts steht das Marien-Heiligenhäuschen. Ursprünglich stammt es aus dem 19. Jahrhundert. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde hier viele Jahre lang an Fronleichnahm der Segensaltar aufgebaut. 1991 wurde das durch einen Autounfall zerstörte Heiligenhäuschen in der alten Form wiederhergestellt. Dem Kirchgänger oder Wanderer, der früher von Breidt und Deesem nach Birk ging, öffnete sich auf dem "Knippen" am Heiligenhäuschen die weite Sicht auf das untere Kirchdorf über dem Birker Feld. So heißt auch die amtliche Flurbezeichnung. Der Weg, vorbei an dem im Jahr 1384 genannten Hofgut "Bechge in parrochia de Lomer = Bich in der Pfarrei Lohmar, verband von Anbeginn die Siedlungsgebiete diesseits und jenseits des Jabaches. Er wurde 1644 als "Leichweg", auch als Breidter Kirchweg bezeichnet und stand unter dem Schutz der damaligen Obrigkeit. Auf dem Grasstreifen durfte kein Vieh gehütet werden, damit die Benutzer beim Kirchgang oder Leichenzug nicht verunreinigt wurden. Zwischen den Häusern rechts ist der Trockenturm des Feuerwehrhauses an der Hohlen Gasse erkennbar. Das Türmchen wurde um 1950 von Zimmermeister Toni Buchholz aus Inger erbaut und gibt somit den Anhaltspunkt für die Datierung des Gemäldes. | |
Schulentlassung des Jahrgangs 1936/37 zu Ostern 1952 mit Rektor Karl Schmidt. Das Foto wurde vor der Rückwand der Gaststätte Schnitzler gemacht, wo auch die Entlassungsfeier stattgefunden hatte. Schulentlassung des Jahrgangs 1936/37 zu Ostern 1952 mit Rektor Karl Schmidt. Das Foto wurde vor der Rückwand der Gaststätte Schnitzler gemacht, wo auch die Entlassungsfeier stattgefunden hatte. | |
In Bachermühle baute man 1923/24 das Wahlscheider Elektrizitätswerk. Die Agger wurde für diesen Zweck gestaut und so konnten die Sommergäste in den 20er und 30er Jahren vor Naafshäuschen sogenannte „Kahnpartien“ machen. Auch in Wahlscheid baute man... In Bachermühle baute man 1923/24 das Wahlscheider Elektrizitätswerk. Die Agger wurde für diesen Zweck gestaut und so konnten die Sommergäste in den 20er und 30er Jahren vor Naafshäuschen sogenannte „Kahnpartien“ machen. Auch in Wahlscheid baute man Kähne. Bei Hochwasser im Herbst und im Frühling wurden die Kähne über Agger und Sieg bis zum Rhein gebracht. Der „Stapellauf“ war immer ein großes Volksfest. Möglicherweise ist diese „Schiffsbauindustrie“ der Grund dafür, dass viele Bürger in Wahlscheid den Namen Schiffbauer tragen. | |
|
1900
Lohmar um das Jahr 1900. Das Bild zeigt die Hauptstraße in Lohmar in Blickrichtung Siegburg. Die Straße nach Siegburg wurde erst im Jahre 1823 erbaut und 1845 von Beuel nach Overath neu ausgebaut. Das Haus vorne links ist das Haus der Familie... Lohmar um das Jahr 1900. Das Bild zeigt die Hauptstraße in Lohmar in Blickrichtung Siegburg. Die Straße nach Siegburg wurde erst im Jahre 1823 erbaut und 1845 von Beuel nach Overath neu ausgebaut. Das Haus vorne links ist das Haus der Familie Kümmler (Hauptstraße 59), dahinter das Haus der Familie Arenz. Beide Häuser stehen heute noch. Ganz rechts vorne das Haus der Familie Zimmermann, dahinter die Bäckerei Halberg, dann folgt das Haus Schultes. Hier stehen heute die Lohmarer Höfe. Das dahinter liegende Gebäude ist die Gaststätte Schnitzler, die im April 2007 abgerissen wurde. Dann folgt die Gaststätte Knipp und dahinter die Villa Waldesruh. Hier steht heute das Gebäude der Kreissparkasse.
| |
|
1928
Vor 1928 entstand die Aufnahme, nördlich der Einmündung Breiter Weg, mit Blickrichtung nach Süden, Richtung Siegburg, in etwa dort, wo heute der Rathausplatz ist. Das erste Haus rechts auf dem Foto ist die Bäckerei von Peter Kraheck, vormals Peter... Vor 1928 entstand die Aufnahme, nördlich der Einmündung Breiter Weg, mit Blickrichtung nach Süden, Richtung Siegburg, in etwa dort, wo heute der Rathausplatz ist. Das erste Haus rechts auf dem Foto ist die Bäckerei von Peter Kraheck, vormals Peter Weingarten, und auf der linken Seite ist das Haus der Familien Steinbrecher und Palm. Die Hauptstraße ist noch nicht gepflastert und als Allee ausgebildet. An der Hauptstraße 49/Ecke Mittelstraße (heute Rathausstraße) baute der Hufschmied Peter Weingarten an dieser Stelle ein Fachwerkhaus, das aber um 1882 bereits wieder abgerissen wurde. Später errichtete an gleicher Stelle der Metzger Wilhelm Schneppenheim ein größeres Fachwerkgebäude, das 1936 an Peter Meurer überging. Dieser baute die Metzgerei aus und erweiterte sie um eine Fleischkonservenfabrik. | |
|
1951
Nach einigen Jahren losem Zusammenseins hat sich aus diesem Kreis 1951 der KirchstraßenKegelklub „Stell Jonge“ gebildet. Es waren eigentlich keine stillen Jungen, sondern es ging mit viel Alkohol, Späßen, Liedern und Witzen immer hoch her in diesem... Nach einigen Jahren losem Zusammenseins hat sich aus diesem Kreis 1951 der KirchstraßenKegelklub „Stell Jonge“ gebildet. Es waren eigentlich keine stillen Jungen, sondern es ging mit viel Alkohol, Späßen, Liedern und Witzen immer hoch her in diesem Klub. Das Klublokal war das Gasthaus „Zur alten Fähre“, damals unter dem Pächter Karl Weyer. | |
Auf dem Foto sitzt der letzte Lohmarer Besenbinder und Korbflechter Johann Eykamp um 1895 vor seinem Haus in Sottenbach. Hinter ihm rechts steht seine Ehefrau Gertrud, die anderen sind wahrscheinlich Familienangehörige. Nach verbürgten Angaben wohnte... Auf dem Foto sitzt der letzte Lohmarer Besenbinder und Korbflechter Johann Eykamp um 1895 vor seinem Haus in Sottenbach. Hinter ihm rechts steht seine Ehefrau Gertrud, die anderen sind wahrscheinlich Familienangehörige. Nach verbürgten Angaben wohnte er 1900 mit seiner Familie im Holzbachtal unterhalb von Lohmarhohn. Johann Eykamp wurde am 20.7.1845 in Altenrath geboren. Sein Vater war der Leinenweber Peter Eykamp aus Menzlingen, der Sybilla Pier aus Altenrath geheiratet hatte. Johann Eykamp war der älteste von fünf Kindern. Er war von Beruf Korbmacher und heiratete die am 20.11.1839 in Altenrath geborene Gertrud Straeßer. Mit ihr hatte er einen Sohn Johann, der etwa 1868 in Menzlingen geboren wurde. Das heißt, dass er zunächst in Menzlingen bei Rösrath gewohnt hatte. Seine Ehefrau Gertrud starb mit 77 Jahren am 9.1.1917 in Lohmar. Er ist mit 80 Jahren am 15.6.1926 ebenfalls in Lohmar gestorben. Sibilla Wacker geb. Küpper, die bis zu ihrer Heirat auf dem Gut Lohmarhohn lebte, erzählte ihrem Enkel Raimund Schüller, dass „de Eekamp“ in einem stets reich mit Blumen umgebenen Holzhaus der ehemaligen Erzgrube „Moritz“ in der Nähe der Holzbachmündung in den Auelsbach wohnte und dass er immer mehrere Hosen übereinander trug, weil er meist bei seiner Arbeit auf dem Boden gesessen saß. | |
Die folgende Sage wurde dem vertorbenen Heimatforscher Johannes Heinrich Kliesen von den alten Lohmarern Johannes Pohl, Anton Lehr, Johann Höndgesberg und Peter Kemmerich überliefert. Die Geschichte dürfte aus dem Flurnamen "Turm-Markts... Die folgende Sage wurde dem vertorbenen Heimatforscher Johannes Heinrich Kliesen von den alten Lohmarern Johannes Pohl, Anton Lehr, Johann Höndgesberg und Peter Kemmerich überliefert. Die Geschichte dürfte aus dem Flurnamen "Turm-Markts Garten"entstanden sein, ein Gartengrundstück an der Bachstraße, dass lange schmale Parzellen in Hufenform hatte. An der Bachstraße, schräg gegenüber der ehemaligen Schmiede, bei der Gastwirtschaft „Schwanenhof“ ist das Flurstück „Turm-Markts Garten“. Auf dieser langen und schmalen Parzelle soll sich nach sagenhafter Mär eine mit einigen Sandsteinen markierte kleine Grasfläche von etwa 60 x 120 cm befunden haben , bei der es sich um ein Grab gehandelt haben soll. Die Parzelle, auf der sich eine Hofanlage mit einem Turm befand, war damals im Besitz der Herren der Burg von Lohmar. Bis die grabähnliche Fläche bei Bauarbeiten oder mit dem Pflug spätestens Ende des 19. Jahrhunderts eingeebnet wurde, erzählten die Lohmarer „Oberdörfler “ im Bereich der Kieselhöhe von einem „Grab der Burg“ oder vom „Turmsgrab“. Nach der Überlieferung soll es sich um das Grab eines Burgherren oder eines adeligen Junkers handeln, der auf diesem Gelände bei einem ritterlichen Zweikampf verwundet und dann aber von den Gefährten seines Gegners meuchlings ermordet wurde. Zum Gedenken daran läutete jedesmal am Todestag das Turmglöcklein. Für das Läuten soll noch bis in die Zeit der Burgherren „von der Reven“ ein kleiner Zehnt an den Glöckner gezahlt worden sein. Auf der Kieselhöhe erzählte man sich, dass noch im frühen 19. Jahrhundert in der dortigen Schänke auf diese Begebenheit gertunken wurde mit den Worten: „Ex, op de Huhwohljeborene vom Backesjade" (Austrinken auf den Hochwohlgeborenenen vom Backesgarten). Backesgarten ist das angrenzende Grundstück, dass den Lohmarern geläufiger ist. | |
|
1931
- 1934 Nach dem gewonnen Krieg 1870/71, als das deutsche Volk eine Zeit der Hochstimmung durchlebte, gründeten die Veteranen der Gemeinde im Jahre 1871 den Kameradschaftlichen Kriegerverein Honrath. 13 Jahre später kam es im Zentralort Wahlscheid zur... Nach dem gewonnen Krieg 1870/71, als das deutsche Volk eine Zeit der Hochstimmung durchlebte, gründeten die Veteranen der Gemeinde im Jahre 1871 den Kameradschaftlichen Kriegerverein Honrath. 13 Jahre später kam es im Zentralort Wahlscheid zur Gründung eines 2. Vereins. In den Kameradschaftlichen Kriegervereinen wurden die militärischen Erinnerungen sowie die nationale Gesinnung wachgehalten. Ferner sollte die Kameradschaft der ehemaligen Soldaten erhalten bleiben und notleidende Mitglieder unterstützt werden.
| |
Das Foto wurde anlässlich der letzten Ratssitzung der Gemeinde Inger vor der Gaststätte Fielenbach in Birk aufgenommen. Die Gemeinde Inger gehörte bis zur kommunalen Neugliederung 1969 zum Amt Lohmar. Bürgermeister war von 1951 bis Juli 1965 Karl... Das Foto wurde anlässlich der letzten Ratssitzung der Gemeinde Inger vor der Gaststätte Fielenbach in Birk aufgenommen. Die Gemeinde Inger gehörte bis zur kommunalen Neugliederung 1969 zum Amt Lohmar. Bürgermeister war von 1951 bis Juli 1965 Karl Weiler sen. und danach, bis zur Auflösung des Rates Hermann Fielenbach. Nach Auskunft von Wolfgang Beyer, hatte der Kämmerer des Amtes Lohmar, anlässlich der letzten Ratssitzung, ein Verpflegungsgeld in Höhe von DM 5,-- je Ratsmitglied bewilligt.
| |
|
November 2011
- Februar 2012 Von Ende November 2011 bis Anfang 2012 beobachtete Georg Blum aus seinem Wohnzimmerfenster in der Altenrather Straße 1 auf der Windrose und dem Wetterhahn der katholischen Kirche Sankt Johannes in Lohmar eine von morgens 8 Uhr an ständig wachsende... Von Ende November 2011 bis Anfang 2012 beobachtete Georg Blum aus seinem Wohnzimmerfenster in der Altenrather Straße 1 auf der Windrose und dem Wetterhahn der katholischen Kirche Sankt Johannes in Lohmar eine von morgens 8 Uhr an ständig wachsende Zahl von Staren. Mit einem 800-mm Objektiv mit zweifachem Konverter, als 1600 mm Brennweite fotografierte er die Versammlung aus einer Luke des Dachgeschosses. Etwas problematisch dabei waren die Luftschlieren durch die Warmluft aus den Heizungen, die Unschärfen auf dem Foto erzeugen. | |
|
1910
Der Handwerkerverein wurde im Jahr 1881 gegründet und hatte durchschnittlich 30 Mitglieder. Man wollte Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig unterstützen. Es gab sogar eine Krankheits- und Todesfallversicherung für einen kleinen... Der Handwerkerverein wurde im Jahr 1881 gegründet und hatte durchschnittlich 30 Mitglieder. Man wollte Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig unterstützen. Es gab sogar eine Krankheits- und Todesfallversicherung für einen kleinen Vereinsbeitrag. Der Verein war konservativ ausgerichtet. In schöner Uniform wurde Kaiser`s Geburtstag, das Krönungsfest und das Sedanfest (Erinnerung an die französische Kapitulation in der Schlacht von Sedan 1870) zusammen mit dem Kameradschaftlichen Kriegerverein gefeiert. Am 7. Juli 1931 wurde noch das goldene Vereinsjubiläum gefeiert. Beim Festzug waren die Häuser mit Blumen und Fahnen geschmückt und 20 Ehrenpforten errichtet. Nur wenige Jahre später wurde in Folge der sogenannten Gleichschaltung (Vereinheitlichung des gesellschaftlichen und politischen Lebens) im Nationalsozialismus der Handwerkerverein aufgelöst. | |
Unter dem 1871 neugegründeten Kaiserreich erfuhr die schulpolitische Entwicklung bereits 1872 durch die "Allgmeinen Bestimmungen vom 15. Oktober 1872" eine fortschrittliche Revision. Nicht mehr die einklassige Schule, sondern auch die mehrklassige... Unter dem 1871 neugegründeten Kaiserreich erfuhr die schulpolitische Entwicklung bereits 1872 durch die "Allgmeinen Bestimmungen vom 15. Oktober 1872" eine fortschrittliche Revision. Nicht mehr die einklassige Schule, sondern auch die mehrklassige sollte künftig als „normal“ gelten. Die Größe der Klassenräume wurde auf mindestens 48 qm festgesetzt. Die Kinderzahl der einklassigen Schulen unter einem Lehrer durfte nicht über 80 steigen. Die Unterrichtsfächer waren Religion, Deutsch, Rechnen und Raumlehre, Singen, Zeichnen, Realien (Vaterlands- und Naturkunde) und Turnen. Ebenfalls sollten die Lehrergehälter aufgebessert werden und die Lehrerbildung gefördert werden. Das Jahreseinkommen eines Erstlehrers betrug um das Jahr 1880 ohne die kostenlose Überlassung einer Wohnung 1050 Mark. Es gab mit Altenrath, Birk, Breidt, Ellhausen (ab 1889), Heide, Honrath, Lohmar, Neuhonrath, Scheiderhöhe und Wahlscheid insgesamt 10 Volksschulen, davon drei evangelische Volksschulen (Wahlscheid, Heide, Honrath) und sieben katholische Volksschulen. Ab 1910 wurde in 19 Klassen Unterricht erteilt. Die Schülerzahl belief sich auf über 1150 Schülerinnen und Schüler.
| |
Das Foto ist vor dem alten Schulgebäude in der Kirchstraße (heute Lidl-Parkplatz) gemacht worden. Von links nach rechts und von oben nach unten: 1. Reihe: Kaplan Josef Hoppe, Luci Keuler, Elisabeth Schüller, Else Zimmermann, Anna Berg, Elisabeth... Das Foto ist vor dem alten Schulgebäude in der Kirchstraße (heute Lidl-Parkplatz) gemacht worden. Von links nach rechts und von oben nach unten: 1. Reihe: Kaplan Josef Hoppe, Luci Keuler, Elisabeth Schüller, Else Zimmermann, Anna Berg, Elisabeth Funken, Annemarie Klein verh. Ginster, Liesel Schneider, Maria Krieger, Maria Emmerich verh. Eschbach, Gertrud Müller und Lehrerin Gertrud Wingensiefen 2. Reihe: ? Arnold, Hans Schug, ? Wielpütz, Josef Büscher (Sohn von Peter Büscher, Ziegelfeld), Josef Rösing, Arno Deurer, Wilma Boddenberg, Margarete Hagen verh. Klug, Elisabeth Müller verh. Klein, Käthi Schönenborn verh. Löhrer und Elisabeth Deurer. 3. Reihe: Heinz Hagen, Margarete Rottländer, Käthi Kurtsiefer, Elli Weingarten verh. Dienemann, Else Ramme, Gertrud Grünacher, Doris Harnisch, Margarete Kurtsiefer verh. Lüdenbach, Gerta Kurtsiefer verh. Meng, Magda Kuttenkeuler, Hanni Kurtsiefer und Peter Schneider. 4. Reihe : Günter Boddenberg, Josef Harnisch, Hermann Moßbach (Jabachhof), Ludwig Bouserath, Hans Josef Eich, Friedrich Lüdenbach, Gerd van Goch, Josef Schneider, ? Deurer, ? Jaguschewski, Heinz Ramme (Bruder von Richard Ramme, Kirchstraße), Paul Miebach, ? Gorissen und Karl Weiß. | |
|
1930
- 1935 August Hüser betrieb mit Heinrich Stratmann zusammen einen Anstreicherbetrieb in einem Fachwerkhaus (Doppelhaus) an der Hauptstraße 14-16 . In der anderen Haushälfte hatte das Ehepaar Hüser, nachdem das Kleineisengeschäft der Gebrüder Pape in den... August Hüser betrieb mit Heinrich Stratmann zusammen einen Anstreicherbetrieb in einem Fachwerkhaus (Doppelhaus) an der Hauptstraße 14-16 . In der anderen Haushälfte hatte das Ehepaar Hüser, nachdem das Kleineisengeschäft der Gebrüder Pape in den 1920er Jahren aufgegeben wurde, einen Tante-Emma-Laden. In den 1940er Jahren übernahm Paul Alex das Lebensmittelgeschäft und danach Maria Klein. Danach befand sich bis Mai 2023 im linken Teil des Gebäudes das Wolle und Handarbeitsgeschäft Niedergesäss. | |
Das „Kleins Büdchen“ für Obst, Gemüse und Süßigkeiten in der Kirchstraße zwischen Haus Knipp und „Hotel zur Linde“ ist hier im Jubiläumsjahr 1952 fotografiert. Das „Kleins Büdchen“ für Obst, Gemüse und Süßigkeiten in der Kirchstraße zwischen Haus Knipp und „Hotel zur Linde“ ist hier im Jubiläumsjahr 1952 fotografiert. | |
In einem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter 2009 stellte Jürgen Morich ein Bilderrätsel. Es war gedacht als Selbsttest, um 40 Jahre nach der kommunalen Neuordnung zu erfahren, wie gut man sich auskennt im größer gewordenen Lohmar. Wer Lust hat... In einem Beitrag für die Lohmarer Heimatblätter 2009 stellte Jürgen Morich ein Bilderrätsel. Es war gedacht als Selbsttest, um 40 Jahre nach der kommunalen Neuordnung zu erfahren, wie gut man sich auskennt im größer gewordenen Lohmar. Wer Lust hat am Ratespiel: Zu jeder Gebäude-Beschreibung in der Liste sucht man das passende Foto und schreibt den Kennbuchstaben des Fotos in das Kästchen. Wenn man am Schluss alle Kästchen von oben nach unten liest, sollten sich die Namen von drei Gewässern ergeben, die im Lohmarer Stadtgebiet fließen. Die Lösung ist im Bild "Sütterlin Schrift" zu lesen. Die Schrift war von 1924 - 1941 die deutsche Standardschrift, die die Erstklässler in Schulen lernten. | |
Lehrerin Helene Ravens (ganz rechts) mit ihrer Klasse. Die Volksschule in Birk hatte in den 20er und 30er Jahren ca. 70 - 80 Schüler. Sie waren in zwei Klassen aufgeteilt, Die 4 jüngeren Jahrgänge wurden von Frau Ravens unterrichtet, die 4 älteren... Lehrerin Helene Ravens (ganz rechts) mit ihrer Klasse. Die Volksschule in Birk hatte in den 20er und 30er Jahren ca. 70 - 80 Schüler. Sie waren in zwei Klassen aufgeteilt, Die 4 jüngeren Jahrgänge wurden von Frau Ravens unterrichtet, die 4 älteren Jahrgänge von Herrn Eulenbruch. | |
|
1950
- 1960 Auf dem Foto, im Herz-Jesu-Monat Juni aufgenommen, ist Kaplan Toni Ley, der von 1950-1960 Kaplan in Lohmar war, bei einer Trauung zu erkennen. Auf dem Foto, im Herz-Jesu-Monat Juni aufgenommen, ist Kaplan Toni Ley, der von 1950-1960 Kaplan in Lohmar war, bei einer Trauung zu erkennen. | |
|
1955
- 1965 In der Wielpützer Straße Nr. 18 in Wielpütz sind drei Fachwerkhäuser aneinander gebaut, die man die „Schniederei“ nennt – wahrscheinlich weil in einem der Häuser irgendwann eine Schneiderei war. In dem linken Haus auf dem Foto, aus der Mitte der... In der Wielpützer Straße Nr. 18 in Wielpütz sind drei Fachwerkhäuser aneinander gebaut, die man die „Schniederei“ nennt – wahrscheinlich weil in einem der Häuser irgendwann eine Schneiderei war. In dem linken Haus auf dem Foto, aus der Mitte der 1960er Jahre, wohnte Maria Brehm (et Brähms Marieche), in der Mitte Familie Hupperich, später Wirges und in dem rechten Haus die Geschwister Josef, Lena (Lenchen) und Mienchen Kellershohn. In dem mittleren Haus hatte Willi Wirges in den 1950er Jahren eine Schuhmacher-Werkstatt. Er war neben seinem Beruf auch Fußball-Schiedsrichter und sorgte viele Jahre dafür, dass auf dem Wielpützer Bolzplatz die Regeln eingehalten wurden. Er hat in den 1950er Jahren auch manches Spiel des TuS Lohmar „gepfiffen“. | |
Mit dem Bau der Wahlscheider Chaussee im Jahr 1844 und der Aggertalbahn (Luhmer Grietche) 1884 setzte ein wirtschaftlicher Aufschwung ein. Auch auf kulturellem Gebiet erlebte man den Anschluss an die große weite Welt. Stadtbewohner kamen zur... Mit dem Bau der Wahlscheider Chaussee im Jahr 1844 und der Aggertalbahn (Luhmer Grietche) 1884 setzte ein wirtschaftlicher Aufschwung ein. Auch auf kulturellem Gebiet erlebte man den Anschluss an die große weite Welt. Stadtbewohner kamen zur „Sommerfrische“ nach Wahlscheid. Davon profitierten zunächst die Bewohner des „J(G)rongk“ (Grund = Tal), mit Verzögerung – wegen der räumlichen Entfernung – die Bergbewohner. Die Städter brachten neben „Kultur“ auch „Bildung“ mit. Wenn die zwischen Naaf- und Aggertal lebenden Höhenbewohner etwas vornehmer verkehren wollten, begaben sie sich in den Jrongk, d.h. in den Auelerhof, der gut von Kölner Gästen besucht wurde (es heißt, daß Willi Ostermann hier sein Lied von der „Mösch“ geschrieben hat). Bauern „vom Berg“ sollen ihre Töchter dirigiert bzw. gedrängt haben, zu Tanzveranstaltungen nur in den Auelerhof zu gehen. Dabei hatten sie den Hintergedanken, den Töchtern mit einer „guten Heirat“ ein besseres Leben zu bescheren. Wenn es übertrieben wurde, hatten die Mädels jedoch schnell einen Spitznamen (z.B. „Gebirgsengel“). Hans Karl Kirschbaum, Haus-Dorp, erzählte, daß Otto Kirschbaum, der Wirt „vom Berg in Höffen“, in den 30er Jahren junge Männer aus dem „Jrongk“ mit den Worten „Ihr Weltverbesserer“ begrüßt hat. Der „Bildungsunterschied“ war auch überregional feststellbar. Je weiter man von Köln entfernt wohnte, desto weniger war man von der „Kultur beleckt“. Die „Volberger“ (Hoffnungsthaler) waren am fortschrittlichsten; man nannte sie wegen ihrer Einbildung die „Volberger Füppede“. Die Wahlscheider mit guter Bahnverbindung nach Köln waren wiederum fortschrittlicher als die Seelscheider. Zwischen den Höhenorten im „Over-Kierspell“ (Oberkirchspiel) und den Dörfern im Tal lagen damals Welten. Man gehörte zwar gemeinsam – bis auf wenige kath. Familien – der evangelischen Kirchengemeinde Wahlscheid (die nördlich gelegenen Orte gehörten allerdings zur evangelischen Kirchengemeinde Honrath) an, ging aber in zwei verschiedene Schulen nach Heide und Wahlscheid. Die Jugendlichen lernten sich erst näher kennen, wenn sie gemeinsam den Katechumen-/Konfirmandenunterricht besuchten.
| |
|
1994
Bis 1884 war Haus Stolzenbach Poststelle für die durch Pferdepostkutschen betriebene Strecke Bonn-Hangelar-Siegburg-Ründeroth. Zeitweise waren acht Briefträger tätig. Mit Inbetriebnaheme der Aggertalbahn wurde 1884 das Postamt Stolzenbach aufgelöst.... Bis 1884 war Haus Stolzenbach Poststelle für die durch Pferdepostkutschen betriebene Strecke Bonn-Hangelar-Siegburg-Ründeroth. Zeitweise waren acht Briefträger tätig. Mit Inbetriebnaheme der Aggertalbahn wurde 1884 das Postamt Stolzenbach aufgelöst. Es folgten Postämter in verschieden Häusern. Später waren unter der postalischen Bezeichnung „Siegburg-Land“ in einigen Weilern der Gemeinde Posthalter tätig. Es waren dies per 1931: Otto Wahlen,Kreuznaaf, Otto Oberdörster, Wahlscheid, Rudolf Lindenberg, Münchhof, Wilhelmine Koch, Weeg, Wilhelm Radermacher, Höffen, Wilhelm Breideneichen, Oberstehöhe, Wilhelm Schiffbauer, Kern, Otto Fischer, Agger, Josef Stocksiefen, Bachermühle, Emil Otto, Honrath, Wilhelm Klein,Frackenpohl, Hermann Schauenberg, Scheid. Die Post wurde den vorgenannten Posthaltem von Siegburg aus mit einem kleinen Lieferwagen, der auch Personen – soweit Platz vorhanden war – beförderte, angeliefert. Die Briefträger hatten die Post auszutragen. Sie waren gern gesehene Leute. Sie sahen und hörten viel und brachten Neuigkeiten unter das Volk. Große Mengen hatten sie nicht auszutragen, aber weite Strecken mußten sie zurücklegen. Briefkästen kannte man noch nicht; die Briefträger drückten dem Empfänger den Brief noch persönlich in die Hand und hatten Zeit für ein „Verzällchen“ (Gespräch). Äußeres Zeichen für die beschwerlichen weiten Fußmärsche sind die Spazierstöcke. Oder waren die Stöcke als Verteidigungswaffe gegen Hunde und Banditen gedacht?. Die Briefträger zahlten damals auch noch Geld – z.B. die Rente – aus.
| |
|
1581
- 1971 Die Schule Honrath zählt zu den ältesten urkundlich belegten Schulen der Stadt Lohmar. Seit 1581 war sie über lange Zeit eine Pfarr- und Küsterschule und spätestens ab 1614 evangelischer Konfession. Am 22. März 1581 hatte der damalige Glöckner und... Die Schule Honrath zählt zu den ältesten urkundlich belegten Schulen der Stadt Lohmar. Seit 1581 war sie über lange Zeit eine Pfarr- und Küsterschule und spätestens ab 1614 evangelischer Konfession. Am 22. März 1581 hatte der damalige Glöckner und Opfermann Peter von der Linde den Schuldienst in seinem Haus übernommen. Im Jahre 1729 wurde der Opfermann Johann Peter Speck in sein Amt eingeführt und nannte sich auch Schulmeister. In seiner Zeit, etwa um 1740, dürfte die alte Schule (Zum Kammerberg 20), die noch heute steht, erbaut worden sein. 1839 wurde ein zweiter Schulsaal angebaut. In den ersten zehn Jahren der Amtszeit von Lehrer Karl Brüning ab 1843 sind die Unterrichtsresultate festgehalten: Geprüfte Fächer waren Kopfrechnen, Tafelrechnen, Singen, Schreiblesen, Realien (Naturwissenschaften), Jahr Anwesende Kinder Resultate der Prüfung Eine für die Schulgemeinde wichtige Entscheidung fiel am 4. März 1927 durch Beschluss des Gemeinderates Wahlscheid. Vom Gutsbesitzer Heinrich Schlenkhoff wurden 3 Morgen Land zum Bau einer neuen Schule in Honrath (Zum Kammerberg) erworben. Die Einweihungsfeier der neuen Schule fand am Samstag, den 1. Juni 1929 statt. Glockengeläute lud zum Festgottesdienst ein. Pfarrer Zänker würdigte das bedeutende Ereignis in einer Festpredigt. Bei der anschließenden Einweihungsfeier gingen hohe Vertreter der Regierung, des Kreises, der Gemeinde sowie die Freunde aus den Nachbarpfarreien und Schulvorständen auf den tiefen Sinn und Wert des neuen Schulhauses sowie des öffentlichen Schulwesens ein. Der Hauptlehrer Betge konnte stolz an die 350jährige Geschichte der Schule Honrath erinnern. Schließlich empfing der Bauherr, repräsentiert in der Person des Bürgermeisters Max Koch, den Schulschlüssel aus der Hand des Kölner Architekten Erberich. Da der dreiklassige Schulbetrieb räumlich sehr beengt war, wurde 1955 mit den Bauarbeiten für einen Schulanbau begonnen und mit der Eröffnungsfeier am 20. März 1956 abgeschlossen. Aus den Jahrgängen 1 bis 4 der Schule entstand mit den Schülern der Gemeinschaftsschule Wahlscheid ab 1. August 1968 die Gemeinschaftsgrundschule Honrath und ab 1. August 1969 unter Einbeziehung der bisherigen katholischen Volksschule Neuhonrath die Gemeinschaftsgrundschule Wahlscheid, welche Anfang 1972 in dem neu erbauten Schulzentrum (Mittelpunktschule). Neuhonrath, Krebsaueler Straße ihren Standort fand. In Honrath schlossen sich Ende 1971 endgültig die Schulpforten.Hier wurde eine Kindertagestätte eingerichtet. | |
|
1970
- 1980 Die Postkarten zeigen den Ort Honrath und das Hotel "Schöne Aussicht" in den 1970/80er Jahren. Von der Hotelveranda hatte man einen schönen Ausblick ins Aggertal. 2008 gewann Honrath im Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" die Goldmedaille.... Die Postkarten zeigen den Ort Honrath und das Hotel "Schöne Aussicht" in den 1970/80er Jahren. Von der Hotelveranda hatte man einen schönen Ausblick ins Aggertal. 2008 gewann Honrath im Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" die Goldmedaille. Anfang des 21. Jahrhunderts wurde das Gasthaus umgebaut. Es wurden mehrere Wohnungen geschaffen, in denen Künstlerfamilien aus dem Kölner Raum leben. Der Saal mit Bühne blieb eine zeitlang erhalten und wurde für private Veranstaltungen genutzt. | |
Die Katholische Pfarrgemeinde St. Mariä Himmelfahrt in Neuhonrath, am Sonntag, dem 21. September 1738 benediziert, hatte im September 2013 das 275-jährige Jubiläum ihres Bestehens und der Einweihung ihrer Kirche gefeiert. Die neu errichtete... Die Katholische Pfarrgemeinde St. Mariä Himmelfahrt in Neuhonrath, am Sonntag, dem 21. September 1738 benediziert, hatte im September 2013 das 275-jährige Jubiläum ihres Bestehens und der Einweihung ihrer Kirche gefeiert. Die neu errichtete Pfarrkirche Neuhonrath war für die verbleibenden Katholiken in den Kirchengemeinden Honrath und Wahlscheid errichtet worden, nachdem die Pfarrei im 16. Jahrhundert während der Reformation zum evangelischen Bekenntnis übergegangen war. Die beiden Fotografien zeigen die Kirche, einen schlichten Saalbau mit fünf stehenden, rechteckigen Fensterpaaren und dreiseitigem Schluss. Die Halle und der Altarraum sind 1969 restauriert worden. Der Schöffenstuhl des Schultheißen Wimar Ley, Honsbach aus dem Jahr 1641, die Monstranz mit Medaillen von 1735 und der Kelch mit Deckel (Herkunft nicht bekannt) sind die ältesten„Pertinenzstücke“ der Kirche (Ausstattungsstücke sind: Kunstwerke, Orgel, Altäre, Kanzel, Bilder, Turmuhr, Glocken wie auch Urkunden und Schriften, etc.).
| |
Die Ehrentafel mit 103 Gefallenen oder Vermissten und 240 Soldaten, die den Krieg überlebten, wurde auf einem Wahlscheider Flohmarkt erworben und ist im Besitz von Dierk und Evi Meyer, Neuhonrath. Der langjährige Hauptamtsleiter der Gemeinde und... Die Ehrentafel mit 103 Gefallenen oder Vermissten und 240 Soldaten, die den Krieg überlebten, wurde auf einem Wahlscheider Flohmarkt erworben und ist im Besitz von Dierk und Evi Meyer, Neuhonrath. Der langjährige Hauptamtsleiter der Gemeinde und späteren Stadt Lohmar, Horst Nieß, kann sich erinnern, bei Aufräumarbeiten im Wahlscheider Rathaus im Zuge der kommunalen Neuordnung 1969, auch eine solche Ehrentafel vorgefunden zu haben. Der Spruch auf der Ehrentafel „Wer den Tod im heiligen Kampfe fand, ruht auch in fremder Erde im Vaterland“ ist ein Textauszug aus dem Soldatenlied „Zum Ausmarsch“ ,Text und Melodie von A. Methfessel (1785 – 1869). Der erste Weltkrieg begann am 28. Juli 1914. Wichtige Kriegsparteien waren die sogenannten Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn gegen die verbündeten Entente-Staaten Frankreich, Großbritannien und Russland. Im November 1918 endete der Krieg mit der militärischen Niederlage Deutschlands und seines Bündnispartners Österreich-Ungarn. Der Tod als ständiger Begleiter der Frontsoldaten wurde zum "Heldentod für das Vaterland" verklärt. Im Ersten Weltkrieg starben mehr als neun Millionen Soldaten, darunter über zwei Millionen aus Deutschland, fast 1,5 Millionen aus Österreich-Ungarn, über 1,8 Millionen aus Russland, annähernd 460.000 aus Italien. Frankreich hatte über 1,3 Millionen, Großbritannien rund 750.000 militärische Todesfälle zu beklagen. Hinzu kamen etwa 78.000 Tote aus den französischen und 180.000 Tote aus den britischen Kolonien. Die USA verloren nach ihrem Kriegseintritt im April 1917 rund 117.000 Mann in Europa. Mehr als sechs Millionen Zivilisten kamen ums Leben.
| |
Die Kirche St. Bartholomäus auf dem Berge wird 1166 erstmalig urkundlich erwähnt. Seit 1557 ist sie evangelische Gemeindekirche. In dem Artikel "Von Propheten und Aposteln verkündet" für die Lohmarer Heimatblätter 2005 widmet sich Heinrich Imbusch... Die Kirche St. Bartholomäus auf dem Berge wird 1166 erstmalig urkundlich erwähnt. Seit 1557 ist sie evangelische Gemeindekirche. In dem Artikel "Von Propheten und Aposteln verkündet" für die Lohmarer Heimatblätter 2005 widmet sich Heinrich Imbusch (†) den Buntglasfestern der Kirche. Zu Beginn stellt er zwei Fragen: Können Sie sich vorstellen, dass die Entwürfe von Meister Gottfried, wie der damalige Pastor Fritz Pleuger ihn nannte, Anfang der 1960er-Jahre im Vorstand der ländlichen Gemeinde Wahlscheid heftige Diskussionen auslösten? Schätzen Sie diese Bilder als realistisch, romantisch, naturalistisch, abstrakt, historisierend, symbolisch oder naiv ein? Welcher Kunstrichtung würden Sie die Bilder zuordnen? Bekannt wurde Hermann Gottfried mit seinen Arbeiten u. a. am Straßburger Münster sowie an den Kölner Kirchen Groß Sankt Martin und Sankt Aposteln. Aber auch die Bilder in Wahlscheid zeigen bedeutende Kunst. Hermann Gottfried urteilt über den Beitrag: "Sie schildern mit wenigen, aber greifenden Zeilen das, was visuell | |
Die Armaturenfabrik Johann Fischer in der Hermann-Löns-Straße war damals der größte Industriebetrieb in Lohmar und hatte 1945 etwa 1000 Mitarbeiter. Auf dem Foto von etwa 1935 ist die Belegschaft dieser Zeit zu sehen: 1. der Eigentümer Johann... Die Armaturenfabrik Johann Fischer in der Hermann-Löns-Straße war damals der größte Industriebetrieb in Lohmar und hatte 1945 etwa 1000 Mitarbeiter. Auf dem Foto von etwa 1935 ist die Belegschaft dieser Zeit zu sehen: 1. der Eigentümer Johann Fischer, 2. Martin Köb, 3. Hubert Pohl sen. 4. Fred Allmann, 5. Ludwig Hallberg, 6. Karl Schwarzrock, 7. Heinrich Kirschbaum, 8 ? Otto, 9. Wilhelm Schmitz (de stürmesch Well, Kirchstr.), 10. Josef Dreck, 11. Maria Keller (et Mütti), 12. Heinz Müller (Sohn vom Zeitungsausträger Jakob Müller), 13. Josef Pollerhoff, 14. Heinrich Boddenberg, 15. Gertrud Kiel, geb. Piller, 16. Matthias Bouserath, 17. Wilhelm Müller (Kirchstr.), 18. Georg Müller, 19. Willi Klug, 20. Jean Pütz, 21. ? Mahlberg, 22. Willi Kurtsiefer, 23. Gerhard Schönenborn, 24. Heinrich Emmerich, 25. Wilhelm Schüchen, 26. Josef Kiel, 27. Wilhelm Krieger, 28. ? Niethen, 29. Wilhelm Kurtsiefer (Kieselhöhe), 30. Hermann Bindhammer, 31. Wilhelm Kümmler, 32. ? Altwickler, 33. Gertrud Eschbach, 34. Rainer Fischer, 35. Hubert Dilly, 36. Stefan Fischer, 37. Heinz Keller, 38. Maria Demmer, 39. Hedwig Otten, 40. Hubert Krämer, 41. Franz Stauf, 42. Heinrich Könsgen, 43. Karl Lürken, 44. ? Lüdenbach, 45. Henny Eiteneuer, 46. Lieschen Kehrenbach, 47. Roland Piller, 48. Käthe Harnisch, 49. Karl Krauthäuser?, 50. ? Altwickler, 51. ? Roland?, 52. Änne Eschbach, 53. Bernd Arenz?, 54. Adolf Schierenbeck, 55. Viktor Brüll, 56. ? Burger, 57. Irmgard Gärtner, 58. Johannes Lüdenbach, 59. Leni Weingarten, 60. Betty Möres, verh. Bindhammer, 61. Gerta Broicher, verh. Bürvenich?, 62. Josef Fischer, 63. ? Schneider, 64. Paul Engeländer, 65. ? Lux?, 66. ? Knipp, 67. Kätti Niethen, 68. ? Krieger, 69. Johanna Paffrath (Gebermühle), 70. Johann Weiher und 71. ? Wolff. | |
Das erste Bild zeigt in der Mitte das von Lehrer Johann Scharrenbroich 1818 erbaute Fachwerkhaus. Es wurde 1856 von dessen ledig gebliebenen Tochter Veronika der Kirche in Birk als Stiftung für wohltätige Zwecke vermacht. Das Haus hieß danach... Das erste Bild zeigt in der Mitte das von Lehrer Johann Scharrenbroich 1818 erbaute Fachwerkhaus. Es wurde 1856 von dessen ledig gebliebenen Tochter Veronika der Kirche in Birk als Stiftung für wohltätige Zwecke vermacht. Das Haus hieß danach „Veronikastift“ und diente lange Zeit der Gemeindeschwester Maria Höck als Wohnung. Durch die Erweiterung der Pfarrkirche mit neuem Turm 1888 verblieb zwischen Kirche und benachbarter Bebauung nur ein enger Fußpfad. Dicht neben dem Veronikastift stand die uralte Gaststätte und Schnapsbrennerei Scharrenbroich, vormals Dick und Kuttenkeuler. Im rückwärtigen Saal fand eine Zeit lang bis 1846 Schulunterricht statt. Durch die dichte Bebauung um die Kirche war die Dorfstraße so eng, dass ein Gegenverkehr nicht möglich war. Das zweite Foto ist Teil einer Ansichtskarte und spiegelt ein Stück Familiengeschichte aus Birk vor 1930 wider. In der Ansichtskarte, die um 1900 entstanden sein mag, ist oben links, die alte Gaststätte Scharrenbroich in der Dorfmitte von Birk in ihrer gesamten Vorderfront dargestellt. Oben rechts ist die schon klassisch zu bezeichnende Sicht von Süden auf Kirche und Schule dargestellt. Unten links ist eine Ansicht auf Dorf und Kirche von den Wiesen der Scharrenbroichs aus nördlicher Richtung gezeigt. Die freie Ecke rechts enthält die frühere Schreibweise des Ortes „Birck“. Das dritte Foto, das offenbar im Oktober 1929 entstanden ist, zeigt vor der Haustür der Gaststätte von links Wilhelmine Eich geborene Scharrenbroich mit Sohn und Tochter, Frau Anna Maria Scharrenbroich geb. Broichhausen mit ihrer fast ein Jahr alten Tochter Margot und den letzten Gastwirt des Hauses Toni Scharrenbroich. Die Fassade des Hauses hat durch die große gläserne Werbetafel einer Brauerei einen zusätzlichen Akzent erhalten. Wie dem Autor dokumentarisch bekannt ist, haben die Geschwister Wilhelmine, Maria und Johann (Toni) Scharrenbroich am 23. Oktober 1929 das Haus mit allen Nebengebäuden der katholischen Kirchengemeinde Birk verkauft. Die Gebäude unddas nebenstehende Veronikastift wurden Mitte bis Ende 1930 abgerissen. Das Foto bekundet somit den Abschied der Geschwister von ihrem Elternhaus.
| |
Albert Hehn war vom 1.7.1949 bis zum 1.10.1950 Lehrer an der Kath. Volksschule in Lohmar. Er war ein gutmütiger und liebenswürdiger Pädagoge. Leider ließ er sich schon nach einem guten Jahr nach Leuscheid versetzen. Auf dem Foto vom Herbst 1949 ist... Albert Hehn war vom 1.7.1949 bis zum 1.10.1950 Lehrer an der Kath. Volksschule in Lohmar. Er war ein gutmütiger und liebenswürdiger Pädagoge. Leider ließ er sich schon nach einem guten Jahr nach Leuscheid versetzen. Auf dem Foto vom Herbst 1949 ist Lehrer Hehn mit seinem 4. Schuljahr zu sehen: 1. Gisela Klug, verh. Steimel, 2. Betty Ramme, verh. Sprießersbach, 3. Gerda Müller, verh. Steudter, 4. Ellen Postertz, verh. Trompetter, 5. Adele Severin, verh. Passon, 6. Reni Höndgesberg, verh. Wiedemann, 7. Marieluise Eimermacher, 8. Helga Küpper, verh. Weingarten, 9. Anneliese Schmitz, verh. Lemmer, 10. Beate Contzen, verh. Ennenbach, 11. Erika Witte, 12. Karola Wetkamp, verh. Moldenhauer, 13. Elisabeth Kühnelt, verh. Kron, 14. Anni Schiele, 15. Brigitte Benderscheid, verh. Modemann, 16. Helga Harnisch, 17. Annemie Stenzel, 18. Inge Berghold, verh. Kurscheid, 19. Ingrid Rathmann, 20 Marlies Spürk, verh. Schubert, 21. Kathrin Boner, 22. Ingrid Lehmann, verh. Michael, 23. Edith Schönenborn, verh. Schmidt, 24. Margret Ramme, verh. Johannidis, 25. Bernhard Benderscheid, 26. Manfred Rösner, 27. Lehrer Albert Hehn, 28. Volker Fuhrmann, 29. Helmut Steimel, 30. Ferdi Gilgen, 31. Heinz Wering, 32. Hans Tomaschewski, 33. Horst Demmig, 34. Peter Ramme, 35. Walter Würtz, 36. Theo Bienentreu (Heimkind), 37. Heimkind, 38 Norbert Fischer, 39. Helmut Pape, 40. Alfred Kohnert, 41. Martin Jansen, 42. Eckehardt Penquitt, 43. ? Bürling, 44. Erich Schmitz, 45. Peter Kurtsiefer, 46. Bernd Kurscheid, 47. Willi Gerhards, 48. Heinz Müller (Mühlenweg), 49. Horst Ruhrmann, 50. Heinz Brands, 51. Klaus Schörk, 52. Peter Sterzenbach, 53. Paul Ramme und 54. Franz Josef Gschwind. | |
|
1926
Maria Maliglowska hatte schon einige Monate die vor ihrer Pensionierung erkrankte Lehrerin Maria Eschweiler vertreten, als sie am 1.12.1911 fest angestellt wurde und bis zum 1.3.1927 blieb, um dann an die Schule nach Sieglar zu wechseln. Etwa 1926... Maria Maliglowska hatte schon einige Monate die vor ihrer Pensionierung erkrankte Lehrerin Maria Eschweiler vertreten, als sie am 1.12.1911 fest angestellt wurde und bis zum 1.3.1927 blieb, um dann an die Schule nach Sieglar zu wechseln. Etwa 1926 ist die Lehrerin Maria Maliglowska in ihrem Klassenraum mit dem 1. und 2. Schuljahr fotografiert worden. 1. Lehrerin Maria Maglilowska, 2. Ludwig Hallberg, 3. Jakob Müller, 4. Bernd Arenz, 5. Hans Roland, 6. Heinz Keller, 7. Heinz Harnisch (hatte später einen Gehfehler), 8. Maria Bouserath, 9. Kathi Niethen, 10. Elisabeth Scheiderich, verh. Schopp, 11. Alfred Pape, 12. Erna Wagner, verh. Hartmann, 13. Kathi Scheiderich, verh. Overath, 14. Maria Wacker, verh. Schüller, 15. Kätti Altwickler, verh. Steinbrecher, 16. Kätti Scharrenbroich, verh. Frank, 17. Kätti Lüdenbach, 18. Heinz Müller, 19. Magdalene Fuchs (wohnte in der Fuchsfarm), 20. Änne Pohl, 21. Margarethe Rörig, 22. Käthi Müller (Schwester von Bernhard Walterscheid-Müller), 23. Rosemarie Runkel, verh. Fischer, 24. Elisabeth Keuler, 25. Anneliese ?, 26. Hilde Schwillens, 27. Gertrud Piller, verh. Kiel, 28. Margarethe Brodesser, 29. Helene Kath. Harnisch, 30. Luiese Kümmler, 31. Kätti Weingarten, verh. Steinbach, 32. Liesel Kümmler, verh. Bouserath, 33. Leni Zimmermann, verh. Haas, 34. Gertrud Höndgesberg, verh. Weber, 35. Maria Emmerich, verh. Eschbach, 36. Liesel Rottländer, verh. Pauli, 37. Margarethe Dunkel, verh. Burger, 38. Zissi ? (hat in der Burg gewohnt), 39. Christine Roland, 40. u. 41. unbekannt, 42. Lisbeth Specht, 43. ? Broicher, 44. Anni Becker, verh. Posten, 45. Erich Klein, 46. Peter Dunkel, 47. Josef Burger (Kuttenkaule, 1942 gefallen), 48. Paul Krauthäuser, 49. Peter Distelrath, 50. ? Appold, 51. Josef Becker, 52. Martin Pütz, Gartenstraße, 53. Stefan Fischer, 54. ? Keuler, 55. Hans? Arnold und 56. ? Arnold. | |
|
1948
Das Foto zeigt den Lohmarer Kinderchor 1948 mit Heinrich Schwellenbach und Chorleiter Thomas Kappes auf der Treppe am Südportal des Kölner Domes. Von links nach rechts und die Reihen von oben nach unten: Das Foto zeigt den Lohmarer Kinderchor 1948 mit Heinrich Schwellenbach und Chorleiter Thomas Kappes auf der Treppe am Südportal des Kölner Domes. Von links nach rechts und die Reihen von oben nach unten: | |
|
1967
- 1968 Auf dieser Postkarte von etwa 1967/68 ist der Eingang des Ortes Lohmar vom Hollenberg aus zu sehen. Rechts und links vom Verbindungsweg zur Fuchsfarm ist noch freies Feld – heute sind dort Kindergarten, Schul-und Sportzentrum im „Donrather Dreieck“.... Auf dieser Postkarte von etwa 1967/68 ist der Eingang des Ortes Lohmar vom Hollenberg aus zu sehen. Rechts und links vom Verbindungsweg zur Fuchsfarm ist noch freies Feld – heute sind dort Kindergarten, Schul-und Sportzentrum im „Donrather Dreieck“. Vorne links in dem Haus Hauptstraße 1 wohnte Polizeimeister Ernst Pack, dahinter ist der Jabachhof und direkt an der Straße das Fachwerkhaus Faßbender. Auf der anderen Seite der Hauptstraße sind die ersten Reihenhäuser der Parkstraße zu sehen, die von dem Bauträger Dipl.-Kfm. Günther Minninger Immobiliengesellschaft m.b.H. & Co gebaut wurden. | |
|
1850
- 1900 Das Bild zeigt Donrath vor 1900 vom Heppenberg aus gesehen. Im Vordergrund sieht man die Agger mit dem Dornheckenweg. Darüber ist die namenlose Dorfstraße (heute Donrather Straße). Zwischen Dornheckenweg und Dorfstraße links ist Büchel. Im Haus Nr. 1... Das Bild zeigt Donrath vor 1900 vom Heppenberg aus gesehen. Im Vordergrund sieht man die Agger mit dem Dornheckenweg. Darüber ist die namenlose Dorfstraße (heute Donrather Straße). Zwischen Dornheckenweg und Dorfstraße links ist Büchel. Im Haus Nr. 1 wohnte Heinrich Burger; Nr. 2 ist Haus Busch. Das große Haus mit dem weißen Giebel (Nr. 4) ist die Stellmacherei Schmitz. AntonSchmitz aus Geber, geb. am 21.6.1859 und gest. am 23.2.1948, kaufte dieses Haus 1886 von Anton Kreuzer und richtete sich darin eine Stellmacherei ein. 1929 übernahm sein Sohn Adolf (geb. am 20.9.1888) den Betrieb. Beide waren exzellente Handwerker, hatten beide den Meisterbrief und waren ehrlich, geachtet und geschätzt. 1942 brannten Werkstatt und Wohnhaus ab. Nun wurde eine größere Werkstatt gebaut, in der Adolf Schmitz noch bis in die 1970er Jahre arbeitete. Nach seinem Tode am 10.4.1979 ist der Betrieb aufgegeben worden. Adolfs Bruder Johann Josef Schmitz (geb. am 14.12.1889 und gest. am 18.12.1971) hatte 1927 in Lohmar in der Kirchstraße 10 eine Schlitten- und Stielfabrikation gegründet, die sein Sohn Willi aus Altersgründen Ende der 1980er Jahre aufgegeben hatte. (Quelle: W. Pape, LHBL Nr. 9, 1995, S. 53 ff). Rechts im Bild (Nr. 6) ist die Gaststätte „Altes Haus“, die von Joswin Kreuzer betrieben wurde, und darüber (Nr. 7) ist der Bahnhof, in dem zu dieser Zeit auch für Lohmar der Güterverkehr abgewickelt wurde. Ganz rechts das Fachwerkhaus (Nr. 9) ist die Hofanlage Böttner und davor (Nr. 8) das Donrather Spritzenhaus, in dem nach 1910 Fritz Weingarten eine Krautfabrik („Krockpaasch“) und eine Konservenfabrik eingerichtet hatte. Oben links im Bild (Nr. 3) ist ganz schwach Höhngen zu erkennen und darunter am Waldrand (Nr. 5) das Haus Pütz am heutigen Waldweg. | |
|
1900
Der Poststempel trägt das Datum 18.5.1910. Die Karte ist jedoch älter, wahrscheinlich Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Die fünfgeteilte Mehrbildkarte zeigt oben im Bild die Neuhonrather Kirche und die Dampflok, das Lohmarer Grietche zwischen... Der Poststempel trägt das Datum 18.5.1910. Die Karte ist jedoch älter, wahrscheinlich Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Die fünfgeteilte Mehrbildkarte zeigt oben im Bild die Neuhonrather Kirche und die Dampflok, das Lohmarer Grietche zwischen Kammerberg und Agger. Im mittleren Bildteil sehen wir die Gaststätte Naafshäuschen mit der offenen Kegelbahn. Im Gebäude links ist deutlich der Kuhstall zuerkennen, die heutige Bitschänke. Unten sieht man die Bachermühle aus der Blickrichtung Naafshäuschen. Bachermühle war ein Haltepunkt der Eisenbahn. Ein Bahnhofsgebäude gab es hier nicht. Erst um1940 wurde ein größeres Holzgebäude mit Gaststätte und Fahrkartenverkauf errichtet. Im Kreis unten die evangelischen Kirche Honrath aus dem 12. Jahrhundert und rechts unten Schloss La Valette. | |
|
1917
Die erste Karte trägt den Poststempel vom 23.8.1917 und ist als Feldpost gelaufen. Auf der anderen Postkarte findet sich ein Datum aus dem Anfang der 20er Jahre. Dort ist deutlich zuerkennen, dass die offene Kegelbahn noch zwischen der... Die erste Karte trägt den Poststempel vom 23.8.1917 und ist als Feldpost gelaufen. Auf der anderen Postkarte findet sich ein Datum aus dem Anfang der 20er Jahre. Dort ist deutlich zuerkennen, dass die offene Kegelbahn noch zwischen der Provinzialstraße und der Eisenbahn liegt. Nördlich derKegelbahn hatte man Sitzgelegenheiten geschaffen, so musste das Personal über die Straße gehen um die Gäste zu bedienen. Auf der Rückseite der Postkarte warb man mit: „Angenehmer Sommeraufenthalt, Fischerei, Kahnfahrt, Kegelbahn, Veranda, Großer Saal und Gesellschaftszimmer“. Meistens waren es Sommergäste aus Köln, die über den Bahnhof Honrathoder Bachermühle ins Aggertal kamen, um hier zu wandern und um in der damals ruhigen Idylle der Pension Naafs Häuschen einige vergnügte Tage zuverbringen. | |
So sah der Auelerhof, ein Gasthof mit Gartenwirtschaft und Pension um die Jahrhundertwende aus. Die Lithokarten wurden damals in Köln gedruckt. Der Gastwirt und Bäcker Karl Schiffbauer, geb. am 24.8.1845 im Auelerhof und am 22.1.1908 auch hier... So sah der Auelerhof, ein Gasthof mit Gartenwirtschaft und Pension um die Jahrhundertwende aus. Die Lithokarten wurden damals in Köln gedruckt. Der Gastwirt und Bäcker Karl Schiffbauer, geb. am 24.8.1845 im Auelerhof und am 22.1.1908 auch hier gestorben, war ein passionierter Jäger. Er konnte so seine Gäste, die mit der 1884 gerade in Betrieb genommenen Eisenbahn über die Station Wahlscheid das „Gasthaus zum Auelerhof“ besuchten, mit Reh- und Hasenbraten verwöhnen. Auch frische Forellen aus der Agger standen auf der Speisekarte. Der Auelerhof war nicht nur ein Mittelpunkt des geselligen, sondern auch des öffentlichen Lebens in der damaligen Bürgermeisterei Wahlscheid. Die Verwaltung residierte zwar noch bis 1923 in Münchhof, aber schon seit 1850 fanden die Sitzungen des Rates im zentraler gelegenen Auelerhof statt. Außerdem betrieb Karl Schiffbauer im Auelerhof eine Bäckerei, er führte die kaiserliche Postagentur mit öffentlichem Fernsprecher und er war der Geschäftsführer der Rheinischen-Provinzial-Feuersozietät in Wahlscheid. | |
|
1961
Auf dieser Karte aus dem Jahre 1961 sieht man die wunderschöne Lindenallee. Im Zuge des Ausbaues der B 484 in den 80er Jahren musste leider die Allee weichen. Auf der Bahntrasse wurde der Radweg angelegt und eine neue Lindenallee gepflanzt. Rechts... Auf dieser Karte aus dem Jahre 1961 sieht man die wunderschöne Lindenallee. Im Zuge des Ausbaues der B 484 in den 80er Jahren musste leider die Allee weichen. Auf der Bahntrasse wurde der Radweg angelegt und eine neue Lindenallee gepflanzt. Rechts vom Schloss kann man noch die zum Schloss gehörende Gärtnerei erkennen. Auf der großen Wiese in der linken Bildmitte sieht man das ehemalige Sägewerk Krebsauel. Auf der Wiese davor wurde 1970 das Schul- und Sportzentrum der Grundschule Wahlscheid gebaut. | |
Der Bauernhof Burger in Krebsauel – auf einem Foto aus der Mitte der 1920er Jahre – war ein Pachthof von Schloss Auel. Eine typische Hofanlage mit dem Haupthaus in der Mitte, den Nebengebäuden rechts und links und dem Misthaufen mitten im Hof. Die... Der Bauernhof Burger in Krebsauel – auf einem Foto aus der Mitte der 1920er Jahre – war ein Pachthof von Schloss Auel. Eine typische Hofanlage mit dem Haupthaus in der Mitte, den Nebengebäuden rechts und links und dem Misthaufen mitten im Hof. Die Rampe führt nach rechts in die Scheune. Krebsauel war ein Einzelhof und lag südwestlich von Neuhonrath auf einer Flussaue zwischen Agger und Maarbach. Heute erinnert die Krebsaueler Straße in Neuhonrath an diese Hofanlage, deren Haupthaus heute noch als Fachwerkhaus vorhanden ist. | |
Auf der linken Seite der Agger in Richtung Lohmar gesehen lag das Donrather Fährhaus (heute Donrather Straße 24), in dem auch die Post war. Hier hatte Wilhelm Klein, im Volksmund „de Fahrwellemsche“, einen Fährbetrieb eingerichtet, den er bis zum... Auf der linken Seite der Agger in Richtung Lohmar gesehen lag das Donrather Fährhaus (heute Donrather Straße 24), in dem auch die Post war. Hier hatte Wilhelm Klein, im Volksmund „de Fahrwellemsche“, einen Fährbetrieb eingerichtet, den er bis zum Bau der Brücke betrieben hatte. Ursprünglich war hier eine Furt, durch die auch von 1705 bis wahrscheinlich 1806 die pferdebespannte Postkutsche, mit Passagieren und Gütern beladen, auf der Strecke von Köln-Mühlheim nach Frankfurt fahren musste. Aus der Zeit vor dem Betrieb der Fähre und noch bevor Scheiderhöhe 1866 zur selbständigen Pfarre erhoben wurde erzählt man sich noch heute in Donrath eine Begebenheit: Ein Leichenzug zog vom Heppenberg zum Friedhof nach Lohmar. Den Sarg hatte man auf einen Handwagen geladen. Das Ufer der Furt auf der Sottenbacher Seite war etwas abschüssig. Da es geregnet hatte, entglitt den Wagenlenkern der Handwagen und dieser fuhr herrenlos in die Agger, kippte um und der Sarg trieb den Fluss hinunter. Nun mussten die Trauergäste im hüfttiefen Wasser den Sarg wieder einfangen und mit nasser Kleidung den Trauerzug fortsetzen. | |
|
1900
In den 1890er Jahren hatte Johann Weingarten aus Donrath in einem Nebengebäude seines um 1870 erbauten Bauernhofes (Donrather Str. 44) eine Krautfabrik („Krockpaasch“) eingerichtet, in der er Rüben- und Apfelkraut herstellte. Auf den Fotos, die... In den 1890er Jahren hatte Johann Weingarten aus Donrath in einem Nebengebäude seines um 1870 erbauten Bauernhofes (Donrather Str. 44) eine Krautfabrik („Krockpaasch“) eingerichtet, in der er Rüben- und Apfelkraut herstellte. Auf den Fotos, die zwischen 1895 und 1900 gemacht wurden, ist der Weingartenhof mit den Nebengebäuden zu sehen. Die „Krockpaasch“ war in dem quer verlaufenden Gebäude im Hinterhof. Rübenkraut ist der konzentrierte Saft von Zuckerrüben, ohne deren Pflanzenfasern und ohne Zusatzstoffe. Er ist gleichmäßig dunkelbraun, zähflüssig und entsteht durch Eindicken von Rübensaft, der aus den gekochten Rübenschnitzeln gepresst wird. Johann Weingarten war von Beruf Schreiner und betrieb auf seinem Hof auch eine kleine Schreinerei. Als er mit 65 Jahren am 21.2.1910 verstarb, kam zunächst die Krautproduktion zum Erliegen. Nach dem Tod der Ehefrau Ludmilla geb. Kreuzer am 17.2.1933 übernahm im Zuge der Erbauseinandersetzung ihr Sohn Johann den Hof mit der Krautfabrik. Wann die Fertigung wieder aufgenommen wurde, ist nicht bekannt, jedenfalls hat sein Schwager Theodor Knipp dort im Krieg und nach dem Krieg bis etwa Anfang der 1950er Jahre wieder Apfel- und Rübenkraut gekocht. Nach dem Tod von Johann Weingarten 1910 errichtete sein Sohn Fritz im alten Donrather Spritzenhaus (Ecke Donrather Str./Dornheckenweg) eine neue Kraut- und Konservenfabrik, die sich „Fabrik für die allgemeine Obstverwertung“ nannte. Fritz Weingarten stellte in seiner neuen Fabrik nicht nur Apfelkraut, Rübenkraut und Konserven her, sondern auch Obstwein, Likör und Schnäpse. Ob er den Wein selber kelterte, ist nicht bekannt. Er hatte auch keinen Alkohol gebrannt, sondern den zugekauften Kornbranntwein für die jeweiligen Schnäpse mit den entsprechenden Essenzen versetzt. Die Rohstoffe für seine Konservenproduktion hatte er teils aus eigenem Anbau und teils von den Bauern und Kleingärtnern aus der näheren Umgebung zugekauft. Einige Etiketten für seine Produkte sind noch erhalten. Leider verstarb Fritz Weingarten sehr früh mit 43 Jahren am 4.2.1929. Danach ist die Fabrik dann aufgegeben und
| |
|
1939
Die Amtsbürgermeisterei Lohmar warb 1939 für den Tourismus in Lohmar und Donrath mit einem Prospekt. Die Schutzgebühr betrug 5 Reichspfennig. Die Amtsbürgermeisterei Lohmar warb 1939 für den Tourismus in Lohmar und Donrath mit einem Prospekt. Die Schutzgebühr betrug 5 Reichspfennig. | |
|
2016
Auf dem Gelände des heutigen Edeka Marktes stand früher das Restaurant »Margarethenhof«. Das Gebäude wurde gegen Ende des 19. Jh. von der Familie Carl Knipp als Wohnhaus errichtet, für die damalige Zeit ein herrschaftliches Haus. Da Carl Knipp... Auf dem Gelände des heutigen Edeka Marktes stand früher das Restaurant »Margarethenhof«. Das Gebäude wurde gegen Ende des 19. Jh. von der Familie Carl Knipp als Wohnhaus errichtet, für die damalige Zeit ein herrschaftliches Haus. Da Carl Knipp Rendant der damaligen Bürgermeisterei Lohmar war, richtete er in seinem Haus die Lohmarer Gemeindekasse so lange ein, bis das »Alte Rathaus« an der Hauptstraße unter Bürgermeister Polstorff 1908 bezogen werden konnte. In den nächsten Jahrzehnten war es wieder reines Wohnhaus. Dies änderte sich erst, als das Gebäude wahrscheinlich durch Erbschaft der Margarethe Knipp (auch Eta genannt) zugesprochen wurde, die inzwischen Wilhelm Bendermacher geheiratet hatte. Nun entstand das Restaurant »Margarethenhof«. Als Gäste waren hier die Bewohner des Eisenbahner-Erholungsheimes (später Bergbau-Erholungsheim) in der Villa Therese bis in die ersten Nachkriegsjahre des Zweiten Weltkrieges sehr beliebt und willkommen. Danach betrieb eine Familie Molzner bis Mitte der 60er-Jahre die Gastwirtschaft. Während dieser Zeit errichtete die Familie Bendermacher über der Terrasse einen Anbau, in dem ein Blumengeschäft, dann die Drogerie Starke und schließlich für kurze Zeit die Kreissparkasse unterkamen. Danach pachtete Frau Maria Wölk die Gaststätte bis etwa Anfang der 70er-Jahre. 1974 übernahm Arthur Hoeck das Restaurant, das er »Zum Baumstamm « nannte. Wahrscheinlich aber florierte das Geschäft nicht gut, so dass Arthur Hoeck das Gebäude 1985 an die Wohn- und Gewerbebau Kallscheuer KG in Bonn - Bad Godesberg verkaufte, die 1986 nach Abriss des Restaurants ein Büro- und Geschäftshaus mit dem Plus-Markt errichtete. Später erwarb die Familie vom Manteuffel die Immobilie. Am 17 Juli 2014 eröffnete die Gebrüder Klein-Hessling als neue Eigentümer den Edeka-Markt.
| |
Die Schulchronik der katholischen Volksschule Ellhausen-Donrath 1899-1966 berichtet, dass im November 1890 das Aggertal eine große, im laufenden Jahrhundert in diesem Ausmaß einmalige Überschwemmung erlebte. Von Broich bis Lohmar stand außer dem... Die Schulchronik der katholischen Volksschule Ellhausen-Donrath 1899-1966 berichtet, dass im November 1890 das Aggertal eine große, im laufenden Jahrhundert in diesem Ausmaß einmalige Überschwemmung erlebte. Von Broich bis Lohmar stand außer dem Bahnschienenstrang die Straße vollständig unter Wasser. Der Überschwemmung folgte Anfang 1891 ein außergewöhnlicher Wintereinbruch. Der Schulpfad (Verbindungsweg Donrath – Ellhausen) war unpassierbar. Ähnliche Hochwässer an der Sieg, Agger und Sülz wiederholten sich in den Jahren 1890/91, 1907, 1926, 1940, 1956 und 1983 (bei dem Hochwasser am 4.11.1940 wurde die fünf-bogige Steinbrücke über die Agger zerstört). Auf den Bildern mit Blick vom Ziegenberg auf das Hochwasser an der Burg Lohmar und des zurückgehenden Hochwassers mit Kirche und Burg handelt es sich um das Hochwasser von 1926/1928. Im Jahre 1926 kam es nicht nur in Lohmar, sondern auch in anderen Orten an den Nebenflüssen des Rheins, der Sieg und der Agger, zu einer Hochwasserkatastrophe. Im Dezember 1926 wechselten Frost und Tauwetter ab. Teile des Rheins waren – wie auch 1928 wieder – wo der Rhein mit Autos befahrbar war – mit einer festen Schnee- und Eisdecke überzogen, die bei dem darauffolgenden Wechselwetter brach, staute und sich in einer solchen Menge häufte und so den normalen Lauf des Flusses hemmte, dass die Wassermassen wegen des versetzten Eises nicht abfließen konnten. Im Februar kamen starke Regengüsse dazu und die Wassermassen brachen los. Die Schäden waren so groß, dass die Obrigkeit eingreifen musste. | |
Staus auf unseren Autobahnen gab es auch bereits in früheren Zeiten. Hier fotografiert von der Lohmarer Autobahnbrücke in Richtung Siegburg. Links erkennt man das Bett des Auelsbaches, davor das heutige Gebiet der Firma ALDI. Hinter dem Auelsbach... Staus auf unseren Autobahnen gab es auch bereits in früheren Zeiten. Hier fotografiert von der Lohmarer Autobahnbrücke in Richtung Siegburg. Links erkennt man das Bett des Auelsbaches, davor das heutige Gebiet der Firma ALDI. Hinter dem Auelsbach die ehemaligen Äcker und Wiesen der Landwirte | |
|
1994
- 2016 Der „Aggersteg“ bei Schiffahrt muss nach 1847 zunächst als Fußgängerbrücke als Verbindung der Orte Wahlscheid mit dem Brückerhof, dem Ort Schiffahrt und den Einwohnern des Bergrückens von Kreuzhäuschen bzw. Muchensiefen, gebaut worden sein. Sie... Der „Aggersteg“ bei Schiffahrt muss nach 1847 zunächst als Fußgängerbrücke als Verbindung der Orte Wahlscheid mit dem Brückerhof, dem Ort Schiffahrt und den Einwohnern des Bergrückens von Kreuzhäuschen bzw. Muchensiefen, gebaut worden sein. Sie diente den Einwohnern von Schiffahrt und Brückerhof, die ausnahmslos evangelisch waren und bis Anfang der 1960er Jahre zur Gemeinde Scheiderhöhe gehörten, als Kirchweg. Vorher muss dort eine Furt gewesen sein und im Herbst und Winter setzte man mit einem Nachen über. Um die Brücke gab es im Jahr 1847 ein heftiges Gerangel. Der Gemeinderat in Wahlscheid lehnte einen Antrag der Bewohner von Schiffahrt und Brückerhof auf Errichtung einer Fußgängerbrücke, weil sie die evangelische Kirche in Wahlscheid erreichen müssten, ab. Als Begründung wies der Gemeinderat darauf hin, dass sie auf eigenen Wunsch hin 1835 dem Pfarrverband Wahlscheid einverleibt worden seien. Damals sei auch kein Übergang vorhanden gewesen. Es ist gut vorstellbar, dass der Inhaber des kleinen Fachwerkhäuschens unmittelbar an der Agger gelegen, einer namens Schiffbauer, außer dass er später das Brückengeld kassiert, früher auch die Fährmannsfunktion ausgeübt hat. Später, wahrscheinlich nach einer Beschädigung der Brücke durch Hochwasser, wurde sie zu einem befahrbaren Brückenweg umgebaut. Am 15. und 17. Februar 1956 kam der Schnellbrief der Bezirksregierung, des Oberkreisdirektors an die Gemeindeverwaltung Wahlscheid und Lohmar über erhöhte Hochwassergefahr bei Eintritt der Schneeschmelze und Regenniederschlägen mit plötzlich stark anschwellendem Hochwasser. So berichtete der Bürgermeister Schiffbauer am 1.3.1956 an den Oberkreisdirektor, dass die Holzbrücke über die Agger bei Schiffahrt infolge des Eisgangs erheblich beschädigt worden sei, so dass der Fahrverkehr hätte eingestellt werden müssen. Eine Ortsbesichtigung fand statt bei der folgende Schäden im Einzelnen festgestellt wurden. Ein Brückenjoch am linksseitigen Ufer war vollkommen weggerissen. Das rechtsseitige Brückenjoch wurde z.T. durch Eisgang zerstört, zum anderen Teil sei es morsch und ebenfalls unbrauchbar. Drei Eisbrecher seien abgerissen worden, ein noch stehender Eisbrecher sei beschädigt worden. Zur Instandsetzung des Bauwerks sei es notwendig, die im übrigen rd. 8.500,00 DM kosten sollte, neben den Pfahlstümpfen zwei neue Joche und einen weiteren Jochpfahl zu rammen, die Jochbalken zu erneuern und die Eisbrecher wieder zu errichten. Da die Brücke für die Bevölkerung – vor allem für zahlreiche Landwirte – sehr wichtig war, bat der Bürgermeister um bevorzugte Befürwortung. Die heutige Bogenbrücke wurde 2014 fertiggestellt, nachdem die alte Brücke im Mai 2012 wegen Einsturzgefahr für Fahrzeuge gesperrt werden musste. | |
|
1732
Der markante Punkt in Halberg ist die Kapelle. Diese wurde 1732 neben dem Thelenhof gebaut. Dabei wurde die Kapelle so platziert, dass man am Altar stehend durch die offene Tür den direkten Blick auf den Kölner Dom hat. 1931 wurde die Kapelle... Der markante Punkt in Halberg ist die Kapelle. Diese wurde 1732 neben dem Thelenhof gebaut. Dabei wurde die Kapelle so platziert, dass man am Altar stehend durch die offene Tür den direkten Blick auf den Kölner Dom hat. 1931 wurde die Kapelle erweitert und 1964 eine Sakristei angebaut. Von 1890 bis 1968 (solange es in Ellhausen einen Schulbetrieb gab) wurde immer freitags eine Schulmesse abgehalten. Ab 1911 wurde zusätzlich in der Kapelle eine Sonntagsmesse gehalten. Seit Oktober 2005 gibt es dort keine regelmäßigen Gottesdienste mehr. Der eigentliche Ort Halberg besteht seit altersher aus den drei Höfen Pastoratshof, Goswinhof und Thelenhof sowie einer später noch dazu gekommenen Kapelle. Die heutigen Stadtteile Halberg, Heppenberg, Donrath, Weegen, Ellhausen, Grimberg und Naaferberg bildeten bis 1969 eine eigene Gemeinde, die nach dem kleinsten Ort Halberg benannt war. Die Herkunft und Bedeutung des Namens Halberg ist noch nicht eindeutig geklärt. Eventuell könnte es „Heiliger Berg“ bedeuten. Halberg wird erstmals 1131 in einer Urkunde von Papst Innozenz II. als „Halreberg“ erwähnt. Pastoratshof In der vorgenannten Urkunde wird dem Cassiusstift der Pastoratshof bestätigt. Die Einkünfte daraus dienten dem Unterhalt des Pfarrers von Lohmar. 1979 wurde der Hof an seine heutigen Besitzer verkauft. Das Wohnhaus ist wahrscheinlich aus dem 18. Jahrhundert. Goswinhof Der Goswinhof (auch Henselershof genannt) war bereits vor 1549 im Besitz einer Siegburger Familie. Im Lauf der Jahrhunderte wechselten die Besitzer mehrfach, bis 1971 die Gebäude des Hofes durch Erbteilung einen neuen Besitzer fanden. Heute ist dort eine Pferdezucht untergebracht. Thelenhof Der Thelenhof (ab 1822 so genannt) wird auch Vogts-, Roden- oder Schultheißenhof genannt. Als erster Besitzer wird 1565 ein Rurich in der Warden als Eigentümer des Thelenhofes aufgeführt. Im Laufe der Geschichte hatte der Hof etliche Besitzer, bis er 2007 in den Besitz der Familie Penin überging. Historisch erwähnenswert ist zudem, dass Halberg von 1705 bis 1776 die erste Poststation einer Fahrpost zwischen Mühlheim am Rhein und Heidelberg war. Diese Fahrpost transportierte Personen und Güter, aber keine Briefe. Die Postwagen verkehrten dreimal wöchentlich. | |
|
1936
Bereits Mitte der 1930er Jahre baute Paul Zimmermann im „Unterdorf“ an der Hauptstraße ehemals Nr. 55 a einen Neubau, der etwas zurückversetzt von den übrigen Häusern errichtet wurde. Vor diesen Neubau erstellte er die erste Tankstelle in Lohmar.... Bereits Mitte der 1930er Jahre baute Paul Zimmermann im „Unterdorf“ an der Hauptstraße ehemals Nr. 55 a einen Neubau, der etwas zurückversetzt von den übrigen Häusern errichtet wurde. Vor diesen Neubau erstellte er die erste Tankstelle in Lohmar. Sogar eine Werkstatt für Reparaturen von PKW wurde angebaut. Bereits im Jahre 1946 hatte er mit Theodor Söntgerath einen Helfer. Er kam aus französischer Gefangenschaft und war froh, Arbeit zu finden. Ende der 1940er Jahre hatte Paul Zimmermann einen Bus und beförderte Personen zu Tagesausflügen ins nahe Umland, so zum Nürburgring. Auf der anderen Straßenseite stand die Scheune der ehemaligen Försterei von Lohmar, die im Jahre 1955 abgerissen wurde. Hier steht heute ein Wohnhaus. An der Stelle der Tankstelle hat heute die Firma Balkhausen GmbH Reifenhandel ihren Sitz, Hauptstraße 113- 115. | |
|
1503
Eichen war in früheren Zeiten ein Weiler in der Pfarrei Lohmar; heute ist Eichen ein Teil der kleinen Ortschaft Weegen. Der historische Weiler Eichen entspricht in etwa der Lage der heutigen Straßenbezeichnung Eichen und liegt im Südwesten Lohmars.... Eichen war in früheren Zeiten ein Weiler in der Pfarrei Lohmar; heute ist Eichen ein Teil der kleinen Ortschaft Weegen. Der historische Weiler Eichen entspricht in etwa der Lage der heutigen Straßenbezeichnung Eichen und liegt im Südwesten Lohmars. Umliegende Ortschaften und Weiler sind Donrath im Nordwesten und Norden, Weegen umgibt Eichen von Süden bis Nordwesten, Halberg liegt im Nordosten. Der Name Eichen wird sich wohl auf einen Eichenbestand zur Zeiten der Siedlungsgründung ableiten lassen. Der älteste Namensbeleg ist im Birker Bruderschaftsbuch aus der Zeit von 1503 bis 1538 zu finden. Dort wird unter den Mitgliedern ein "lutter (Ludwig) van eych" genannt. In der Zeit um 1644 / 1683 gab es historischen Quellen nach zwei Höfe in Eichen. Ebenso wurden 1750 nur zwei Familien als Bewohner aufgezeichnet. Im Jahr 1843 waren es drei Wohngebäude mit 20 Personen. Bereits 1862 wurde in Eichen eine Gastwirtschaft eingerichtet, mit der ein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb verbunden war. Diese Gaststätte wurde erst 1968 wegen Unrentabilität geschlossen. 1961 wurde Eichen an die Trinkwasserversorgung angeschlossen. Bis zu diesem Tag musste das Wasser aus dem gemeinde-eigenen Brunnen in Eichen geholt werden. Bei längeren Trockenperioden wurde dieser Brunnen sogar von den Bewohnern aus Weegen genutzt. Zudem gab es bis 1961 in Eichen einen Steinbackofen, der regelmäßig genutzt wurde. Bis 1969 gehörte Eichen zu der bis dahin eigenständigen Gemeinde Halberg. | |
Unterhalb von Weegen nach Donrath hin ist der Weiler Kuttenkaule mit sieben Wohnhäusern und dem Haus Hasselssiefen. Die beiden Wörter „Kutte“ und Kaule“, aus denen sich der Siedlungsname zusammensetzt, besagen eigentlich ein und dasselbe. Er bedeutet... Unterhalb von Weegen nach Donrath hin ist der Weiler Kuttenkaule mit sieben Wohnhäusern und dem Haus Hasselssiefen. Die beiden Wörter „Kutte“ und Kaule“, aus denen sich der Siedlungsname zusammensetzt, besagen eigentlich ein und dasselbe. Er bedeutet eine kleine Vertiefung in der Erde. Der Name Kuttenkaule wird erstmals 1538 im Mitgliederverzeichnis der Birker Marienbrudernschaft erwähnt. Dort wird ein „gontgyn up der kuttenkulen“ genannt. Anscheinend gab es auf der Kuttenkaule bis in die 1960er Jahre hinein nur zwei Wohnhäuser. Erst dann hat sich durch Neubauten ein Weiler der heutigen Größe ergeben. Kuttenkaule wurde erst 1961 an das Wassernetz der Gemeinde Lohmar angeschlossen. Bis dahin wurde das Wasser aus dem Ende der 50er Jahre gebauten Brunnen in die Häuser geleitet. Das Haus Hasselssiefen wurde Ende des 19. bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut und diente zunächst als Erholungsheim für kranke Priester, später als Waisenhaus. In dem Haus gab es eine Kapelle, die rund 50 Personen Platz bot. Bis 1954 in Donrath die Marienkirche fertiggestellt war, gingen viele Donrather nach Hasselssiefen zur heiligen Messe. | |
|
2012
- 2016 Der erste Sonntag nach Ostern, der Weiße Sonntag, wird erstmals im 17. Jahrhundert als Datum für die Erstkommunion erwähnt. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts gab es bischöfliche Anweisungen, diesen Termin zu wählen. Ein frühkirchlicher Brauch war es,... Der erste Sonntag nach Ostern, der Weiße Sonntag, wird erstmals im 17. Jahrhundert als Datum für die Erstkommunion erwähnt. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts gab es bischöfliche Anweisungen, diesen Termin zu wählen. Ein frühkirchlicher Brauch war es, kleinen Kindern schon direkt nach der Taufe ein paar Tropfen Wein zu geben. Damit hatten sie auch an der Eucharistie teilgenommen. Nach 1200 wurde das Alter nach und nach heraufgesetzt, bis viele Kinder im Alter zwischen zehn und vierzehn Jahren erstmals zur Kommunion gingen. 1910 setzte Papst Pius X. das Alter für Erstkommunion und Erstbeichte auf etwa sieben Jahre herab. In Deutschland gehen die meisten Kinder im dritten Schuljahr, also im Alter von etwa neun Jahren zur Erstkommunion. Wer später erst getauft wird, geht dabei in der Regel auch direkt zur Erstkommunion. Katholiken dürfen dann erstmals die gewandelte Hostie empfangen. Nach katholischer Auffassung ist Jesus nach der Wandlung real in den Zeichen von Brot und Wein präsent. Das Sakrament der Eucharistie geht nach kirchlicher Lehre auf Jesus zurück, der beim letzten Abendmahl am Gründonnerstag den Jüngern Brot und Wein reichte und die Worte sprach „Das ist mein Leib“ und „Das ist mein Blut“. Der Name „Weißer Sonntag“ leitet sich von den weißen Gewändern ab, die die Neugetauften in der Frühzeit des Christentums trugen. Sie sollten ein sichtbares Zeichen sein für die Reinigung durch das Taufwasser. Klassischer Tauftermin war Ostern. Ab dem siebten Jahrhundert trugen die erwachsenen Täuflinge die weißen Kleider die gesamte „Weiße Woche“ hindurch bis zum Weißen Sonntag. Bei der Erstkommunion sind heute dunkle Anzüge für die Jungen und weiße Kleider für die Mädchen verbreitet. Noch bis in die 1920er Jahre war es in Lohmar üblich, dass die Mädchen schwarze Kleider trugen, lediglich die Blumenkränzchen waren weiß. Viele katholische Kirchengemeinden feiern heute die Erstkommunion nicht mehr am Weißen Sonntag, häufig aus organisatorischen Gründen. Für 2021 hat die Katholische Kirche St. Johannes in Lohmar aufgrund der andauernden Einschränkungen durch die Corona Pandemie die Kommunionfeiern in den Juni verlegt. | |
|
Juni 1970
Die Naturfreunde Naaferberg e.V. gründeten sich im Juni 1970. Die Idee kam in einer Bierlaune, beim gemeinsamen Maibaum Aufstellen. Ziele des Vereins sind die Stärkung des Zusammenhalts unter den Dörfern, die Beteiligung an traditionellen... Die Naturfreunde Naaferberg e.V. gründeten sich im Juni 1970. Die Idee kam in einer Bierlaune, beim gemeinsamen Maibaum Aufstellen. Ziele des Vereins sind die Stärkung des Zusammenhalts unter den Dörfern, die Beteiligung an traditionellen Veranstaltungen sowie der Schutz und Erhalt der Natur. Von April bis Juni haben die Mitglieder rund um die Ortschaften Naaferberg, Ellhausen, Kreuzhäuschen, Grimberg und Geber viel zu tun: Ruhebänke werden gestrichen, die Pflege des Dorf- und Bolzplatzes steht an und der jährliche Umwelttag wird vorbereitet. Der Verein organisiert mehrere Müllsammel-Aktionen, bei denen sich die Stadt angeschlossen hat und die heute unter dem Namen „Lohmar fegt los“ bekannt sind. Auch die Verbesserung der vielen Wanderwege ist den Vereinsmitgliedern wichtig, damit die wunderschöne Landschaft sicher erkundet werden kann. Die Naturfreunde Naaferberg e.V. kümmern sich ebenfalls um den Schutz der heimischen Garten- und Wildvögel. So stellte der Verein rund 50 Nistkästen auf, die jährlich gepflegt werden. Neben dem Brutkasten, der in der Kapelle in Halberg angebracht wurde und wo seitdem regelmäßig kleine Schleiereulen schlüpfen, wurden 2017 sogenannte „Julen“ als Sitzgelegenheit für Greifvögel aufgestellt. Darunter versteht man etwa fünf Meter hohe Tannenstämme, die den Vögeln als Ansitz für die Jagd dienen. Zur Pflege der Dorfgemeinschaft finden regelmäßig Wandertage, Sommerfeste oder Spieleabende statt. Durch die vielen Aktivitäten des Vereins wurde der Zusammenhalt im Dorf und der Umgebung gefestigt und ausgebaut. Hierzu zählten unter anderem der Martinszug in Ellhausen sowie das Maibaumsetzen. Nachwuchssorgen hat der Verein nicht. Es finden sich fünf Generationen im aktiven Vereinsleben wieder und schon die Kleinsten beteiligen sich an den Aktionen. Aktuell zählt der Verein über 80 Mitglieder. Aufgrund der Corona-Pandemie sind das aktive Leben sowie die Aktionen des Vereins zurzeit auf das nötigste heruntergefahren bzw. begrenzt. Leider konnte so auch im vergangenen Jahr das 50jährige Jubiläum des Naturfreunde Naaferberg e.V. nicht gefeiert werden. Kontakt Naturfreunde Naaferberg e.V. Geschäftsführer: Philipp Sterzenbach Telefon: 0175 2267278 | |
Paul Schäfer, 1921 in Troisdorf geboren und nach dem Krieg Jugendpfleger der evangelischen Kirche, wurde 1949/50 entlassen, nachdem Vorwürfe wegen Kindesmissbrauchs laut wurden. Ein Prozess fand aber nicht statt. Schäfer zog als Prediger durchs Land.... Paul Schäfer, 1921 in Troisdorf geboren und nach dem Krieg Jugendpfleger der evangelischen Kirche, wurde 1949/50 entlassen, nachdem Vorwürfe wegen Kindesmissbrauchs laut wurden. Ein Prozess fand aber nicht statt. Schäfer zog als Prediger durchs Land. In Lohmar-Heide entstand 1958 das Gemeinschaftshaus und ein sogenanntes Jugendheim der von Schäfer gegründeten Sekte, der "Privaten Socialen Mission". Hinter den Mauern des angeblichen Waisenhauses begann eine Schreckensherrschaft. Die Sektenmitglieder mussten Schäfer intimste Details beichten, ihre familiären Bindungen aufgeben und wurden auch finanziell ausgebeutet.
(Nach Informationen von Christoph Kämper, www.pigasus.de und Gerd Albus) | |
Nachdem die letzten Nutzer, der "Generalarzt der Luftwaffe" , ihre Dienststelle im Jahr 2002 verlassen hatten, verkaufte die Bundeswehr das gesamte Areal für 1 Mio. Euro an ein Siegburger Bauunternehmen. Nach einigen Jahren Leerstand und einem Brand... Nachdem die letzten Nutzer, der "Generalarzt der Luftwaffe" , ihre Dienststelle im Jahr 2002 verlassen hatten, verkaufte die Bundeswehr das gesamte Areal für 1 Mio. Euro an ein Siegburger Bauunternehmen. Nach einigen Jahren Leerstand und einem Brand im Sommer 2007 wurde das Hauptgebäude von dem Architekturbüro Heinz Hennes sehr geschmackvoll und passend zur Umgebung umgestaltet, so dass von seiner Vergangenheit kaum noch etwas zu erkennen ist. Im hinteren Teil des Geländes entstanden freistehende Einzelhäuser. | |
|
1962
- 2002 Die Bundeswehr residierte insgesamt 33 Jahre in Heide - eine lange Zeit. 1961 kaufte die Bundeswehr das ca. 12.000 m² große Gelände mit den darauf befindlichen Gebäuden für 900.000 DM von dem Sektenführer Paul Schäfer. Der Kauf wurde über... Die Bundeswehr residierte insgesamt 33 Jahre in Heide - eine lange Zeit. 1961 kaufte die Bundeswehr das ca. 12.000 m² große Gelände mit den darauf befindlichen Gebäuden für 900.000 DM von dem Sektenführer Paul Schäfer. Der Kauf wurde über Mittelsmänner abgewickelt, da sich Paul Schäfer in einer Nacht- und Nebelaktion schon nach Chile abgesetzt hatte. Es lag ein Haftbefehl wegen Kindesmissbrauchs gegen Schäfer vor. (Mehr in der Dokumentation "In Heide gründete Paul Schäfer seine Schreckensherrschaft"). Im Februar 1962 bezog die 3. Kompanie des Wachbataillons die Liegenschaft. Stabsfeldwebel a.D. Günter Christiansen erinnert sich: "Vier Tage benötigten die Soldaten, um das alte Barackenlager in der Brückberg-Kaserne endgültig hinter sich zu lassen und in Heide eine neue, freundliche Unterkunft zu beziehen. Der Empfang durch die Bevölkerung war sehr herzlich, und die Soldaten sind überall gerne gesehen. Die Liegenschaft besteht aus einem Hauptgebäude, einem Bungalow und einem Schwedenhaus als Unterkunft, sowie einer Schirrmeisterei mit KFZ-Waschplatz in einer parkähnlichen Anlage. Im unteren Teil befinden sich Schleppdächer als Abstellplatz für die Dienstfahrzeuge. Zur Formalausbildung marschiert die Kompanie in den Wald. Ein etwa 400 m langer asphaltierter Waldweg ist der neue Exerzierplatz der Heide-Gardisten. Bei Vogelgezwitscher und gesunder Waldluft klappt der Griff besonders gut." Von 1973 bis 2002 hatte der "Generalarzt der Luftwaffe" seine Dienststelle auf dem Gelände. Wieder verkauft wurde das Gelände für 1 Mio. Euro an ein Siegburger Bauunternehmen. Nach einigen Jahren Leerstand und einem Brand im Sommer 2007 wurde das Hauptgebäude sehr geschmackvoll und passend zur Umgebung umgestaltet, so dass von seiner Vergangenheit kaum noch etwas zu erkennen ist. Im hinteren Teil des Geländes entstanden freistehende Einzelhäuser. | |
|
1966
Das Wachbataillon in Heide baut sich ein SchwimmbadLeben wie Gott in Frankreich Es ist nicht von der Hand zu weisen - die Soldaten der 3. Kompanie des Wachbataillons der Bundeswehr genießen in ihrer Außenstelle Heide eine angenehme Zeit. Abseits der Hauptstelle Siegburg-Brückberg leben sie hier in idyllischer Landschaft am... Es ist nicht von der Hand zu weisen - die Soldaten der 3. Kompanie des Wachbataillons der Bundeswehr genießen in ihrer Außenstelle Heide eine angenehme Zeit. Abseits der Hauptstelle Siegburg-Brückberg leben sie hier in idyllischer Landschaft am Waldesrand, mit parkähnlicher Anlage und Tennisplatz. Was jetzt nur noch fehlt ist ein adäquater Swimmingpool. Der Kompaniechef Hauptmann von Prondzynski nimmt die Sache selbst in die Hand. Er plant, leitet und organisiert die Bauarbeiten, um am Ende seinen Soldaten ein eigenes Schwimmbad zur Erholung in der Freizeit anbieten zu können. Da das Bauvorhaben nicht offiziell ist, müssen sowohl die Besorgung des Materials als auch die Bauarbeiten in Eigenleistung erfolgen. Sand gibt es in Heide genug, Wasser auch. Der Zement wird teilweise bei den Eigenheimbauten gekauft, die in Heide gerade wie Pilze aus dem Boden schießen. Nach und nach entsteht in der Mitte der Parkanlage ein wunderschönes Schwimmbad. Am 12. September 1966 findet die Einweihung statt. In voller Montur macht der Kompaniechef den schon legendären Kopfsprung in das neue 20-Meter-Schwimmbecken und trinkt dort ein Glas Sekt auf das Wohl seiner Kompanie. Auch seine beiden Kompanieoffiziere, die Oberleutnante Schwabe und Flohr, müssen den Sprung ins Wasser wagen, um mit dem Chef in der Mitte des Bades anzustoßen. | |
Das Heidehaus - ein stattliches, ca. 1910 gebautes, Herrenhaus stellte in dem dünn besiedelten, nur mit kleinen Fachwerkhäusern bebauten Heide bis zum Bauboom der 1960er Jahre eine Besonderheit dar. Das Heidehaus - ein stattliches, ca. 1910 gebautes, Herrenhaus stellte in dem dünn besiedelten, nur mit kleinen Fachwerkhäusern bebauten Heide bis zum Bauboom der 1960er Jahre eine Besonderheit dar. | |
Zum Männergesangverein Sangeslust Schachenauel liegen nur spärliche Informationen vor. Das Foto ist aus den 1930er Jahren. Aus den ersten Aufzeichnungen des MGV Eintracht Honrath aus dem Jahr 1912 geht hervor, dass am 30. Stiftungsfest am 5. Mai 1912... Zum Männergesangverein Sangeslust Schachenauel liegen nur spärliche Informationen vor. Das Foto ist aus den 1930er Jahren. Aus den ersten Aufzeichnungen des MGV Eintracht Honrath aus dem Jahr 1912 geht hervor, dass am 30. Stiftungsfest am 5. Mai 1912 auch der Männergesangverein Sangeslust Schachenauel teilgenommen hat. Das Foto vom Sportverein Bachermühle/Schachenauel ist aus dem Jahr 1924. Anfang der 1930er Jahre löste sich der Verein auf. Als Sportgelände diente zunächst ein vom Bauern des Hofes Krebsauel angepachtetes Gelände. Später wurde auf einer Kuhwiese zwischen Bergagger und Naafshäuschen gespielt. Der Sportplatz in Krebsauel - heutige Spielstätte des Wahlscheider Sportverein - wurde am 27. April 1975 eingeweiht. r | |
|
1912
- 1972 Die Amtsbezeichnung Presbyterium leitet sich vom griechischen Wort für „Älteste“ ab, da früher Leitungsaufgaben eher älteren und erfahreneren Menschen aus der Gemeinde übertragen wurden. Das Gremium leitet und verwaltet die Kirchengemeinde und wählt... Die Amtsbezeichnung Presbyterium leitet sich vom griechischen Wort für „Älteste“ ab, da früher Leitungsaufgaben eher älteren und erfahreneren Menschen aus der Gemeinde übertragen wurden. Das Gremium leitet und verwaltet die Kirchengemeinde und wählt zum Beispiel den Pfarrer oder die Pfarrerin. In der Zeit der Gegenreformation gewannen die Presbyterien eine besondere Bedeutung. Sie waren gezwungen, sich mit den Fragen des Gottesdienstes und der Lehre auseinanderzusetzen und gewannen dabei eine große Selbstständigkeit und Freiheit. In Wahlscheid war z. B. von 1628 bis 1645 die Kirche in der Verfügung des katholischen Messpriesters Friedrich Klee. Die Kirche blieb leer. Die Gemeinde sammelte sich in den Höfen und sorgte selbst für Prediger. In alten Protokollen des Honrather Presbyteriums findet man fast immer die gleichen Familiennamen: Frackenpohl, Lemmer, Lindenberg, Lohmar, Naaf, Schiffbauer, Voß, Wasser, Weber. Die Mitglieder dieser Familien haben in verschiedenen Ämtern der Gemeinde oft jahrzehntelang gedient. Sie sahen die Sache der Kirche als ihre eigene an. 1968 wurde mit Elisabeth Maier die erste Frau ins Presbyterium gewählt. Bereits 1964 hatte Pfr. Dahm (seit 1962 in Honrath) vorgeschlagen, erstmals auch Frauen in dieses Amt zu wählen. Auf der Vorschlagsliste standen dann auch zwei Frauen. Sie erhielten von der Gemeinde aber zu wenig Stimmen. Im Jahr 2021 gehören dem elfköpfigen Presbyterium sieben Frauen an, einschließlich der Pfarrerin (seit 1998) Barbara Brill Pflümer. In der evangelischen Kirche können auch Frauen ein Pfarramt übernehmen. Allerdings dauerte es bis 1975, dass die Landessynode der evangelischen Kirche im Rheinland die rechtliche Gleichstellung von Frauen und Männern im Pfarramt beschloss.
| |
Die Postkarte ist wahrscheinlich die bisher älteste Darstellung der Restauration „Zur Linde“ in Lohmar. Neben der Restauration ist noch die Waldesruh abgebildet. Beide Gebäude sind um 1890 errichtet worden. Die Lücke zwischen Waldesruh und... Die Postkarte ist wahrscheinlich die bisher älteste Darstellung der Restauration „Zur Linde“ in Lohmar. Neben der Restauration ist noch die Waldesruh abgebildet. Beide Gebäude sind um 1890 errichtet worden. Die Lücke zwischen Waldesruh und Restauration ist noch nicht geschlossen. Dort ist um 1910 ein großer Festsaal mit kleinem Sälchen angebaut worden. Der große Saal ist leider im Winter 1958/59 abgebrannt. Auf dem Anbau an die Restauration in der Kirchstraße ist die Aufschrift „Dampf-Kornbrannt-Brennerei“ zu lesen. Zu der damaligen Zeit hatten wir zwei Kornbrennereien im Ort Lohmar. Die eine war im Gut Jabach und wurde schon im Ersten Weltkrieg aufgegeben. Dort wurde der „Jobächer“ gebrannt. Die zweite Brennerei war die von Peter Josef Knipp, der – im Volksmund – „de Knepps Fusel“ herstellte. Da die Kornbrennerei schon im Einwohnerverzeichnis von 1900 genannt wird, kann man davon ausgehen, dass sie gleichzeitig mit der Restauration gebaut wurde. Peter Josef Knipp starb 1917 mit 82 Jahren. Sein Sohn Ludwig Knipp I, der 1916 mit 37 Jahren gefallen war, wird sicherlich schon vor dem Ersten Weltkrieg die Geschäfte seines Vaters übernommen haben. Seine verwitwete Ehefrau Gertrud heiratete 1917 den Vetter ihres gefallenen Mannes Ludwig Knipp II. Damit gingen Restauration und Brennerei auf diesen über. Eine Preisliste aus der ersten Hälfte der 1920er Jahre zeigt den Brennereikomplex mit der Restauration, die die Aufschrift trägt „Restauration u. Pension Ludwig Knipp“. Ferner zeigt die Preisliste, dass Ludwig Knipp nicht nur Kornbranntwein herstellte, sondern diesen noch mit verschiedenen Essenzen verfeinerte und auch Spirituosen zukaufte, um sein Angebot zu vergrößern. Die Brennerei Knipp war kein großer Betrieb. Sie hatte die Brennrechte nur für 1611 Liter reinen Alkohol. Wegen des stetigen Geldverfalls und die im Jahre 1923 stattgefundene große Inflation konnte auch Ludwig Knipp II die Brennerei nicht mehr halten und verkaufte seine Brennrechte im Januar 1925 an die „Bröltaler Kornbrennerei Mathieu Crumbach GmbH“ (später „Bröltal-Brennerei GMBH“ Martini in Bröleck, die 1997 aufgelöst wurde). Auch die Brenneinrichtungen verkaufte er binnen einen Jahres. | |
In den 1920er Jahren setzte die Motorisierungswelle in Wahlscheid ein. Sehr früh besaßen folgende Personen ein Auto: Friederich Wilhelm Blech, Auelerhof; Max Koch, Bürgermeister, Münchhof; Gustav Koser, Aggerhof; Walter Lemmer, Hermann Schönenberg,... In den 1920er Jahren setzte die Motorisierungswelle in Wahlscheid ein. Sehr früh besaßen folgende Personen ein Auto: Friederich Wilhelm Blech, Auelerhof; Max Koch, Bürgermeister, Münchhof; Gustav Koser, Aggerhof; Walter Lemmer, Hermann Schönenberg, Gebrüder Wilhelms und Dr. Zimmermann, alle Auelerhof. Die Automarken "Brennabor" und "Hanomag" waren bevorzugt. Die Schutzbleche und Trittbretter der Autos waren so stark, dass sich mehrere Personen darauf stellen oder setzen konnten. Es war ein seltenes Ereignis , wenn sich einmal zwei Autos begegneten. Trotzdem sollen in den 1930er Jahren zwei Autos der genannten Herren an der Goldenen Ecke (oberhalb Grünenborn) zusammengestoßen sein. Ebenfalls hielten Motorräder in Wahlscheid Einzug. Karl Oberdörster, beschäftigt bei Bäckermeister Otto Specht im Aggerhof, lieferte mit dem Motorrad Brötchen aus. Einer der ersten Eigentümer eines landwirtschaftlich genutzten Traktors, aus Schrottteilen aus der Wahner Heide zusammengebaut, war war Walter Zimmermann vom Haus Säemann. Einen "Lanzbulldog" fuhr Fritz Bräunsbach, Aggerhof. Der vollgummibereifte Traktor hatte eine Glühkopfzündung und wurde gewerblich im Mühlenbetrieb in der Mühle Kreuznaaf eingesetzt. Mit einer Glühlampe wurde er morgens vorgeglüht. Den Motor warf man seitlich mit dem herausnehmbaren Lenkrad an. Bei nicht genauer Handhabung lief der Motor rückwärts statt vorwärts. Bei der Aggerregulierung leistete er wertvolle Dienste zum Transport der Steine. Später wurde er an "ne Kirmeskäerl" (einen Kirmes-Karussellbesitzer) verkauft. | |
|
1930
Das Foto befindet sich im Archiv des HGV und zeigt einen Ausschnitt aus dem Karnevalstreiben der 1930er Jahre. Auffallend sind die vielen Schörreskarren (einrädrige Holzkarre). Es wird berichtet, dass es schon 1928 und nach dem Krieg Anfang der... Das Foto befindet sich im Archiv des HGV und zeigt einen Ausschnitt aus dem Karnevalstreiben der 1930er Jahre. Auffallend sind die vielen Schörreskarren (einrädrige Holzkarre). Es wird berichtet, dass es schon 1928 und nach dem Krieg Anfang der 1950er Jahre in Lohmar Schörreskarrenrennen gab: "Se rannten öve de Bachstroß on dann de Hauptstroß zerök". | |
|
1994
Der "Ley-Felsen" oberhalb von Schiffarth ist der Standort des Fotografen. Hier ließ eine Zeitlang am Pfingst-Samstag der Männerchor Wahlscheid seine Lieder ins Tal erschallen. Auf dem Foto 1930er Jahre ist ganz rechts der Müllenberg mit dem... Der "Ley-Felsen" oberhalb von Schiffarth ist der Standort des Fotografen. Hier ließ eine Zeitlang am Pfingst-Samstag der Männerchor Wahlscheid seine Lieder ins Tal erschallen. Auf dem Foto 1930er Jahre ist ganz rechts der Müllenberg mit dem "Jüddenbönnchen" (Judenbrunnen, hier soll ein Jude getauft worden sein) zu seinen Füßen erkennbar. Majestätisch rechts auf der Anhöhe steht die St. Bartholomäuskirche. 1817 wurde das Kirchenlanghaus (bis dahin eine kleine romanische Gewölbekirche) und 1870 der Kirchturm erneuert. An den Müllenberg - oder Breede Bärech - schließt sich in Richtung Kirchbach der "Wahlscheider Berg" an. Neben dem Bahnhofsgebäude (Bildrand Mitte links) befand sich rechts die Toilettenanlage. Auf der anderen Seite der Bahngleise ist der Garten des Bahnhofsvorstehers erkennbar. Das "Päddchen" (kleiner Weg) schräg am Bahndamm führte zum Garten. | |
|
1955
- 2021 Das Haus Waldeck wurde um 1906 von der Familie Ramme gebaut. Es befindet sich am Ende der Pützerau in Lohmar Süd und gehört heute zur dortigen Reitstall-Anlage. In den 1950er Jahren war Hermann Stoecker Eigentümer dieser Keimzelle des heutigen... Das Haus Waldeck wurde um 1906 von der Familie Ramme gebaut. Es befindet sich am Ende der Pützerau in Lohmar Süd und gehört heute zur dortigen Reitstall-Anlage. In den 1950er Jahren war Hermann Stoecker Eigentümer dieser Keimzelle des heutigen Reitstalls Waldeck. Er hatte dort zwei Pferde. Der eigentliche "Reitstall" wurde um 1970 von der Familie Wökener gegründet und 2005 von den Brüdern Sven Hofmann und Rainer Herzberg in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand erworben. Widerstände aus der Nachbarschaft gab es 2006 gegen den Bau von zwei Einfamilienhäusern für die neuen Eigentümer und Betreiber des Reitstalls. Letzlich wurden die Baugenehmigungen erteilt. Der Reiterhof sollte erhalten bleiben. 2020 wurden Interessen bekannt, die Flächen der Reitanlage in Bauflächen umzuwandeln. | |
|
1930
- 1939 Auf einer Landkarte für die Bürgermeisterei Wahlscheid aus dem Jahre 1900 ist der Ortsteil Kreuznaaf, wo die Firma Fischer ihren Betriebssitz hat, mit „Pfannschuppen“ (Platt: „Panneschopp“) bezeichnet. Die Bezeichnung Pfann(en)schuppen resultiert aus... Auf einer Landkarte für die Bürgermeisterei Wahlscheid aus dem Jahre 1900 ist der Ortsteil Kreuznaaf, wo die Firma Fischer ihren Betriebssitz hat, mit „Pfannschuppen“ (Platt: „Panneschopp“) bezeichnet. Die Bezeichnung Pfann(en)schuppen resultiert aus der Tatsache, daß hier an dieser Stelle Dachziegel und Bausteine gebrannt wurden. Da es viele Familien Fischer in Wahlscheid gab, nannte man Otto Fischer, den damaligen Betriebsinhaber, und seinen Sohn Erhard „de Pannemann“. Vor Otto Fischer war Jakob Lapp bis 1926 Inhaber des erstmals im Jahre 1875 erwähnten Betriebes. Man stellte Hohlpfannen, die man heute noch auf alten Scheunendächem sieht, her. Den Ton karrte man aus dem heute bebauten Feuchtgebiet Donrath-Broich heran. Als die Qualität des Tones schlechter wurde, stellte man Drainagerohre her. Bis Anfang der 30er Jahre setzte ein von einem Pferd gezogener Göpel die Presse in Bewegung. Inzwischen ist der Betrieb, dessen äußeres Kennzeichen ein hoher Schornstein war, abgebrochen .Mitte des 19. Jahrhunderts gab es auch im Ortsteil Agger einen „Panneschopp. | |
|
1920
- 1929 Mit der Jick fuhr der „Bröcker Wellern“ Milch aus; er versorgte die Wahlscheider Haushalte. Im Auelerhof machte er gewöhnlich halt, trank sich einen Schnaps und kartete. Es sollen auch schon einmal so viele „Kurze“ gewesen sein, daß das Pferd allein... Mit der Jick fuhr der „Bröcker Wellern“ Milch aus; er versorgte die Wahlscheider Haushalte. Im Auelerhof machte er gewöhnlich halt, trank sich einen Schnaps und kartete. Es sollen auch schon einmal so viele „Kurze“ gewesen sein, daß das Pferd allein nach Hause gegangen war. Das Bild zeigt, daß Wilhelm offenbar wieder einmal im Auelerhof eingekehrt war, denn die Mannschaft aus der Gaststätte Auelerhof hatte sich seiner Jick bemächtigt. Die Kunden jenseits der Agger mußten, wie Hilde Theis geb. Wilhelms berichtete, meist sehr lange warten. Mitunter wurden sie gar nicht beliefert; der Schimmel kam aber auch schon einmal alleine ohne Kutscher.
| |
|
1934
Hugo Reißberg, Höffen, holte mit seinem LKW die auf den „Milchböcken“ in den Weilern stehenden Milchkannen ab. Nur wenige Bauern brachten früher zeitweise morgens ihre Milchkannen zum 7.00 Uhr-Zug (Richtung Siegburg). Die Molkerei Schrettenholz in... Hugo Reißberg, Höffen, holte mit seinem LKW die auf den „Milchböcken“ in den Weilern stehenden Milchkannen ab. Nur wenige Bauern brachten früher zeitweise morgens ihre Milchkannen zum 7.00 Uhr-Zug (Richtung Siegburg). Die Molkerei Schrettenholz in Siegburg zahlte damals 4 Pf pro Liter mehr für die Milch. Wenn Hugo Reißberg die vollen Milchkannen abholte, brachte er die geleerten Kannen des Vortages zurück. In einer Kanne befand sich die sogenannte Magermilch, mit der die Molkerei nichts anfangen konnte. Mit ihr fütterten die Bauern die Schweine und Kälber. Eine Zeitlang brachten die Bauern die Milch zu einer Sammelstelle in den „Jrongk“. In einem kleinen, im Fließengarten stehenden Haus, das bei der Explosion des Munitionszuges am 15. Februar 1945 total beschädigt wurde, hatte die Molkerei Hockerts aus Köln diese Sammelstelle eingerichtet. | |
Auf dem Bild sieht man zwei durch eine Achse bereits verbundene Karrenräder. Die Herstellung dieser Karrenräder nahm die meiste Zeit des Stellmachers (auch „Äesse“ = Achsenmacher genannt) in Anspruch. Nach Angaben von Otto Hohn, Brückerhof,... Auf dem Bild sieht man zwei durch eine Achse bereits verbundene Karrenräder. Die Herstellung dieser Karrenräder nahm die meiste Zeit des Stellmachers (auch „Äesse“ = Achsenmacher genannt) in Anspruch. Nach Angaben von Otto Hohn, Brückerhof, verarbeitete der Stellmacher nur Holz, das mindestens 6 Jahre getrocknet hatte. „Schläge“ im Karrenrad vermied er, indem er das Rad probelaufen ließ und sich bei Korrekturen auf sein Gehör verließ.
| |
Das vom Kirchbach in Bewegung gesetzte Wasserrad trieb in der Schlosserei über Treibriemen einige Maschinen an. Hindrich Klein hatte sich nach Angaben von Emst Kürten, früher wohnhaft in Kirchbach, auf die Herstellung von „Kiemeschwängele“ (Kurbel... Das vom Kirchbach in Bewegung gesetzte Wasserrad trieb in der Schlosserei über Treibriemen einige Maschinen an. Hindrich Klein hatte sich nach Angaben von Emst Kürten, früher wohnhaft in Kirchbach, auf die Herstellung von „Kiemeschwängele“ (Kurbel für ein Butterfaß) spezialisiert. Hauptabsatzgebiet war die Lüneburger Heide. Ferner beschäftigte sich Hindrich mit dem „Scharfmachen“ von Bohrern des in der Nähe befindlichen Bergwerks „Grube Pilot“. Die Ziegelsteine der Häuser sollen aus der abgebrochenen Grube Pilot stammen. | |
|
1932
Die Anzahl der Bäcker in der Bürgermeisterei Wahlscheid war früher nicht groß. Die hiesige weitgehend landwirtschaftlich orientierte Bevölkerung backte für sich und Nachbarn im eigenen „Backes“ (Backhaus) selbst. Hugo Schiffbauer, ein Schwager von... Die Anzahl der Bäcker in der Bürgermeisterei Wahlscheid war früher nicht groß. Die hiesige weitgehend landwirtschaftlich orientierte Bevölkerung backte für sich und Nachbarn im eigenen „Backes“ (Backhaus) selbst. Hugo Schiffbauer, ein Schwager von Otto Specht, fuhr mit dem Wagen Brot über Land. Er erzählte, daß der Wagen mit ca. 50 bis 70 Stück Schwarzbrot, Graubrot und Blatz beladen wurde. Die Fahrt mit dem Brotwagen war mitunter gefährlich; vor allem bei Eis und Schnee. Einige Male war Hugo mit dem Gefährt umgeschlagen. Bei Eis drehte er dem Pferd tagsüber Stollen in die Hufeisen. Anfang der 30er Jahre wurde noch – wie der Inschrift auf dem Wagen zu entnehmen ist – mit „elektrischem Betrieb“ geworben. Die Wahlscheider Kinder setzten sich gern – vom Kutscher unbemerkt – hinten auf das Trittbrett. | |
|
1913
Die Industriellen gaben den Fabriken damals gern das Aussehen von Ritterburgen. Im Bildvordergrund ist das Bahngleis der Strecke Overath-Siegburg zu sehen. Dahinter liegt das Nebengleis als Bahnanschluß der Aggerhütte; es endete – was auf dem Bild... Die Industriellen gaben den Fabriken damals gern das Aussehen von Ritterburgen. Im Bildvordergrund ist das Bahngleis der Strecke Overath-Siegburg zu sehen. Dahinter liegt das Nebengleis als Bahnanschluß der Aggerhütte; es endete – was auf dem Bild nicht mehr zu sehen ist – auf einer Drehscheibe. Hier konnten die Eisenbahnwaggons gedreht und anschließend mit Muskelkraft von den Arbeitern zum Fabrikgebäude geschoben werden. Das zum Gebäude führende Gleis ist links zu sehen. Neben dem Gleis sieht man einen ausrangierten Eisenbahnwaggon. Auf dem Fabrikgebäude lesen wir die Aufschrift „Extractionswerke Aggerhütte GmbH“. Der Betrieb kochte Tierknochen zur Herstellung von Seife und Öl aus. Entstehung der Aggerhütte | |
Schreinermeister und Kegelbahnbauer Hermann Schönenberg 1928 im Auelerhof mit seiner Mannschaft. Personen von links: sitzend: 1. Walter Schiffbauer, Auelerhof 2. Willi Schönenberg, Auelerhof stehend: 1. Johann Altenrath, Neuhonrath 2. Else... Schreinermeister und Kegelbahnbauer Hermann Schönenberg 1928 im Auelerhof mit seiner Mannschaft. Personen von links: sitzend: 1. Walter Schiffbauer, Auelerhof 2. Willi Schönenberg, Auelerhof stehend: 1. Johann Altenrath, Neuhonrath 2. Else Schönenberg, Auelerhof 3. Karl Fischer, Emmersbach 4. Karl Zimmermann, Troisdorf 5. Hermann Schönenberg, Auelerhof 6. Frau Hermann Schönenberg 7.Daniel Schönenberg (Vater von 5.) 8. Hugo Kürten, Kern 9. Otto Naaf, Aggerhof | |
Gustav „schörcht“ (fahren mit der Karre) den Mist aus dem Stall mit der „Schörreskaar“ auf den „Meßhoov“ (Misthaufen). Die „Schörreskaare“ dienten früher nicht nur zum Transport von Mist, Säcken, Schanzen, Gras, Heu, Körben, Kisten usw. Mit ihr... Gustav „schörcht“ (fahren mit der Karre) den Mist aus dem Stall mit der „Schörreskaar“ auf den „Meßhoov“ (Misthaufen). Die „Schörreskaare“ dienten früher nicht nur zum Transport von Mist, Säcken, Schanzen, Gras, Heu, Körben, Kisten usw. Mit ihr wurden auch die Betrunkenen über die holprigen Dorfstraßen nach Hause „jeschürcht“. Bei schweren Lasten legte man sich einen breiten Lederriemen, der an den Griffen befestigt wurde, über die Schultern. | |
Alte Archivunterlagen sprechen von 2 Nagelfabriken in Wahlscheid. Davon sehen wir die eine in Mackenbach stehende im Bild. Man denkt eher an eine „Kruffes Hött“ (kleine Hütte), zumal sich im rechten Teil ein „Backes“ (Backhaus) befand. Inzwischen... Alte Archivunterlagen sprechen von 2 Nagelfabriken in Wahlscheid. Davon sehen wir die eine in Mackenbach stehende im Bild. Man denkt eher an eine „Kruffes Hött“ (kleine Hütte), zumal sich im rechten Teil ein „Backes“ (Backhaus) befand. Inzwischen wurde die Nagelschmiede, die „Näel- schmett’s Justav“ (Gustav Lindenberg) betrieb, abgebrochen. Ernst Kürten, heute wohnhaft in Münchhof, erzählte, daß sein Urgroßvater im Aggerhof (heutiges Haus Münchhofer Straße 3) eine Nagelschmiede unterhielt. Er lieferte Nägel zum Kölner Hafen. Bei dem Bau der Schiffe wurden nur geschmiedete Nägel verwandt.
| |
|
1930
- 1939 Auf dem Bild erkennen wir links Karl Wilhelms. Auf dem 2. Auto von links sitzend: unten: Waldemar Frackenpohl, Auelerhof; oben: Paul Kurtenbach, Grünenborn; an der Seite: Max Wasser In den 20er Jahren hielt das Auto auch in Wahlscheid seinen Einzug... Auf dem Bild erkennen wir links Karl Wilhelms. Auf dem 2. Auto von links sitzend: unten: Waldemar Frackenpohl, Auelerhof; oben: Paul Kurtenbach, Grünenborn; an der Seite: Max Wasser In den 20er Jahren hielt das Auto auch in Wahlscheid seinen Einzug und löste die „Jick“ sowie die Kutsche ab. Die Fuhrleute hielten früher mit ihren Pferdefuhrwerken an bestimmten Gaststätten -so auch am Naafshäuschen- an, um ihren Pferden Wasser und Hafer zu geben. Als das 1. Auto am Naafshäuschen anhielt, soll Gastwirt Naaf gewohnheitsmäßig mit einem Eimer Wasser herbeigeeilt sein.
| |
Emst Hohn, Aggerhof, kann sich erinnern, daß die Fässer vom Bahnhof zum Aggerhof gerollt wurden. Ein Faß war undicht und „ne Kürten Jong“ fing den wertvollen Wein mit einer Tasse auf. Peter Wester, Gastwirt im Aggerhof, füllte mit anderen... Emst Hohn, Aggerhof, kann sich erinnern, daß die Fässer vom Bahnhof zum Aggerhof gerollt wurden. Ein Faß war undicht und „ne Kürten Jong“ fing den wertvollen Wein mit einer Tasse auf. Peter Wester, Gastwirt im Aggerhof, füllte mit anderen Wahlscheider Gastwirten den Faßwein in Flaschen um. Karl Schiffbauer, späterer Wirt im Auelerhof, spülte im Hinterhof in einer Zinkbadewanne die Weinflaschen. Personen: jeweils von links: unten sitzend: 1. Otto Bergfelder, Röttgen (?) 2. Karl Schiffbauer, Gastwirt, Auelerhof 3. Kurt Schaub, Auelerhof, 4.Hermann Schiffbauer (“Dreckes Hermann“), Aggerhof stehend: 1. Wilhelm Schönenberg, Bahnhofsgastwirt, Aggerhof 2. am Baumstamm hängend: Max Weber, Auelerhof 3. Otto Kürten 4. Leo Müller, Gastwirt in Overath 5. Hermann Schiffbauer, Gastwirt, Auelerhof 6. im Hintergrund: Emst Kürten, Kirchbach 7. Kind: Tochter Erna von 6. 8. vorne mit Hut: Wilhelm Kaufmann, Atzemich 9. ganz hinten mit Kopf: Peter Wester, Aggerhof 10. Wilhelm Zimmermann, Katharinenbach 11. Heinrich Schiffbauer, Aggerhof 12. Karl Oberdörster, Auelerhof 13. Karl Lindenberg, Müllerhof 14. Olga Meyer geb. Schiffbauer, Auelerhof 15. Ida Becker geb. Wester, Aggerhof 16. Otto Hohn, Aggerhof 17. Kind: Emst Hohn, Aggerhof 18. hinten mit Hut: Walter Klein, Kirchbach 19. auf dem Faß: Franz Heimes, Lehrer, Siegburg 20. Kind hinten: Franz Hagen, Aggerhof 21. Gustav Hohn, Aggerhof, 22. Kind: Heinrich Hagen, Aggerhof 1910 war die Brennerei mit dem hohen Schornstein gebaut worden. Im 1. Weltkrieg mußte der Betrieb im Aggerhof aufgegeben werden, da der wertvolle kupferne Brennkessel auf höchsten Befehl für die Herstellung von Kriegsmunition einzuschmelzen war. Im Obergeschoß befand sich eine Schrot-Mühle mit 2 Mühlsteinen zum Einmaischen des Roggens. Der Staat belegte die Schnapsherstellung auch damals mit einer hohen Steuer. Die Zollbeamten aus Siegburg kamen zu Pferd nach Wahlscheid und kontrollierten die Einhaltung der Vorschriften. Mit der Maische, dem Abfallprodukt bei der Schnapsherstellung, fütterten die Landwirte gern ihre Kühe. Der Zoll bestand darauf, daß nur die eigenen Kühe gefüttert werden durften. Daher hielt die Familie Wester im Aggerhof damals 2-3 Kühe. Man durfte sich „landwirtschaftliche Brennerei“ nennen. 1924 wurde der Schornstein des Brennes abgebrochen. Im Jahre 1925 eröffneten die Eheleute Koser in der ehemaligen Brennerei ein Kolonialwarengeschäft. Nachdem die Eheleute Koser im Jahre 1928 gegenüber neu gebaut hatten, zog Schuhmachermeister Julius Lichtenberg in den Brennes. | |
Die Lohmarer Teiche sind nicht nur ein attraktives Erholungsgebiet für Wanderer und zunehmend auch Radfahrer, sondern auch eine über 1000 jährige wertvolle Kultur- und Naturlandschaft, die ursprünglich zusammen mit dem Siegburger Stadtgebiet über 170... Die Lohmarer Teiche sind nicht nur ein attraktives Erholungsgebiet für Wanderer und zunehmend auch Radfahrer, sondern auch eine über 1000 jährige wertvolle Kultur- und Naturlandschaft, die ursprünglich zusammen mit dem Siegburger Stadtgebiet über 170 Teiche und offene Moorlandschaften umfasste. Seit Jahren versuchen die Staatsfortverwaltung, Bündnis Heideterasse e. V. und ehrenamtliche Kräfte, Bereiche zu revitalisieren. Entwässerungsgräben werden geschlossen und Baum- und Strauchwerk beseitigt, um wieder offene Moorlandschaften mit Torfmoosen, Gagelstrauch, Sonnentau u. a. entstehen zu lassen. Moore sind effektive Kohlenstoffspeicher und in Zeiten des Klimawandels umso wertvoller. Auch wenn es zurzeit noch kleinere Flächen sind, stellen sich schon sichtbare Erfolge ein, die in den Fotos von Nov. 2020 festgehalten sind. Vor etwa 2 Jahren gelang der Wiederfund von Wacholder (einst Hektar-bedeckende Wacholderheiden). Viele Gräben müssen noch geschlossen werden, viel störender Aufwuchs beseitigt werden. Manches sollte auch - wie 1.000 Jahre üblich - wieder beweidet und geplaggt (Boden abstechen) werden.
| |
|
1994
- 2020 In den ersten drei Jahrhunderten kannte die Christenheit außer Ostern keine Jahresfeste. Erst ab dem vierten Jahrhundert wurde dem Weihnachtsfest eine eigene Vorbereitungszeit vorangestellt. Der Ankunft (adventus) des Herrn - Geburt Christi - ging... In den ersten drei Jahrhunderten kannte die Christenheit außer Ostern keine Jahresfeste. Erst ab dem vierten Jahrhundert wurde dem Weihnachtsfest eine eigene Vorbereitungszeit vorangestellt. Der Ankunft (adventus) des Herrn - Geburt Christi - ging ähnlich dem Osterfest eine 40 tägige Fastenzeit voraus, in der dreimal wöchentlich gefastet wurde. In der Westkirche wurde ab dem 11. Jahrhundert dieser Zeitraum auf die noch heute übliche vierwöchige Adventszeit verkürzt. Die orthodoxen Kirchen begehen bis heute noch den Advent sechs Wochen. Seit 1917 wird von der katholischen Kirche das Adventsfasten nicht mehr verlangt. Die Bräuche des Adventskranzes und des Adventskalenders sind noch relativ jung. Um 1850 hören wir zum ersten Mal davon, Lichter auf einem Kranz anzustecken. Der erste gedruckte Weihnachtkalender 1908 stand noch in der Tradition der Ausschneidebögen: Jeden Tag galt es, aus dem Bogen ein Bildchen auszuschneiden und auf das dafür vorgesehene Feld zu kleben. Die Kalender waren sehr beliebt, um den Kindern die Wartezeit auf das Weihnachtsfest zu verkürzen. Heute haben die Adventskalender 24 Türchen zum öffnen. Seit einigen Jahren gibt der 2009 gegründete Lions Club Lohmar schön gestaltete Adventskalender heraus. Sie können gegen eine Spende von 5 € für einen guten Zweck erworben werden. Hinter den einzelnen Türchen stecken Gewinnlose.
| |
Die „lange Wiese“ zwischen Müllerhof und Kirchbach machten die Jugendlichen im Winter zur Eisbahn, indem sie den Kirchbach anzapften und das Bachwasser in die große Wiese laufen ließen, so daß sich hier eine große Eisfläche bilden konnte.... Die „lange Wiese“ zwischen Müllerhof und Kirchbach machten die Jugendlichen im Winter zur Eisbahn, indem sie den Kirchbach anzapften und das Bachwasser in die große Wiese laufen ließen, so daß sich hier eine große Eisfläche bilden konnte. Wahlscheid’s Jugend betrieb hier Eissport; sogar von Seelscheid strömte man herbei. Viele neue Schlittschuhe wurden gekauft und unter die Schuhe geschraubt. Nach einiger Zeit hingen meistens -wie Edith Wasser geb. Lindenberg, Aggerhof, berichtete – Sohle oder Absatz mit Schlittschuh lose herunter. Max Fischer, Haus Dorp erinnerte sich: Lehrer Ackermann bat im Winter 1914 ihn und weitere Schüler zu prüfen, ob die Eisdicke auf der „langen Wiese“ ausreichend sei. Lehrer Ackermann ging anschließend mit der gesamten Klasse auf das Eis.
| |
|
1900
- 2012 Broich und Büchel. Wer kennt sie noch? Es sind ehemalige Ortsteile von Donrath. Broich und Büchel. Wer kennt sie noch? Es sind ehemalige Ortsteile von Donrath. Broich wird erstmals 1503 im Birker Bruderschaftsbuch erwähnt. Der Name bedeutet soviel wie Sumpf- oder Moorland und bezeichnet eine alte Siedlungsstelle, die trockengelegt wurde.1644 bestand Broich bereits aus vier Hofanlagen. 1872 wohnten dort 40 Personen in acht Häusern. Montanus schreibt in seinem Buch „Die Helden“, dass am 11.11.1795 mehrere Scharen französischer Soldaten, „die im Aggerthale streiften und plünderten, von den Bauern zu Seelscheid, Neunkirchen und Lohmar angegriffen und mit Verlust mehrerer Todten in die Flucht geschlagen wurden. Dafür rächten sich die Freiheitsbringer mit Mordbrand und legten u.a. zu Broich in Lohmar vier Scheunen und fünf Wohnhäuser in Asche … und erschossen mehrere Landleute, die an jenen Raufereien nicht einmal Antheil genommen hatten.“ Heute erinnert der Straßenname Broicher Straße an den alten Ortsteil. Das Haus Broicher Straße 20 ist als denkmalgechütztes Haus gut erhalten. Anno 1750 wurde das ehemalige Bauernhaus mit Stall errichtet. Eine alte Linde vor dem Haus ist nach Aussage des früheren Eigentümers Walter Delfs 1985/86 einem Sturm zum Opfer gefallen.
| |
|
1979
- 2019 Am 11. November ist im Kirchenjahr der Martinstag, das Fest des heiligen Martin von Tours. Seit 1979 feierte der katholische Kindergarten Lohmar das Martinsfest jährlich bis 2019 mit einem eigenen Martinszug. Ursula Muß, die von ihren 46 Dienstjahren... Am 11. November ist im Kirchenjahr der Martinstag, das Fest des heiligen Martin von Tours. Seit 1979 feierte der katholische Kindergarten Lohmar das Martinsfest jährlich bis 2019 mit einem eigenen Martinszug. Ursula Muß, die von ihren 46 Dienstjahren die meiste Zeit den Kindergarten geleitet hat, erinnert sich: "Im Jahr 1979 zogen die Kinder und Eltern des Kath.Kindergartens von der KiTa in der Hermann-Löns-Strasse zum Birkenweg. Dort wurde das Martinsfeuer entzündet und die Geschichte des Hl.Martin gespielt und mit dem Bettler der Mantel geteilt. Anschließend zogen wir zurück in den Kindergarten, wo bei einem Umtrunk an die Kinder vom Martin der Weckmann verteilt wurde. Dieses Brauchtum haben wir bis ins Jahr 2019 beibehalten. Die Kinder haben in der Kita ihre Laterne gebastelt und sind dann am Martinstag mit ihren Eltern in Begleitung des St.Martin auf seinem Pferd singend durch die Straßen gezogen. Von der KiTa ging es durch den Korresgarten, Schmiedgasse durch den Bungert zum Park Lohmarhöhe. Die Anwohner haben ihre Häuser zu Ehren des St.Martin geschmückt und einige Familien entwickelten sehr viel Fantasie und Engagement und haben ihren ganzen Vorgarten geschmückt. Einige haben dann auch mit ihren Nachbarn weiter gefeiert, was sich zu einer Tradition entwickelt hat. Am Martinsfeuer wurde die Martinslegende gelesen, wo viele erstmals die Geschichte des Hl.Martin von Tours hörten. Der Martin teilte seinen Mantel mit dem Bettler und anschließend zogen wir zurück in den Kindergarten. Das Feuer wurde weiter von Vätern bewacht, gelöscht, die Feuerstelle aufgeräumt ( 1000 de Tackernadeln der Obstholzkisten aufgesammelt) und die Väter haben dann z.Teil den Abend mit Grillwurst und einem Bier ausklingen lassen. In Begleitung des St.Martin zogen wir dann durch den Mühlenweg zurück in den Kindergarten. Im Kindergarten gab es für die Kinder warmen Kakao und in den ersten Jahren für die Eltern Kakao mit Schuß. Das Blasorchester und die Feuerwehr trafen ebenfalls im Kindergarten ein, erhielten ihren Weckmann und ein warmes Getränk. Es wurde gemeinsam gesungen und glücklich zogen alle dann nach Hause. Für die Vorbereitungen und beim anschließenden Aufräumen standen immer ausreichend Eltern zur Verfügung. Nach dem Umzug der Kita in die Pützerau sind wir ab 2015 durch die Strassen rund um die Pützerau gezogen. Seit 2005 wurde es ebenfalls zur Tradition, mit den Vorschulkindern und ihren Laternen in das Elisabeth- Hospiz nach Deesem zu fahren, um mit den Bewohnern und ihren Angehörigen Martinslieder zu singen. Dies war für die Kinder und uns immer ein sehr berührendes Erlebnis. Wir wurden liebevoll empfangen."
| |
|
1899
- 2020 Der Saal der Gaststätte „Zur Baach“ der Familie Schmitz in der Seelscheider Straße 25 war stets die Heimat des 1899 gegründeten Dilettanten Vereins Neuhonrath. Eine Unterbrechung gab es als Anfang der 1970er Jahre das "Vereinslokal" wegen... Der Saal der Gaststätte „Zur Baach“ der Familie Schmitz in der Seelscheider Straße 25 war stets die Heimat des 1899 gegründeten Dilettanten Vereins Neuhonrath. Eine Unterbrechung gab es als Anfang der 1970er Jahre das "Vereinslokal" wegen Baufälligkeiten stillgelegt wurde. Beim Gasthaus "Auf dem Berge" bei der Familie Kirschbaum in Höffen fand man eine neue Vereinsbühne bis 1990 die sanierte und umgebaute "Baacher Bühne" bezogen werden konnte. In den ersten Vereinsjahren hatten die Männer auch die Frauenrollen zu übernehmen. Die Moral verbot es, daß Männer und Frauen gemeinsam spielten und hinter dem Bühnenvorhang verschwanden. Außerdem durften nur Männer Mitglied des Vereins sein. Diese Regelung galt bis nach dem Ende des 2. Weltkrieges. Allerdings standen Frauen schon nach dem 1. Weltkrieg erfolgreich als Schauspielerinnen auf der Theaterbühne. Wie leistungsfähig der Dilettantenverein schon in seinem 3. Vereinsjahr im Jahr 1902 war, zeigt eine Anzeige vom 5.4.1902 im Siegburger Kreisblatt. 2019 brachten die Schauspieler mit "Moos un Elend" einen herrlichen Klamauk um einen Hauptgewinn im Lotto auf die Baacher Bühnenbretter. 2020 wurden alle Theateraufführungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt.
| |
|
1949
- 1950 Der Kölner Peter Müller (de Möllesch Aap, geb. am 24.2.1927, gest. 1992 mit 65 Jahren an einem Schlaganfall) war von 1949 (wahrscheinlich aber schon früher) bis Mitte 1950 in Donrath im „Weißen Haus“ und ist dort für die Deutsche Meisterschaft im... Der Kölner Peter Müller (de Möllesch Aap, geb. am 24.2.1927, gest. 1992 mit 65 Jahren an einem Schlaganfall) war von 1949 (wahrscheinlich aber schon früher) bis Mitte 1950 in Donrath im „Weißen Haus“ und ist dort für die Deutsche Meisterschaft im Profi-Boxsport trainiert worden. Der Tross um ihn herum waren – einschließlich Trainer – 4 bis 5 Leute aus Köln, von denen einer Goldschmied hieß und ihn wahrscheinlich auch gesponsert hatte. "De Aap“ – wie man ihn in Köln nannte – wohnte im „Weißen Haus“, wo man ihm im Saal der Gaststätte einen Boxring aufgebaut hatte. Das „Weiße Haus“ ist damals von der Familie Brinkmann betrieben worden. Seine Sponsoren waren etwas Besseres und wohnten und speisten im „Hotel Aggerburg“ in Donrath, das im Besitz der Familie Lönqvist war. Matthias Haller aus Lohmar, Mitglied im Boxclub Troisdorf, war öfter Peter Müllers Sparringspartner. Er erhielt dafür pro Trainingskampf fünf D-Mark, wofür er oft viele harte Schläge einstecken musste. In dieser Zeit war auch für einige Wochen El Hossmann, ein hübscher dunkelhäutiger Boxweltmeister aus Amerika, im „Weißen Haus“, um mit Peter Müller zu boxen. Beim Baden in der Dornhecke in Donrath trug er seine Freundin (wahrscheinlich Ludmilla Kröll, später verheiratete Kraheck) bekleidet von einem Aggerufer zum anderen. Als er in der Mitte des Flusses wahr, riefen einige seiner Fans: „Feigling, Feigling …“. Da ließ er seine Freundin einfach in die Agger fallen. Wenn „De Aap“ bei Festlichkeiten im Saal des „Hotelzur Linde“ erschien, wurde er von der Kapelle mit einem Tusch begrüßt. Wollte er dann tanzen, verdrückten sich die Mädchen auf die Toilette, weil er wegen seinen Bärenkräften mit den Tanzpartnerinnen ziemlich rauh umging. Als PM Deutscher Meister geworden war, hatte er sich ein gebrauchtes Auto – einen Opel – gekauft. Damit kam ihm in Siegburg auf der Kaiserstraße mit einem Pferdefuhrwerk ein Bekannter aus Köln, der im „Knast“ gewesen war (PM kannte sich auch in der Kölner Unterwelt aus), entgegen. Beide hielten mitten auf der Straße ihre Fahrzeuge an und begrüßten sich ausgiebig und überschwenglich und für die anderen Fahrzeuge, einschließlich der Straßenbahn gab es kein Durchkommen mehr. Man erzählt von ihm, dass er mit dem „Lühme Grietche“ nach Siegburg fuhr und keine Fahrkarte hatte. Als der Schaffner ihn deshalb in Lohmar aus dem Zug setzen wollte, schlug er ihn k.o. und sprang am Nordbahnhof in Siegburg aus dem Zug, dann über das Bahnhofsgeländer und verschwand. (Quelle: mündliche Mitteilung von Josef Klug aus Lohmar.) So hörte man zu dieser Zeit fast täglich neue Episoden von „de Möllesch Aap“.
| |
|
2015
Der Weiler Unterdahlhaus liegt in Quellmuldenlage an der alten Höhenstraße von Siegburg nach Wipperführt, an der Quelle des Dahlhauser Baches. Der Weiler gehörte bei der Uraufnahme 1824 zur Bürgermeisterei Wahlscheid. Er bestand zu jener Zeit aus... Der Weiler Unterdahlhaus liegt in Quellmuldenlage an der alten Höhenstraße von Siegburg nach Wipperführt, an der Quelle des Dahlhauser Baches. Der Weiler gehörte bei der Uraufnahme 1824 zur Bürgermeisterei Wahlscheid. Er bestand zu jener Zeit aus drei Wohngebäuden. Die älteste Erwähnung von Unterdahlhaus finden wir in einer Teilungsurkunde aus dem Jahr 1477 nach dem Tode des Ritters Wilhelm von Nesselrode. Zur Aufteilung gelangten die zu Burg Schönrath gehörigen Pachthöfe, darunter der Hof zu „Daehlhusen“. Im Höfeverzeichnis der Halfen im Amt Lülsdorf aus dem Jahr 1579 ist „Schoinraids Halffenn“ zu Dahlhausen verzeichnet. Heinrich Wilhelm Wasser, Pächter des Unterdahlhauser Hofes leistet im Jahre 1666 in der Honrather Kirche den Erbhuldigungseid. Bei der Volkszählung im Jahre 1871 leben im Weiler Unterdahlhaus 30 Einwohner in fünf Wohngebäuden mit 7 Haushaltungen. Die Bewohner der Ortschaft waren evangelisch und gehörten zum Kirchspiel Honrath. 1925 gründen die Bewohner die Durbusch-Kleindahlhauser Wasserwerke an der Quelle des Dahlhauser Baches. Sie versorgte die Orte Unterdahlhaus, Durbusch , Breide und Boddert über 40 Jahre mit Trinkwasser bis mit der Kommunalen Wasserversorgung der Betrieb eingestellt werden musste. Im Zuge der Kommunalen Neugliederung bekamen 1970 die Wege im Bereich der alten Hofanlage Unterdahlhaus die Namen „Lüderichsweg“ und „Im Brannenfeld“. Unterdahlhaus und die zugehörigen Felder und Ackerflächen gehören heute zu Durbusch. | |
|
2015
Oberdahlhaus liegt an der Quelle des Brunnenbaches an der alten Höhenstraße von Siegburg nach Wipperführt. Der Ort gehörte bei der Uraufnahme 1824 zur Bürgermeisterei Wahlscheid. Er bestand zu jener Zeit aus 9 Wohngebäuden. Die älteste Erwähnung von... Oberdahlhaus liegt an der Quelle des Brunnenbaches an der alten Höhenstraße von Siegburg nach Wipperführt. Der Ort gehörte bei der Uraufnahme 1824 zur Bürgermeisterei Wahlscheid. Er bestand zu jener Zeit aus 9 Wohngebäuden. Die älteste Erwähnung von Oberdahlhaus finden wir in einer Urkunde aus dem Jahr 1487. Heinrich Stael von Holstein erbte die Höfe Meinenbroich und den Dahlhauser Hof. 1579 gibt es in Oberdahlhaus 2 Halfenhöfe der Familien von Bellinghausen und von Lülsdorf. Bei der Volkszählung im Jahre 1871 leben in Oberdahlhaus 76 Einwohner in 16 Wohngebäuden. Die Bewohner von Oberdahlhaus waren Katholischen Glaubens und gehörten zur Pfarre Neuhonrath.1895 zählt der Ort, durch den Zuzug von Bergleuten der Grube Lüderich bereits 103 Einwohner und gehörte zu den einwohnerstärksten Ortschaften von Honrath. 1924 wurde die Ortschaft an das Wahlscheider Stromnetz angeschlossen. Im Jahr 1931 erstellten die Bewohner von Oberdahlhaus ihre eigene Wasserversorgung mit Pumpenhaus und Hochbehälter. Im Zuge der Kommunalen Neugliederung kam Oberdahlhaus 1969 zu Lohmar und wurde in Dahlhaus umbenannt. | |
|
1994
- 2001 Einige Jahre nach dem Umzug des Unternehmens Battenfeld-Fischer von Lohmar nach Troisdorf entschied die Stadt Lohmar 1993 das ehemalige Werksgelände beidseits der Hermann-Löns-Straße in Wohnbaufläche umzuwandeln. Aus dem sich anschließenden... Einige Jahre nach dem Umzug des Unternehmens Battenfeld-Fischer von Lohmar nach Troisdorf entschied die Stadt Lohmar 1993 das ehemalige Werksgelände beidseits der Hermann-Löns-Straße in Wohnbaufläche umzuwandeln. Aus dem sich anschließenden städtebaulichen Wettbewerb ging 1994 das Archtekturbüro Böttger aus Köln als Preisträger hervor. Sie hatten in einem dreigeteilten Planungskonzept unter Einschluss der Grünfläche an der Bachstraße (heute Altenheim) eine Kurzzeitpflegestation mit Altenwohnungen und 160 Sozial- und Eigentumswohnungen geplant. Dieses Konzept wurde nur in dem Bereich zwischen Schmiedgasse und Hermann-Löns-Straße umgesetzt. Hier baute die Gemeinützige Wohnungsbaugesellschaft Troisdorf ca. 70 Sozialwohnungen. Auf der Seite südlich der Hermmann-Löns-Straße wurde ein neuer Bauwettbewerb durchgeführt, aus dem die Firma Wohnbau Schulte als Sieger hervorging und ab 2001 mit dem Bau von Stadthäusern begann. Zwischen den Stadthausreihen wurde ein neuer Erschließungsweg angelegt, der den Namen Müllergasse erhielt, da hier das Geburtshaus des verstorbenen Ehrenbürgers Bernhard Walterscheid-Müller stand. | |
|
2020
Der Ulrather Hof war ein Hofgut bei Siegburg, von dem heute nur noch ein Mauerrest übrig geblieben ist. Hier wurden 1944 drei junge luxemburgische Kriegsgefangene erschossen, die im damaligen Zuchthaus in Siegburg gefangen gehalten wurden, nachdem... Der Ulrather Hof war ein Hofgut bei Siegburg, von dem heute nur noch ein Mauerrest übrig geblieben ist. Hier wurden 1944 drei junge luxemburgische Kriegsgefangene erschossen, die im damaligen Zuchthaus in Siegburg gefangen gehalten wurden, nachdem sie zunächst zum Tode verurteilt und später zu langjährigen Haftstrafen begnadigt wurden. Eine Gedenktafel und eine jährliche Gedenkfeier der Stadt Siegburg erinnern als Mahnmal an das Verbrechen des Nazi-Regimes. Siehe auch unter Medien "Ulrather Hof". | |
Johann Josef Dunkel (Hannjupp) war Soldat im Füsilier-Regiment "Fürst Karl-Anton von Hohenzollern" Nr. 40 und später Fabrikarbeiter im Feuerwerkslaboratorium in Siegburg. Alle sieben Söhne waren beim Militär. Jakob Dunkel (geb.1875) war im Infanterie-Regiment "von Goeben" 2. Rheinisches Nr. 28 und Peter Dunkel (geb. 1888) gehörte dem 10. Rheinischen Infantrie-Regiment Nr. 161 an. Hannjupp stammte aus Kriegsdorf und war mit Anna Maria, geb.Kemmerich aus Lohmar verheiratet. Sie zogen mit 11 Kindern 1890 in das Kemmerichs Häuschen auf der Kieselhöhe 13. Der Fachwerkkotten hatte eine winzige Küche, eine Wohnstube, ein Flürchen mit einer schmalen, steilen Treppe zu drei niedrigen Dachkämmerchen. Hier war die Urzelle der zahlreichen Lohmarer Dunkels. | |
In den Räumen des Erdgeschosses rechts war früher die Spadaka Wahlscheid untergebracht. In dem – inzwischen aufgestockten – Gebäude befindet sich heute links die Bäckerei „R. Mylenbusch“. Unten am Bildrand ist noch viel Grün neben der Fahrbahn zu... In den Räumen des Erdgeschosses rechts war früher die Spadaka Wahlscheid untergebracht. In dem – inzwischen aufgestockten – Gebäude befindet sich heute links die Bäckerei „R. Mylenbusch“. Unten am Bildrand ist noch viel Grün neben der Fahrbahn zu sehen. Nebenstehend eine „Nota“ des „Kaufhauses“ Kleeberg. Wenn man den Geschäftszweig in der Anschrift studiert, muß man sich fragen, womit W. Kleeberg nicht handelte. Lassen wir alte Wahlscheider von ihren Erlebnissen in den damaligen „Tante Emma“-Läden erzählen: Eheleute Hohn, Franz und Meta geb. Schiffbauer, Kattwinkel: Beim Betreten des Ladens empfing einen an der Tür bereits ein starker Salzheringsgeruch. Aber auch das Faß mit „Steenollich“ (Steinöl = Petroleum) roch man sehr gut. Petroleum wurde in Ermangelung des elektrischen Lichtes für die Petroleumlampen benötigt. | |
|
1932
Nicht große Handelsgeschäfte, sondern Hausierer waren in früherer Zeit Hauptträger des Warenverkehrs. Ihr Wahrzeichen war die Kütz oder Kiepe (Tragkorb) auf dem Rücken. Er enthielt je nach Hausierer Hosenträger, Garn, Schuhwichse, Schuhriemen, Seife,... Nicht große Handelsgeschäfte, sondern Hausierer waren in früherer Zeit Hauptträger des Warenverkehrs. Ihr Wahrzeichen war die Kütz oder Kiepe (Tragkorb) auf dem Rücken. Er enthielt je nach Hausierer Hosenträger, Garn, Schuhwichse, Schuhriemen, Seife, Senf, Schwefelhölzer, Knöpfe, Bürsten, Kämme, die verschiedensten Nadeln, Messer usw. Andere Hausierer kamen mit Textilwaren. Sie besuchten in regelmäßigen Abständen Wahlscheid’s Landbevölkerung. Wenn sie ihre Kiepe oder – später – den Koffer auf dem Küchentisch abgestellt hatten, hielten sie zunächst einen „Klaaf“. Die Bäuerin, die meist eine Tasse Kaffee verabreichte, war neugierig, das Neueste aus der Umgebung zu erfahren. Die Hausierer wußten genau, was die Bäuerin brauchte. Aber auch Korbmacher, Besenbinder, Kesselflicker und Scherenschleifer gingen über Land Einer dieser Hausierer war Schürzen Gustav. „Schützel’s Justav“ geb. 1900, der für die Bäuerinnen Schürzen, Strümpfe, Unterhosen usw. führte, erzählte, daß er den Handel 1930 begann. Seine Landwirtschaft mit 2 Kühen gab damals nicht mehr genug her. Zunächst besuchte er seine Kundschaft mit dem Fahrrad. Mitte der 30er Jahre erwarb er ein „Hermänchen“. Personen von links: 1. Hausierer „Schützel’s Justav“ (Schürzen Gustav) – Gustav Bäcker, Kuckenbach; 2. Alma Schiffbauer geb. Lindenberg, Hoffnungsthal; 3. Heinz Cordes, Köln-Merheim; 4. Mathilde Haas geb. Zinn, Grünenborn; 5. Wilhelm Fischer, Kuckenbach; 6. Emma Fischer geb. Bäcker, Kinder vorne: 1. Else Exner geb. Fischer, Kuckenbach; 2. Alfred Fischer, verstorben; 3. Ernst Fischer | |
|
1936
Rechts ist der Wahlscheider Güterbahnhof mit Abstellgleis, Rampe und Prellbock erkennbar. Hier wurden die Güter umgeschlagen. Im Hintergrund rechts sieht man das „Haus der Arbeiterfront“. Das 3. Gleis mit „Bahnsteig 2“ befindet sich - auf dem Bild... Rechts ist der Wahlscheider Güterbahnhof mit Abstellgleis, Rampe und Prellbock erkennbar. Hier wurden die Güter umgeschlagen. Im Hintergrund rechts sieht man das „Haus der Arbeiterfront“. Das 3. Gleis mit „Bahnsteig 2“ befindet sich - auf dem Bild nicht erkennbar – links vom Zug. Heute steht hier das Forum Wahlscheid. Im Fenster des Eisenbahnwagens: Lore Bonow geb. Kirschbaum, Wahlscheid. | |
Bei den beiden Lederschürzen tragenden Schmiedemeistern handelt es sich links um Karl Mylahn und rechts um den Vater Wilhelm Maylahn. Das Gebäude stand ursprünglich in Mailahn und war dort abgebrochen worden. Ende der 70er Jahre des letzten... Bei den beiden Lederschürzen tragenden Schmiedemeistern handelt es sich links um Karl Mylahn und rechts um den Vater Wilhelm Maylahn. Das Gebäude stand ursprünglich in Mailahn und war dort abgebrochen worden. Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts mußten Wohnhaus und Schmiede der neuen Straßenführung weichen. Nachdem das Schmiede-Gebäude 1935 dringend als Kuhstall benötigt wurde, baute man gegenüber auf der anderen Straßenseite eine neue Schmiede (steht heute noch als unverputztes Gebäude). Als Max Mailahn im Krieg fiel, war er Schmied in der 4. Generation. Werkstatt-Klaaf: Otto Stöcker, Grünenbom, früher Schmiedegeselle bei Schmiedemeister Maylahn in Kattwinkel: So besuchte auch „Hampitter“ (Johann-Peter) Riemscheid, Rothehöhe, gerne die Schmiede Maylahn in Kattwinkel. Man hatte damals noch Zeit für einander und machte seine Späße. Otto Stöcker konnte sich noch gut erinnern, daß Meister Maylahn dem zuschauenden und auf einem Stuhl sitzenden Hampitter die Jacke auf dem Stuhl mit Nägeln festschlug. | |
Karl Lindenberg beschlägt das Pferd des Totenwagenfahrers Otto Hohn, Auelerhof, der das Bein des Pferdes hochhält. Bei dieser Arbeit nebelte der Rauch vom brennenden Huf die Schmiede ein. Edith Wasser geb. Lindenberg, Aggerhof, schilderte, wie ihr... Karl Lindenberg beschlägt das Pferd des Totenwagenfahrers Otto Hohn, Auelerhof, der das Bein des Pferdes hochhält. Bei dieser Arbeit nebelte der Rauch vom brennenden Huf die Schmiede ein. Edith Wasser geb. Lindenberg, Aggerhof, schilderte, wie ihr Vater Karl als Schmied in Weeg die Naben in den Karrenrädem und die Eisenringe anbrachte: | |
|
1875
Die Viehhändler spielten früher in der landwirtschaftlich ausgerichteten Gemeinde Wahlscheid, wo ein guter Viehbestand eine wichtige Lebensgrundlage war, eine bedeutende Rolle. Links: Peter Schauenberg, Scheid; offenbar – wie Friederich Mylenbusch... Die Viehhändler spielten früher in der landwirtschaftlich ausgerichteten Gemeinde Wahlscheid, wo ein guter Viehbestand eine wichtige Lebensgrundlage war, eine bedeutende Rolle. Links: Peter Schauenberg, Scheid; offenbar – wie Friederich Mylenbusch meint – mit „Oeßen-Ziemer“ (Ochsenziemer). Dabei handelte es sich um einen Ochsen-Samenstrang, der an einem um das Handgelenk geschlungenen Lederriemen getragen wurde. Rechts: Wilhelm Lindenberg geb. 24.12.1851, verst. 18.12.1888; Gast- und Landwirt sowie Viehhändler; Ehemann der „Witmön“ und Vater von „Rudolf’ in Münchhof. Alte Wahlscheider können sich noch gut an die Schweinejagd durch Wahlscheid’s Hauptstraße erinnern:
| |
|
1926
Hugo Breideneichen (rechts außen), Pferdehändler und Pächter der heutigen Gaststätte „Zur Alten Linde“ (Dowideit), mit 8 Fohlen auf dem historischen Marktplatz an der ev. Bartholomäus-Kirche. ca. 1926 Links sehen wir Emst Frackenpohl, Weeg. Neben... Hugo Breideneichen (rechts außen), Pferdehändler und Pächter der heutigen Gaststätte „Zur Alten Linde“ (Dowideit), mit 8 Fohlen auf dem historischen Marktplatz an der ev. Bartholomäus-Kirche. ca. 1926 Links sehen wir Emst Frackenpohl, Weeg. Neben Hugo B. steht sein Helfer Karl Steeger, Aggerhof. Der 5. Herr von links im Hintergrund kann Hugo Krämer, Oberstehöhe, sein. Die früheren Pferdehändler und heutigen Gebrauchtwagenhändler sind in mancherlei Hinsicht – insbesondere was die Vertrauenswürdigkeit angeht — miteinander vergleichbar. Per Handschlag wurde der Verkauf des Pferdes besiegelt. Beim Pferdekauf hieß es: „Ooren oder de Jäldbüggel; hongenoh wüste betuppt.“ (Augen oder Geldbeutel; womöglich wirst du betrogen.) Pferdehändler Breideneichen, der später in den Auelerhof zog, genoß das Vertrauen der hiesigen Landwirte. Freche Pferde gingen an Holzfuhrwerker; bei der Waldarbeit konnten sie sich austoben.
| |
|
1925
Rechts am Hamstock: Hermann Vierkötter; links an der Sattler-Nähmaschine: Peter Müller; rechts hinten am Nähroß: Otto Lindenberg, Auelerhof. An der Wand hängt viel „Jesprattels“ (verstreutes Kleinzeug). Der „Hamächer“ stellte die von den Bauern... Rechts am Hamstock: Hermann Vierkötter; links an der Sattler-Nähmaschine: Peter Müller; rechts hinten am Nähroß: Otto Lindenberg, Auelerhof. An der Wand hängt viel „Jesprattels“ (verstreutes Kleinzeug). Der „Hamächer“ stellte die von den Bauern benötigten Geschirre für die Zugtiere her und erledigte die Reparaturen. „Hamächer“ Otto Lindenberg, Auelerhof: Auch die Schuster, Schneider und Schlächter arbeiteten im sogenannten Lohnwerk für Kost und Lohn in den Häusern ihrer Kunden. Mit der Motorisierung in der Landwirtschaft stellte sich der „Hamächer“ bzw. Sattler auf neue Arbeitsbereiche um. Er betätigte sich fortan mehr als Polsterer und Raumausstatter. Jahrzehnte vorher, als die 1. Tapeten aufkamen, beschäftigte sich der „Hamächer“ bereits mit dem Tapezieren; es war der Beginn der Raumausstattertätigkeit. Lange hielt man noch am einfachen Streichen der Wände fest. Muster „tupfte“ man auf die frisch gestrichenen Wände. Deshalb rief man die Anstreicher Fritz Schönenberg, Fließengarten, und Wilhelm Weber, Agger, auch „Tüpper“. | |
|
1928
In Wahlscheid gab es früher viele Schuster. Sie hatten gut zu tun, da ihre Kunden die Schuhe wegen der langen und vielen Fußmärsche sowie der schlechten Wege stark strapazierten. Im übrigen fertigten sie auch neue Schuhe an. Die Schuster kamen... In Wahlscheid gab es früher viele Schuster. Sie hatten gut zu tun, da ihre Kunden die Schuhe wegen der langen und vielen Fußmärsche sowie der schlechten Wege stark strapazierten. Im übrigen fertigten sie auch neue Schuhe an. Die Schuster kamen damals ins Haus, um den ganzen Tag lang alle Schuhe der Familie in Ordnung zu bringen bzw. zu „lappen“.Neue Sohlen wurden mit spitzen Holzstiften befestigt bzw. festgepinnt. Gepinnte Sohlen hielten viel länger als genagelte. Außerdem waren die Schuhe nicht so schwer. Um die Sohlen der hohen Arbeitsschuhe zu schonen, benagelten die Schuster die gesamte Sohlenfläche. Man lief auf den achteckigen Nägelköpfen. Die Nägel hatten den Nachteil, daß sie sich schnell aus den Sohlen lösten. Sie lagen dann auf dem Boden und waren der Grund dafür, daß die Radfahrer früher häufiger als heute plattfuhren. | |
Die Reinigung der Schornsteine in Wahlscheid und Umgebung lag von ca. 1840 (davor reinigte ein Herr Küsgen) bis zu Beginn dieses Jahrhunderts in den Händen der Herren Hohn (Vater und Sohn) aus Mackenbach. Personen – von links: unten: 1. Martha... Die Reinigung der Schornsteine in Wahlscheid und Umgebung lag von ca. 1840 (davor reinigte ein Herr Küsgen) bis zu Beginn dieses Jahrhunderts in den Händen der Herren Hohn (Vater und Sohn) aus Mackenbach. Personen – von links: unten: 1. Martha Lindenberg geb. Hohn; 2. Frau Karl Fischer, Erna geb.Lindenberg, Emmersbach; 3. Emma Hohn geb. Hohn 2. Reihe: 1. Kind Hildegard Schröder geb. Manchen, Mackenbach; 2. Oma Luise Hohn geb. Heinen; 3. Hampeter (Johann- Peter) Hohn, Schornsteinfeger; 4. mit langer Pfeife: Daniel Hohn, Salzhändler (vgl. Kapitel „Originale“); 5. in Uniform: Hugo Hohn oben: 1. Paul Manchen; 2. Berta Manchen geb. Hohn; 3. Julie Lindenberg geb. Hohn, Schachenauel; 4. Hermann Lindenberg (Ehemann von 2.); 5. Maria Hohn (Ehefrau von Daniel H.) Laura Müllenbach geb. Hohn, früher „Äuelchen“, jetzt Hofferhof:
| |
|
1913
Auf der Postkarte vom 31.12.1913 schrieb Wilhelm Wasser, geb. 1866 (auf dem Bild im Hintergrund), aufgewachsen in Honsbacher Mühle,später nach der Heirat wohnhaft in Oberlüghausen: „Umseitige Karte stellt den großartigen Vogelfang 1913 dar.“ Im... Auf der Postkarte vom 31.12.1913 schrieb Wilhelm Wasser, geb. 1866 (auf dem Bild im Hintergrund), aufgewachsen in Honsbacher Mühle,später nach der Heirat wohnhaft in Oberlüghausen: „Umseitige Karte stellt den großartigen Vogelfang 1913 dar.“ Im Bild vorne: Karl Wasser geb. 1865 (Bruder von Wilhelm). Im Hasenberg und Sprengbüchel verfugte die Familie Wasser, Honsbacher Mühle, über umfangreichen Grundbesitz. Auf dem Bild sieht man, daß die Jungbäume, in denen Vogelkäfige hängen, gestutzt und von Blättern befreit sind. Ein Fangnetz (genannt: „Blitz“) ist auf der planierten Fläche aufgespannt. Im Hintergrund befindet sich offenbar der Vogelherd. Mit einer „Lockpitsch“ (Lockdrossel) lockte man die Vögel an. | |
Paul Kirschbaum, Hausen, fährt im 2. Weltkrieg mit dem Schlitten Milchkannen nach Kreuznaaf. „Haischen“ halten seine Hände warm. Franz Hohn, Kattwinkel: Paul Kirschbaum, Hausen, fährt im 2. Weltkrieg mit dem Schlitten Milchkannen nach Kreuznaaf. „Haischen“ halten seine Hände warm. Franz Hohn, Kattwinkel: Den Stallboden polsterte der Bauer im Winter sehr gut mit einem „Buusch“ (Gebund) Stroh aus, um ein schnelles Abstumpfen der scharfen Hufeisen zu vermeiden. Der Bauer versuchte, sich selbst durch „Iiskraampen“ (Art Sporen) festen Halt zu schaffen | |
Mit einem Pflug wurden die „Earpel“ (Kartoffeln) ausgefurcht (später „geröddert“). Die „Leser“ sammelten die Kartoffeln in Drahtkörben und schütteten sie in die „Mestekaar“. Die „Strünk“ warf man zum Verbrennen auf einen Haufen. Ein „Kaasch“... Mit einem Pflug wurden die „Earpel“ (Kartoffeln) ausgefurcht (später „geröddert“). Die „Leser“ sammelten die Kartoffeln in Drahtkörben und schütteten sie in die „Mestekaar“. Die „Strünk“ warf man zum Verbrennen auf einen Haufen. Ein „Kaasch“ (Dreizahn) erleichterte die Arbeit. Das Ernten der Kartoffeln war „kött“ und „schröh“. Schnell waren die Kinder „schmaachtig“ (hungrig); wie froh waren sie, wenn Oma mit dem Korb kam. Sie brachte „Muckefuck“ in großen Emaille-Kaffeekannen und „en Brock“ (Butterbrot). Ein Tuch deckte den Inhalt des Korbes ab. Man setzte sich „beneen“ (beieinander), ließ es sich gut schmecken und hielt einen „Kall“. „Sienöh“ (beinahe) alle Familienmitglieder – von den im Haushalt lebenden Großeltern sowie unverheirateten Onkel und Tanten bis zum heranwachsenden Schulkind (damals gab es noch Kartoffelferien) – waren bei der Kartoffelernte eingespannt. „Dat rühmte“! (Das ging voran!) Nach getaner schwerer Tagesarbeit aß die Familie abends zu Hause gemeinsam Kartoffelkuchen (“Dejelskochen“) sowie mit Butter, Apfelkraut und „Klatschkäse“ belegte Schwarzbrotschnitten. Man war nicht pingelig; jeder langte mit seiner Gabel in die mitten auf dem Tisch stehende Kartoffelschüssel. Es gab „zebasch“ (reichlich). | |
|
1930
- 1939 Auf einem Melkschemel steht ein „Schwengel-Botterkiern“ (Drehkiem). Frau Stöcker schält „Eärpel“ (Kartoffeln) in einen Kump (Schüssel). Früher verarbeiteten die Bauern die Milch selbst zu der köstlichen Sauerrahm-Butter bzw. zum Klatschkäse oder... Auf einem Melkschemel steht ein „Schwengel-Botterkiern“ (Drehkiem). Frau Stöcker schält „Eärpel“ (Kartoffeln) in einen Kump (Schüssel). Früher verarbeiteten die Bauern die Milch selbst zu der köstlichen Sauerrahm-Butter bzw. zum Klatschkäse oder Böggelskies. Am Schwengel des Kiern bildete sich die sogenannte „Schwengelbutter“. Täglich schöpften die Bauern von der in großen Steintöpfen befindlichen Milch den Sauerrahm (Schmand) zum Buttern ab. Die untere Schicht ergab den begehrten Klatschkäse. Die Bäuerin knetete in einer hölzernen „Botterschottel“ mit einem Holzlöffel die letzte Buttermilch heraus und formte die Butter, nachdem sie kräftig gesalzen worden war, zu einem Wecken. | |
Kalin hatte, wie man auf dem Bild erkennt, eine Vorliebe für Geranien. Sie lieferte – auch noch im hohen Alter – Butter, Eier und Käse nach Köln-Kalk. Die alten Einwohner können sich noch daran erinnern, daß sie mit dem bis zu 50 Pfund schweren Korb... Kalin hatte, wie man auf dem Bild erkennt, eine Vorliebe für Geranien. Sie lieferte – auch noch im hohen Alter – Butter, Eier und Käse nach Köln-Kalk. Die alten Einwohner können sich noch daran erinnern, daß sie mit dem bis zu 50 Pfund schweren Korb auf dem Kopf zum Bahnhof Honrath ging. Der Kopf war durch ein Kissen geschützt. Den „Botter-Wecken“ im Korb schützte man vor den Sonnenstrahlen durch ein Kappesblatt. Am Arm trug Kalin einen mit Eiern gefüllten Korb. Der Enkel, genannt „Stüssgen“ führte später das „Geschäft“ weiter. Die Bauernfamilie ernährte sich von dem, was der eigene Hof hergab. Überschüssige Produkte wie Butter und Eier sowie Vieh verkaufte der Bauer auf dem Markt, um Steuern und Saatgut bezahlen zu können. Die Bäuerin kaufte im „Wenkel“ (Kolonialwarengeschäft) die sogenannte „Wenkelswahr“; das waren in der Regel nur Salz, Zucker, Haferflocken, Reis, Petroleum, Kathreiners (Malz-)Kaffee bzw. „Muckefuck“ (franz.: „moca faux“ = falscher Mokka) und Strangtabak. Hauptnahrung für die Bauemfamilie waren Kartoffeln, Mehlspeisen und Brot. Fleisch gab es nur an hohen Festtagen. Die Bäuerin kannte keinen Kühlschrank, verfügte aber trotzdem über Vorräte. Oben unter der Kellerdecke – vor Mäusen sicher – hing der Brotkorb. Die Butter befand sich im irdenen Topf oder im kühlen Brunnen, an einer Kette im Eimer hängend. Eine große Menge Bohnen und Kappes waren in „Steendöppen“ eingesäuert. Das Schwein lag eingesalzen im Faß. Würste, Schinken und Speck befanden sich im „Röhches“ (Räucherkammer). Erbsen und Bohnen hingen in Leinensäckchen an den Deckenbalken. „Öllich“ (Zwiebel) und getrocknete Pflaumen für die Milchsuppe sowie Apfelschnitzel lagen auf dem „Ohlder“ (Speicher). | |
|
1930
Personen von links: 1. mit hochgekrempelten „Maue“ (Ärmel): Hermann Oberdörster, Mackenbach 2. Otto Seynsche, Weeg 3. auf der Mähmaschine: Besuch 4. Karl Lindenberg, Weeg 5. mit „Hällepe“ (Hosenträger): Emst Piel, Wahlscheid-Kirche Hermann... Personen von links: 1. mit hochgekrempelten „Maue“ (Ärmel): Hermann Oberdörster, Mackenbach 2. Otto Seynsche, Weeg 3. auf der Mähmaschine: Besuch 4. Karl Lindenberg, Weeg 5. mit „Hällepe“ (Hosenträger): Emst Piel, Wahlscheid-Kirche Hermann Oberdörster wetzt die „Säßel“ (Sense) mit dem Wetzstein, „Strichsteen“ genannt. Er wurde im Schlotter, einem Ochsenhom, aufbewahrt. Den mit Wasser und Essig gefüllten Schlotter trug der Bauer an einem Ledergürtel. Das Ochsenhorn hatte gegenüber dem Kuhhorn den Vorteil, daß es weniger Krümmung aufwies. Wir sehen auf dem Bild, daß eine Mähmaschine den Männern das Mähen erleichterte. Das tägliche Stallfutter mähte der Bauer mit der „Säßel“. Es war keine Seltenheit, daß der Bauer abends zu seiner Frau sagte: „môhendemôrjen (morgen früh) öm 5.00 Uhr jôn ech Jraas mähen...“ Um im Sommer der Tageshitze zu entgehen, erledigte der Bauer diese harte Arbeit gern in aller „Herrjötsfröh“ vor Sonnenaufgang. Im übrigen schnitt es sich mit dem Tau im Gras besser. | |
|
1942
Personen von links: 1. Hermann Lindenberg 2. Emilie Lindenberg (Großeltern) 3. Olga Breideneichen verw. Lindenberg geb. Lindenberg 4. ehemaliger Bürgermeister Rolf Lindenberg Bevor das Heu aufgebockt werden konnte, mußte es – nach dem Schnitt... Personen von links: 1. Hermann Lindenberg 2. Emilie Lindenberg (Großeltern) 3. Olga Breideneichen verw. Lindenberg geb. Lindenberg 4. ehemaliger Bürgermeister Rolf Lindenberg Bevor das Heu aufgebockt werden konnte, mußte es – nach dem Schnitt angetrocknet auf Gemadden liegend – mit dem Handrechen auseinander – „jespreet“ werden. Nach dem 2. Weltkrieg erleichterten Heuwender die Arbeit. Wenn Regen nahte, war Eile geboten. Dann wurde das Heu schnell auf Kotten aufgehäuft. Das Versteckspiel unter dem Heubock war für die Kinder ein besonderes Vergnügen. Auch so manches Liebespaar fand hier eine Gelegenheit zum „Knuutschen“. Auch an Feiertagen mußte, wenn Regen drohte, „en et Heu jejangen“ werden. In der fortgeschrittenen Jahreszeit machte man einen 2. Grasschnitt zu Heu, den „Jrohmet“. | |
|
1938
Personen von links: 1. u. 2. Ehel. Lindenberg August und Berta geb. Kirschbaum (Eltern vom „Hamächer“ Otto Lindenberg, Auelerhof) 3. Frau Hugo Riemerscheid, Klara geb. Lindenberg 4. Elli Naaf geb. Lindenberg, Neuheim Das hohe rechteckige Beladen... Personen von links: 1. u. 2. Ehel. Lindenberg August und Berta geb. Kirschbaum (Eltern vom „Hamächer“ Otto Lindenberg, Auelerhof) 3. Frau Hugo Riemerscheid, Klara geb. Lindenberg 4. Elli Naaf geb. Lindenberg, Neuheim Das hohe rechteckige Beladen eines Heuwagens wollte gekonnt sein. Auf dem Hof angelangt, kam das Heu in die Scheune oder über den Viehstall. Von hier warf man es täglich bei Bedarf durch eine Falltür in „et Fooderdänn“ (Futtertenne im Stall). | |
|
1939
Auf dem Heuwagen liegt ein deutscher Soldat. Der Maulesel hatte schon im 1. Weltkrieg für das kanadische Militär im Rheinland „gedient“. Dank der guten Pflege des Karl O. wurde der Maulesel ca. 40 Jahre alt. Zuletzt mußte Karl das morgens im Stall... Auf dem Heuwagen liegt ein deutscher Soldat. Der Maulesel hatte schon im 1. Weltkrieg für das kanadische Militär im Rheinland „gedient“. Dank der guten Pflege des Karl O. wurde der Maulesel ca. 40 Jahre alt. Zuletzt mußte Karl das morgens im Stall liegende Tier mit dem Flaschenzug in die aufrechte Lage hieven. | |
|
1940
Personen von links: sitzend: 1. Helmut Kühler, Mackenbach 2. Hans Imberg, Münchhof 3. Helmut Luttmann, Wahlbusch 4. Günter Brinkmann, Fließengarten 5. Arthur Lohmar, Neuhonrath 6. Karl Heinz Frackenpohl, Weeg 7. Kurt Oberdörster, Mackenbach stehend:... Personen von links: sitzend: 1. Helmut Kühler, Mackenbach 2. Hans Imberg, Münchhof 3. Helmut Luttmann, Wahlbusch 4. Günter Brinkmann, Fließengarten 5. Arthur Lohmar, Neuhonrath 6. Karl Heinz Frackenpohl, Weeg 7. Kurt Oberdörster, Mackenbach stehend: 1. Maria Imberg, Münchhof 2. vorne: Elli Unteroberdörster, Haus-Dorp 3. hinten: Margot Müller geb. Klein, Kirchbach 4. vorne: Else Peters, Wahlscheid 5. hinten: Kläre Straube geb. Steeger, Aggerhof 6. hinten: Edith Hartung, Aggergasse 7. vorne: Edith Lohmar, Neuhonrath 8. hinten: Lotti Schiffbauer geb. Fischer, Kreuznaaf 9. vorne: Erika Schiffbauer, Emmersbach 10. hinten: Erika Peters, Wahlscheid 11. Lehrer Brinkmann 12. vorne: Addi Roller geb. Fischer, Aggerhof 13. hinten: Ruth Bienenstein geb. Mylenbusch, Müllerhof 14. Friedei Daniel, Aggerhof 15. Hilde Erbes geb. Lohmar, Müllerhof 16. Margot Weber, Aggerhof Noch im 19. Jahrhundert waren in Wahlscheid viele himmelblau leuchtende Flachsfelder zu sehen. Anbau, Ernte und Verarbeitung waren sehr mühsam. Die Bauemfamilie wurde damit aber in die Lage versetzt, nach dem Spinnen des Fasermaterials selbst Kleiderstoffe, Leib- und Bettwäsche zu weben. Geld für fertige Handelsstoffe konnte man sich nicht erlauben auszugeben. Das Spinnrad kam in den Wintermonaten nicht aus der Stube. Während die Männer beim Licht der Petroleumlampe „nöberten“, saßen die Frauen am Spinnrad. Flachs, Wolle und Hanf wurden gesponnen. | |
|
1930
- 1939 Hermann Wasser befindet sich in seiner Arbeitsküche. Ein Zwerghuhn und eine Katze sitzen auf seinen Oberschenkeln. Eine 2. Katze bevorzugt ein warmes Plätzchen auf dem Ofen. Alles spielte sich in dieser Arbeitsküche, die gleichzeitig Flur war, ab. U... Hermann Wasser befindet sich in seiner Arbeitsküche. Ein Zwerghuhn und eine Katze sitzen auf seinen Oberschenkeln. Eine 2. Katze bevorzugt ein warmes Plätzchen auf dem Ofen. Alles spielte sich in dieser Arbeitsküche, die gleichzeitig Flur war, ab. Unter dem Ofen sehen wir Reisig (Anmachholz) und hinter dem Melkschemel „Stommele“. Dazu mehr im letzten Teil dieser Bildbeschreibung, die im Hinblick auf die Person des Hermann W., ein damaliges „Original“, etwas ausführlicher ist. Auch die auf dem Bild zu sehenden Gegenstände erfordern eine ausführliche Darstellung. Hermann W. hatte „jet en de Maue“ (kräftige Muskeln). Auf einem Jahrmarkt hatte er den Kampf mit einem Bären aufgenommen und diesen niedergerungen. Seitdem hieß er „de Bär“. Nach dem 1. Weltkrieg hatte er eine zeitlang in Rußland gearbeitet und sich eine schwere Kopfverletzung zugezogen. Auf dem Bild sieht man das Loch an der rechten Schläfe. Eine besondere Kopfbedeckung und die Lage der Brille im unteren Bereich der Nase waren für ihn typisch. Neben der „Bärenstärke“ zeichneten ihn Fleiß und Sparsamkeit aus. Er arbeitete im wahrsten Sinne des Wortes Tag und Nacht. Ältere Mitbewohner erzählten, daß Hermann erst nachts dazu kam, seine Kühe am Sprengbüchel zu melken. Man hörte dann das Vieh „bälleken“ (brüllen). Die Eheleute Max Steeger, Agger, erzählten, daß sie hören konnten, wenn Hermann nachts oben auf seiner Weide die Kühe melkte, weil dies nicht ohne Schimpfen mit dem Vieh abging. Meistens soll es sich für Hermann nicht gelohnt haben, sich für das Nachtlager auszuziehen. Seine Körperkraft war so groß, daß es für ihn kein Problem war, mit dem „Äsel“ (Tragbalken) zentnerschwere Last in Form von Thomasmehl bergauf zum Sprengbüchel zu tragen. Hermann W. war zwar „kniestig“, aber sehr gastfreundlich. P.J. Schönenstein, Holl, der als junger Mann für Hermann pflügte, und die Geschwister Prinz in Schachenauel: Seine Gäste mußten in der Arbeitsküche, in der sich alles abspielte, auf Holzklötzen Platz nehmen. Nebenbei betätigte sich H. auch als Bankier. Sein Fleiß und seine Sparsamkeit hatten ihn in den 1930er Jahren in die Lage versetzt, Geld zu guten Zinsen auszuleihen. | |
Otto Stöcker, Grünenbom: Die Pferde-Spediteure (u.a. Lindenberg in Oberhaus, Wilhelm Naaf in Neuheim, Emst Breideneichen in Oberstehöhe, Gustav Hohn in Aggerhof und Wilhelm Mylenbusch im Müllerhof) fuhren regelmäßig mit landwirtschaftlichen... Otto Stöcker, Grünenbom: Die Pferde-Spediteure (u.a. Lindenberg in Oberhaus, Wilhelm Naaf in Neuheim, Emst Breideneichen in Oberstehöhe, Gustav Hohn in Aggerhof und Wilhelm Mylenbusch im Müllerhof) fuhren regelmäßig mit landwirtschaftlichen Produkten und Klein-Schlachtvieh auf ihren „Köllen-Kaare“ zum Markt nach Köln. Unterwegs stippten sie an einigen Stellen auf. Die Pferde kannten den Weg, so daß sich die Kutscher zeitweise auf den Karren zum Schlafen legen konnten. Spät am Abend – meist im Dunkeln – kamen sie, mit „Winkelswaren“ für die vielen „Tante Emma-Läden“ in Wahlscheid beladen, nach Hause. | |
Fritz Kaufmann (links neben der Karre), Atzemich (Dorpmühle), als Fuhrunternehmer beim Beladen seiner „objestippten Schlaachkaar“ mit Steinen Fritz Kaufmann (links neben der Karre), Atzemich (Dorpmühle), als Fuhrunternehmer beim Beladen seiner „objestippten Schlaachkaar“ mit Steinen | |
Personen – von links: 1. Siegmund Heimann; 3. Friedchen Heimann; 6. Berta Lindenberg geb. Heimann, später wohnhaft in Münchhof; 7. Laura Heimann Der Rapsanbau ging zurück, als das Petroleum seinen Einzug hielt. Den Sichelschnitt übernahmen die... Personen – von links: 1. Siegmund Heimann; 3. Friedchen Heimann; 6. Berta Lindenberg geb. Heimann, später wohnhaft in Münchhof; 7. Laura Heimann Der Rapsanbau ging zurück, als das Petroleum seinen Einzug hielt. Den Sichelschnitt übernahmen die Frauen, obwohl sie zu Hause im Haushalt und Stall viel „Brassel“ (Unruhe) hatten. Ihnen ging diese Arbeit gut von der Hand. Es mußte hart „jevrößelt“ (geschuftet) werden,zumal man diese Arbeit in tiefgebückter Haltung bei meist glühender Sonne und in – damals noch – knöchellangen Kleidern verrichten mußte. Es war kaum ein Unterschied zur heutigen Kleidung der Nonnen festzustellen. Vorsichtig mußten die Frauen mit der Sichel zu Werke gehen, um die Frucht zu erhalten. Wenn wir heute Bilder aus der früheren Zeit sehen, wundem wir uns, daß die damals 60jährigen bereits einen gebrechlichen Eindruck machten. Die damalige harte Arbeit zeigte ihre Wirkung. Die Menschen „kröötschten“ (kränkelten) bereits sehr früh. | |
|
1930
- 1939 Wilhelm Remerscheid (später umbenannt in Riemscheid) in den 30er Jahren heim Pflügen in Scheid. „Baacher“ K.H. Zimmermann: Ein früherer Landwirt aus Schiffarth trank auch tagsüber gern beim Pflügen auf dem Feld einen Schnaps. Wenn er „kene Dooch... Wilhelm Remerscheid (später umbenannt in Riemscheid) in den 30er Jahren heim Pflügen in Scheid. „Baacher“ K.H. Zimmermann: Ein früherer Landwirt aus Schiffarth trank auch tagsüber gern beim Pflügen auf dem Feld einen Schnaps. Wenn er „kene Dooch mih hat“ (keine Lust mehr hatte), buddelte er die am Furchenende deponierte Schnapsflasche aus dem Erdreich. Früher sah man den Bauern – mit der Pfeife im Mundwinkel „Hot“ und „Har“ rufend, auf dem Feld hinter dem Pflug oder der Egge, die gemächlich von Pferd, Ochse oder Kuh gezogen wurden, hergehen. Wenn der Bauer mit dem Zugtier aufs Feld zog, verabschiedete er sich mit den Worten: „Bös hell“ (Bis gleich). Mittags hielten die meisten Bauern „en Ennongde“ (kurzes Schläfchen). Die Arbeit mit der Egge war nicht einfach. Wenn sich Unkraut festgesetzt hatte, mußte die Egge hochgehoben und gereinigt werden. Auch mit dem Streuen von Mineraldünger bzw. Thomasschlacke „murkste sech de Buur av“ (rackerte sich der Bauer ab). Mitunter hatte der Bauer 30 Pfund am Hals hängen und das über Stunden. Wer mit dem Ochsen arbeitete, mußte in einer ausgeglichenen Gemütslage sein. | |
|
1920
- 1929 Wenn bei großer Hitze die Fliegenplage zu groß wurde, streifte der Bauer dem Ochsen oder dem Pferd ein „Drömm“ (eine Art Fliegennetz) über den Kopf. Im Hintergrund sieht man Linden (Honrath). Bei dem „Fetz“ (kleiner Junge) handelt es sich um Franz... Wenn bei großer Hitze die Fliegenplage zu groß wurde, streifte der Bauer dem Ochsen oder dem Pferd ein „Drömm“ (eine Art Fliegennetz) über den Kopf. Im Hintergrund sieht man Linden (Honrath). Bei dem „Fetz“ (kleiner Junge) handelt es sich um Franz Oberhäuser, früher Linden, heute Rodderhof. Karl Kürten hatte offenbar aus dem 1. Weltkrieg einen Kommißrock mit nach Hause gebracht; er trug ihn bei der Arbeit. Das Bloch (Walze) entwickelte beim Transport über die Straße einen starken Lärm. Der Bauer, der weder ein Pferd noch einen Ochsen besaß, spannte eine Milchkuh – mit Joch oder Hamen – vor. Die Kuh gab im Falle eines Arbeitseinsatzes etwas weniger Milch und war langsamer. Wenn der Zugkuhbauer, auch „Drievkoh-Buur“ genannt, frischgemähtes Gras einfahren mußte, spannte er die Zugkuh erst gar nicht ein, sondern brachte das Gras mit der Schubkarre oder dem großen Tragtuch ein. Der Kleinbauer nutzte jedes Stückchen Land. Gab es irgendwo ein Fleckchen Wiese, „pöhlte“ er ein Kalb an. Auch die „Over“ (Wegschrägen) mähte er ab. | |
Roggenernte 1938 im „Overkierspel“ in Oberstehöhe, dem sogenannten „Hafer-Spanien“, mit „Seech“ und „Matthöch“. Personen von links: 1. mit Schnäuzer und „Schwengel“ (Pfeife): August Lindenberg, Kern 4. Paula Wasser, Hähngen 5. Hedwig Frackenpohl... Roggenernte 1938 im „Overkierspel“ in Oberstehöhe, dem sogenannten „Hafer-Spanien“, mit „Seech“ und „Matthöch“. Personen von links: 1. mit Schnäuzer und „Schwengel“ (Pfeife): August Lindenberg, Kern 4. Paula Wasser, Hähngen 5. Hedwig Frackenpohl geh. Fischer, Oberstehöhe Auf dem „Kloppstohl met Ampes“ sehen wir Winand Frackenpohl, Oberstehöhe, beim Dengeln (Kloppen) der Seech. Enkel Kurt Frackenpohl schaut ihm zu. Keiner konnte so gut wie die Alten dengeln. Die Getreideernte mit „Seech“, einer Kniesense, und dem „Matthöch“ (Eisenhaken mit Holzgriff) war mühsam. Mit dem Haken an der linken Hand brachte der Bauer das abzuschneidende Getreide in eine günstige Lage und schlug es mit der Seech an der rechten Hand ab. | |
Man war schon fortschrittlich und setzte eine Mähmaschine, auf der Rudolf Stöcker, Röttgen sitzt, ein! Im Hintergrund ist Hausen erkennbar. Da der Ochse gegenüber dem Pferd schwerfälliger war, mußte er – hier von Karl Stöcker, Schönenberg – bei... Man war schon fortschrittlich und setzte eine Mähmaschine, auf der Rudolf Stöcker, Röttgen sitzt, ein! Im Hintergrund ist Hausen erkennbar. Da der Ochse gegenüber dem Pferd schwerfälliger war, mußte er – hier von Karl Stöcker, Schönenberg – bei vielen Arbeiten geführt werden. | |
Personen von links: 1. Frieda Stelzer geb. Stoßberg, Mailahn 2. Karl Maylahn, Rothehöhe 3. Landjahrjunge Das Laden der „Schobben“ (Getreidegarben), die auf dem Feld zu „Huustem“ (Haufen) zusammengestellt waren, verlangte Können. Mit der... Personen von links: 1. Frieda Stelzer geb. Stoßberg, Mailahn 2. Karl Maylahn, Rothehöhe 3. Landjahrjunge Das Laden der „Schobben“ (Getreidegarben), die auf dem Feld zu „Huustem“ (Haufen) zusammengestellt waren, verlangte Können. Mit der „Schößjaffel“ (zweizinkige Gabel) reichte man die Garben hoch. Beim Binden der Garben drangen oft Disteln, die man im Frühjahr versucht hatte auszustechen, in die Hände. Auch an den Stoppeln konnte man sich die Fingerspitzen blutig stoßen. Unangenehm war die „Spieß“ der Gerste, die widerhaarig war und unter die Kleidung drang. Der Bauer fuhr das Getreide in „et Schüüredänn“ (Scheunentenne) und „stivvelte“ (stapelte) es „em Wesch“ und in dem Raum oberhalb der Tenne, genannt „Schleeß“, einem Gefach aus Holzstangen. Wenn der Bauer nach der Ernte die Ähren nicht einsammelte, taten dies die Armen aus dem Dorf. | |
Das Scheunentor, das vom „Prengel“ verriegelt wurde, ist weit geöffnet. Das Scheunentor, das vom „Prengel“ verriegelt wurde, ist weit geöffnet. Max Wasser kam damals mit der Lohn-Dreschmaschine. Die Nachbarn halfen beim Garbenreichen und Strohtransport, damit „et rühmte“.Die Genossenschaft in Wahlscheid erwarb Anfang der 1950er Jahre eine Dreschmaschine, die Otto Stöcker, Grünenbom, bediente und die Walter Zimmermann, Auelerhof, mit seinem Traktor (der erste in Wahlscheid) zur jeweiligen Einsatzstelle fuhr. Während des Dreschvorganges wurde das Stroh draußen aufgeschichtet. Wenn die Maschine die Scheune verlassen hatte, kam es innen auf die „Schleeß“. Alte Dreschmaschinen wurden noch mit einem Göpel betrieben. Die Zugtiere, die draußen auf dem Göpelplatz fortwährend im Kreis rundgingen, trieben ihn an. Aber auch den „Flähn“ (Dreschflegel) konnte man in Wahlscheid noch einige Jahre nach dem 2. Weltkrieg im „Schüüredänn“ (Scheunentenne) hören. Das Dreschen mit dem Flegel übernahmen oft 2 oder 3 Männer gemeinsam. Dabei schlugen sie gleichmäßig im Takt auf die ausgebreiteten Garben, so daß sich eine gewisse Musikalität entwickelte. Es war harte Arbeit, die hungrig machte. Daher heißt es heute noch: „Äe iss wie ne Schüüredrescher.“ (Er ißt wie ein Scheunendrescher) Nach dem Dreschen wurde das Stroh zu einem „Buusch“ gebunden. Die auf dem Boden liegenden Körner mußten noch vom „Kaaf ’ (Spreu) gereinigt werden. Das machte der Bauer mit der „Wann“, einer Korbschale, die er auf- und abwärts bewegte; er „flappte“. Dabei wurde die Spreu vom Weizen getrennt. Noch heute sagt man: „Du Wannläpper“ oder „Du Flappmann“. In der Scheune lagerten früher nicht nur Getreide und Heu, sondern auch Eichenbohlen. Wenn ein Mitglied der Bauemfamilie starb, griff man auf diese Eichenbohlen zurück, um einen Sarg zu zimmern. | |
|
1850
Intensiver Betrieb fand statt auf der Grube Hasenberg, im östlichen Teil der Gemeinde Wahlscheid an der Grenze zu Overath gelegen mit mehreren Grubengängen. Tätigkeit: ca. 1850–1867 Die Schließung erfolgte u.a., weil man mit den Wasserzuflüssen in... Intensiver Betrieb fand statt auf der Grube Hasenberg, im östlichen Teil der Gemeinde Wahlscheid an der Grenze zu Overath gelegen mit mehreren Grubengängen. Tätigkeit: ca. 1850–1867 Die Schließung erfolgte u.a., weil man mit den Wasserzuflüssen in den Stollen nicht fertig wurde. Im benachbarten Fuchssiefen wurde in den Jahren 1855/57 eine Aufbereitungsanlage angelegt. Von der Bergbautätigkeit sind noch Halden, zubetonierte Stolleneingänge, Bruchsteinsockel von früheren Betriebsstätten und trichterförmige Vertiefungen von eingestürzten Schächten und Stollen zu sehen. | |
|
1914
Von 1907 bis zur Schließung im Jahre 1918 drang man bis auf eine Tiefe von 190 m vor. Zeitweise wurden 85 (im Jahre 1914) Arbeitnehmer beschäftigt. Die Grube war für die Wirtschaftskraft unseres Raumes von Bedeutung. Viele Männer konnten sich im... Von 1907 bis zur Schließung im Jahre 1918 drang man bis auf eine Tiefe von 190 m vor. Zeitweise wurden 85 (im Jahre 1914) Arbeitnehmer beschäftigt. Die Grube war für die Wirtschaftskraft unseres Raumes von Bedeutung. Viele Männer konnten sich im Nebenerwerb zusätzlich zu ihrer Kleinst- Landwirtschaft etwas hinzuverdienen. Das Adressenverzeichnis von 1910 der Bürgermeisterei Wahlscheid enthielt 28mal die Berufsbezeichnung „Bergmann“. Da das Adressenverzeichnis nur die Haushaltsvorstände enthielt und nicht die unverheirateten arbeitenden Söhne, wird die Gesamtzahl der Bergleute viel größer gewesen sein. Das Wasser zur Reinigung des geforderten Materials entnahm man den Stauweihern, die vom Kirchbach und vom Wasser aus den Stollen aufgefüllt wurden. Waschmeister war J. Clever aus Wahlscheid. | |
|
1914
Die Grube lag bei Kleineigen, dicht hinter der Gemeindegrenze zu Wahlscheid. Hier hatte man bereits im 19. Jahrhundert Bergbau betrieben. Wie bei der Grube Aurora auf der anderen Seite des Bahntunnels hatte man auch auf Anacker (beide Gruben standen... Die Grube lag bei Kleineigen, dicht hinter der Gemeindegrenze zu Wahlscheid. Hier hatte man bereits im 19. Jahrhundert Bergbau betrieben. Wie bei der Grube Aurora auf der anderen Seite des Bahntunnels hatte man auch auf Anacker (beide Gruben standen im Eigentum einer Gesellschaft) die Arbeiten 1904, als man beim Tunnelbau auf Erzadem stieß, wieder aufgenommen. Einige Männer auf dem Bild konnten noch identifiziert werden. Jeweils von links: sitzend: 2. Wilhelm Bender, Scheid; 3. Wilhelm Remerscheid, Oberscheid; 4. Emst Schiffbauer, Hoffnungsthal-Stöcken; 5. Lindenberg, Durbusch 1. Reihe stehend: 6. Julius Bilke; 10. August Lindenberg, Heiden; 11. W. Weber, Scheid; 12. H. Haas, Schachenauel; 13. Wilhelm Lohmar, Boddert; Junge auf dem Pferd: Karl Blech, Höhnchen; ganz oben: 7. Karl Lindenberg, Wickuhl | |
Rechts neben dem Schlachter (Mylenbusch, Haus Dorp oder Lindenberg, Münchhof?) sehen wir den Buchhalter Lange. Bei der Dame handelt es sich um Frau Emma Trier. Im Souterrain des Haupthauses befanden sich die Büroräume der Grube. Als die Familie des... Rechts neben dem Schlachter (Mylenbusch, Haus Dorp oder Lindenberg, Münchhof?) sehen wir den Buchhalter Lange. Bei der Dame handelt es sich um Frau Emma Trier. Im Souterrain des Haupthauses befanden sich die Büroräume der Grube. Als die Familie des Obersteigers Trier auszog, bezog die Familie Manchen das Haus. Danach nutzte von ca. 1929–1938 die Familie Emst Kürten, die vorher in dem im Kirchbachsiefen stehenden Fachwerkhaus (heutiger Besitzer: W. Wilhelms) wohnte, das Objekt. Seit 1938 und nach erfolgtem Um- und Anbau bewohnt die Familie Rausch das Haus. Links auf dem Bild ist noch ein Esel mit einem Karren erkennbar. Die Zeitzeugin Sybille Klug berichtete, daß der letzte Esel auf der Grube Pilot zu Hühnerfutter verarbeitet wurde. Frau Rausch, jetzige Bewohnerin des Hauses, berichtete, daß das Gebäude infolge der unter Tage zusammenbrechenden Stollen immer noch in Bewegung ist. Es bilden sich weiterhin Risse. Elfriede Keller geb. Kürten hat erlebt, wie in den 30er Jahren sich eines Tages mit gewaltigem Gepolter ein großes mehrere Meter tiefes Loch vor dem Haus auftat. Offenbar war ein alter Bergwerksstollen von dem früheren Bergwerk eingestürzt. Die Wäsche, die die Mutter vor dem Haus zum Trocknen aufgehängt hatte, lag tief unten in der Erde. | |
Der unverheiratete August Piel war Totengräber und Friedhofswärter in Honrath (“Graavmächer“). Er betätigte sich darüber hinaus als Waldhüter und Imker, schnitt Haare und tapezierte. Pfarrer Dahm, Honrath, hat in seiner Schrift „ev. Kirche Honrath“... Der unverheiratete August Piel war Totengräber und Friedhofswärter in Honrath (“Graavmächer“). Er betätigte sich darüber hinaus als Waldhüter und Imker, schnitt Haare und tapezierte. Pfarrer Dahm, Honrath, hat in seiner Schrift „ev. Kirche Honrath“ schon einige Anekdoten gebracht. Zum Beispiel: Die Ersten bei der Auferstehung Beim Ausheben der Gräber setzte August seine Muskelkraft nur sparsam ein. Eines Tages hatte er Besuch vom Bürgermeisteramt, das die Ordnungsmäßigkeit der Bestattungen kontrollierte. Es wurde festgestellt, daß die Gräber grundsätzlich nicht tief genug ausgehoben waren. Der Beamte stellte August zur Rede, worauf er antwortete: „Dann sen die Hônderter bei däe Auferstehung och et iesch dôbei.“ (Dann sind die Honrather bei der Auferstehung auch zuerst dabei.) | |
Die beiden, die krankheitsbedingt etwas „kohlderich“ (nicht gut beieinander) waren, sagten immer (ins Hochdeutsche übersetzt): Hilferufe aus dem Siefen: Die beiden, die krankheitsbedingt etwas „kohlderich“ (nicht gut beieinander) waren, sagten immer (ins Hochdeutsche übersetzt): Hilferufe aus dem Siefen: Langes Suchen nach der Pfeife: Erst nach einigen Tagen mit dem „Auslöffeln“ des letzten Suppenrestes fanden sie die Pfeife, auf dem Boden des Topfes liegend. Der Grund für die braune Färbung der Suppe war geklärt. | |
|
1930
- 1939 Als offizielle Berufsbezeichnung nannte Daniel stets „Salzhändler“. Er saß meist neben seinem Salzvorrat und trank aus einer Flasche Bier. Das viele Biertrinken begründete er mit dem Hinweis: „Der Handel mit Salz macht durstig.“ Daniel, der... Als offizielle Berufsbezeichnung nannte Daniel stets „Salzhändler“. Er saß meist neben seinem Salzvorrat und trank aus einer Flasche Bier. Das viele Biertrinken begründete er mit dem Hinweis: „Der Handel mit Salz macht durstig.“ Daniel, der kinderlos verheiratet war, hatte es sehr schwer in seinem Leben. Seine Ehefrau war in den letzten Lebensjahren ständig in einer Heilstätte. Für die Pflegekosten hatte er aufzukommen. Aber die Einkünfte waren so bescheiden, daß sie nur zur Bestreitung des eigenen Lebensunterhalts ausreichten. Bemerkenswert war seine Intelligenz, mit der er manche schwierige Situation gut zu meistern wußte. Daniel entstammte einer Handwerker- und Kaufmannsfamilie. Vater und Opa waren die hiesigen Schomsteinfegermeister, der Bruder war Großhandelskaufmann. Hier ist eine Anekdote: | |
Johann Sleeger, genannt: „Et Johännchen“ – auch als „Maarsteeger’s Johann“ bekannt. „Et Johännchen“ verkaufte an den Haustüren selbstgebundene Reisig-Besen. Offenbar hatte ihm ein Kunde eine Tasse Kaffee und ein Butterbrot gegeben und ihn dabei... Johann Sleeger, genannt: „Et Johännchen“ – auch als „Maarsteeger’s Johann“ bekannt. „Et Johännchen“ verkaufte an den Haustüren selbstgebundene Reisig-Besen. Offenbar hatte ihm ein Kunde eine Tasse Kaffee und ein Butterbrot gegeben und ihn dabei fotografiert. „Et Johännchen“ war „ne äerme Schlubbes“ (armer Schlucker). Als 9jähriges Kind war er von einer Gehirnhautentzündung befallen worden. Sie hatte eine geistige Behinderung (Stand eines Neunjährigen) zur Folge. Er war sehr fleißig und hatte auch Erfolge bei seinen Bemühungen, als Hausierer an der Haustür selbstgefertigte Reisig-Besen zu verkaufen. Allerdings ließen sich die kaufenden landwirtschaftlichen Familien vom Mitleid leiten. Wenn die älteren Wahlscheider an „Et Johännchen“ erinnert werden, ergreift sie Freude (Ausspruch: „Och et Johännchen!“) und Wehmut. Die Kunden gaben ihm meist ein zusätzliches Trinkgeld. Johännchen rief dann in ständiger Wiederholung: „Wieß Jeld, wieß Jeld...“ (Weißes Geld). Die Farbe Rot/Braun hatten – wie heute – die kleinen Geldstücke. Hatte Johännchen einmal ein Butterbrot bekommen, was ihm auch Freude bereitete, so wickelte er es in ein rotes Taschentuch. Erich Schöpe, Wahlscheid, erlebte einen Unfall des Johännchen. Wintertags gegen 17.30 Uhr saß Erich Sch. im Bürgermeisteramt Wahlscheid an seinem Schreibtisch, als ein Autofahrer aufgeregt ins Büro stürmte und mitteilte, daß draußen auf der Straße ein Mann gegen sein Auto gelaufen sei. Erich Sch. und der Fahrer liefen wieder hinaus, um Erste Hilfe zu leisten. Erich Sch. sah, daß es sich bei dem Verletzten um „Et Johännchen“ handelte. Man versuchte gemeinsam, das auf der Straße liegende Johännchen aufzurichten. Aber ein herzzerreißendes Stöhnen veranlaßte sie, das Vorhaben wieder aufzugeben. Johännchen konnte sich schon im Normalzustand nur sehr schwer verständigen; jetzt brachte er unter dem Eindruck des Schocks keinen verständlichen Ton heraus. Wie schmerzvoll die Lage für Johännchen war, erkannten die Helfenden erst etwas später. Ein Autorad stand noch auf der Fußspitze des Johännchen! Erst als der Fahrer das Auto ein Stück vorgesetzt hatte, konnte man den Verletzten aus der mißlichen Situation befreien. Der herbeigerufene Dr. Zimmermann stellte bis auf die nicht allzu schwere Verletzung der Fußspitze keine weiteren Verletzungen fest. Johännchen ist sogar noch nach Hause gehumpelt. „Am Wäldchen“ bei Schloß Auel ist Johännchen später vom Zug angefahren worden. Dabei verlor er einen Fuß. | |
|
1920
- 1929 Die alten Wahlscheider können sich erinnern, daß die Familie Schönenberg mit dem Bau von Nachen bis in das Jahr 1928 beschäftigt war. Auch die Vorfahren der Familie beschäftigten sich schon in Wahlscheid mit dem Schiffs- bzw. Nachenbau. Die... Die alten Wahlscheider können sich erinnern, daß die Familie Schönenberg mit dem Bau von Nachen bis in das Jahr 1928 beschäftigt war. Auch die Vorfahren der Familie beschäftigten sich schon in Wahlscheid mit dem Schiffs- bzw. Nachenbau. Die Kirchenbücher berichten von einem Mitte des 18. Jahrhunderts geborenen Philipp Schönenberg, der als Nachenbauer tätig war. Auf der Wiese zwischen der Agger und dem heutigen Forum befand sich eine Bodenerhebung, die mit einigen Bäumen bewachsen war. An dieser erhöhten Stelle – vor Aggerhochwasser sicher – lag die Werft. Friedchen Steinsträßer geb. Schönenberg, Wahlscheid, Tochter bzw. Enkel der letzten Nachenbauer: Ihr Opa Fritz Sch., der den Nachenbau hauptberuflich ausübte, führte noch nebenbei eine kleine Landwirtschaft mit 3 Kühen. Er war „Kuhbauer“; d.h., er mußte eine Kuh vor seine Ackergeräte und Karren spannen. Friedchen St. kann sich erinnern, als kleines Kind die „Fahrkuh“ beim Kartoffel-Ausmachen geleitet zu haben. Auch ist ihr noch in guter Erinnerung, dem Opa das 2. Frühstück um 10.00 Uhr zur „Werft“ am Aggerbusch gebracht zu haben. Der Opa war dort alleine tätig; allerdings halfen ihm seine Söhne Gustav (Bahnhofsvorsteher) und Franz in ihrer Freizeit. Nach dem Tode von Opa baute Sohn Gustav von 1922 bis 1928 noch nebenberuflich Nachen. Den letzten Nachen hatte er für sich erstellt; er sollte seiner Familie für Vergnügungsfahrten auf der Agger dienen. Schließlich verkaufte er auch diesen Nachen noch für Fahrten auf der Aggertalsperre.le Nachen wurden mit Eichenholz gebaut. Die Eichenbäume fällten die „Schönenbergs“ selbst in Wahlscheid’s Wäldern. Auch das Schneiden der Eichenbäume zu Brettern besorgten sie selbst mit der Hand. Dabei stand der eine in der vorhandenen Arbeitsgrube und der andere oben. Die lange Säge nannte man Diel-, Schrot-, Klob- oder Trummsäge (gebietsweise verschieden). Die Eichenbretter wurden in einer offenen Feuerstelle erwärmt und mit nassen Tüchern befeuchtet, wobei die Kinder halfen. Mit diesen Maßnahmen machte man die Eichenbretter beweglich; man konnte die erforderlichen Biegungen vornehmen. Die Fugen zwischen den Brettern wurden mit Moos und Werg geschlossen. Friedchen St. kann sich erinnern, daß auf dem elterlichen Speicher langfaseriges Moos zum Trocknen lag. Mit einem Stanzgerät wurden Eisenplättchen über den Fugen befestigt. Kitt und Leim wurden nicht verwandt. Der „Aacherbösch“ war auch ein Treffpunkt der Wahlscheider Männer. Es war für sie eine Freude, hier in freier Natur und schöner Umgebung ein „Verzällchen“ zu halten, ein Schnäpschen zu trinken und den Schönenbergs zuzuschauen bzw. zu helfen. | |
Ein besonderes Vergnügen war es, die Vollendung und den Stapellauf eines Nachen zu erleben. Das vorstehende Bild aus dem Jahre 1921 zeigt solch ein Ereignis. Personen: von links: 1. Gustav Schönenberg, Aggerhof; 2. Franz Schönenberg, Aggerhof; 3.... Ein besonderes Vergnügen war es, die Vollendung und den Stapellauf eines Nachen zu erleben. Das vorstehende Bild aus dem Jahre 1921 zeigt solch ein Ereignis. Personen: von links: 1. Gustav Schönenberg, Aggerhof; 2. Franz Schönenberg, Aggerhof; 3. Peter Wester, Aggerhof; 4. Karl Zimmermann, Katharinenbach; 5. Otto Hohn, Auelerhof; 6. Emil Schiffbauer, Schiffarth; 7. Franz Zimmermann, Katharinenbach; 8. Ida Zimmermann geb. Schönenberg, Aggerhof; 9. Wilhelm Zimmermann senior, Aggerhof; 10. Fritz Schönenberg junior, Aggerhof und 11. Fritz Schönenberg senior, Aggerhof. Wenn die Agger nach Regen etwas mehr Wasser führte, wurden die Nachen über Agger, Sieg und Rhein bis zum Bestimmungsort überfuhrt. Der Nachen war dann voll mit Wahlscheider Männern besetzt. Viele Nachen gingen nach Mondorf | |
|
1850
Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Industrialisierung einsetzte und auch im Aggertal die Verkehrsverbindungen (Bau der Chaussee in 1844) sich verbesserten, kam es in der Bürgermeisterei Wahlscheid zu einem kurzen Aufblühen des Bergbaues. Im übrigen... Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Industrialisierung einsetzte und auch im Aggertal die Verkehrsverbindungen (Bau der Chaussee in 1844) sich verbesserten, kam es in der Bürgermeisterei Wahlscheid zu einem kurzen Aufblühen des Bergbaues. Im übrigen wurde man durch die neuen Dampfmaschinen (Lokomobile) besser mit dem einfallenden Wasser in den Bergwerksstollen fertig. Alte stillgelegte Gruben (“Alter Mann“ in der Fachsprache genannt) aus den vorherigen Jahrhunderten erweckte man wieder zum Leben. Nachstehend kleinere Stollen (Schürfstollen), die meist lediglich zur Untersuchung von Erzgängen angelegt waren: Langschläfer: Gelegen im Kirchsiefen unterhalb Weeg. 1854 – 1855 Franziska: Oberhalb Schiffarth in Richtung Oberscheid gelegen; gearbeitet wurde in den Jahren 1853, 1866 und 1906 Tubalcin: Bei Schöpchen im Schöpchensiefen gelegen In Tätigkeit: 1853 Linie: Südlich von Honrath gelegen Germania: Südlich von Oberhaus auf dem Bergrücken (genannt „Silberkaul“) gelegen; Cöln: Im Siefen zwischen Weilerhohn und Heide gelegen. Cinna: Westlich von Höffen im Hellensiefen gelegen.
| |
|
1850
Grube Pilot mit den Gängen „Hortensia“ und „Schloofköpp“, gelegen zwischen der evangelischen St. Bartholomäus-Kirche und dem Weiler Mackenbach im Kirchbachsiefen. „Hortensia“: Betrieben von 1855–1866 Grube Pilot mit den Gängen „Hortensia“ und „Schloofköpp“, gelegen zwischen der evangelischen St. Bartholomäus-Kirche und dem Weiler Mackenbach im Kirchbachsiefen. „Hortensia“: Betrieben von 1855–1866 Mit Pferdefuhrwerken transportierte man das geförderte Material zu der bei Hasenberg/Aggerhütte gelegenen Aufbereitungsanlage im Fuchssiefen, ln der Aufbereitung reinigte man das geforderte Material von taubem Gestein. Dafür brauchte man viel Wasser. | |
|
1930
- 1939 Nach dem 1. Weltkrieg begann in Wahlscheid ein reges Badeleben. Zwei Untiefen unterhalb der Felswände am „Pastuurschloch“ und „Päädskümpel“ waren für die Badenden nicht ungefährlich. Wahlscheid’s Wirte und der Verkehrsverein setzten sich bereits... Nach dem 1. Weltkrieg begann in Wahlscheid ein reges Badeleben. Zwei Untiefen unterhalb der Felswände am „Pastuurschloch“ und „Päädskümpel“ waren für die Badenden nicht ungefährlich. Wahlscheid’s Wirte und der Verkehrsverein setzten sich bereits damals sehr für den Bau eines Freibades ein. Für die Badeplätze Turnisauel und Wahlscheid schaffte die Gemeinde gemäß Beschluß vom 11.6.1930 Ankleideräume an. Wie rege der Badebetrieb im Jahre 1929 in Wahscheid war, geht aus einem Bericht des Bürgermeisters Max Koch hervor: „Das Badeleben an der Agger wurde in den zwanziger Jahren von Jahr zu Jahr beliebter. Man sprach hier statt vom Badewesen vom Badeunwesen. Bürgermeister Max Koch von Wahlscheid schrieb im Juli 1929, daß an einem Sonntag vier Polizisten vollauf damit beschäftigt gewesen seien, die vielen Menschen an die richtigen Stellen zu dirigieren und an den Badeplätzen für Ordnung zu sorgen. Allein am Bahnhof Honrath seien 1340 Personen aus dem Frühzug gestiegen, auf dem Badeplatz bei Wahlscheid habe man 418 Personen gezählt. An zwei Bahnhöfen hätten abends 2460 Menschen ihre Heimfahrt angetreten. Der Bürgermeister war eine Strecke an der Agger vorbei gegangen und berichtete über „ein wildes Treiben“ dort: „In den Wiesen standen Autos und Motorräder. Ein großer Motorrad-Club spielte Fußball, ganze Familien und Wanderclubs lagen in den Wiesen, kochten ab und hatten Tische aufgeschlagen. Landwirte zankten sich mit den Fremden. Dabei war ein reger Badebetrieb in der Agger, teils in schamloser Weise ohne Badehose.“ | |
|
1933
Oberhalb vom Naafshäuschen war die Agger durch das „Wehr Bachermühle“ gestaut. Wilhelm Steeger, Honsbach, bewirtschafte am Badeplatz am Naafshäuschen ein „Limo-Büüdchen“. Oberhalb vom Naafshäuschen war die Agger durch das „Wehr Bachermühle“ gestaut. Wilhelm Steeger, Honsbach, bewirtschafte am Badeplatz am Naafshäuschen ein „Limo-Büüdchen“. | |
Viele Sommerfrischler spazierten über die Lindenallee zum Schloß Auel, das wegen einiger Attraktionen als Anziehungspunkt für Erholungssuchende galt. Auch viele Wahlscheider Familien spazierten am Sonntag mit den Kindern zur „Burg“ (Schloß Auel). Vo... Viele Sommerfrischler spazierten über die Lindenallee zum Schloß Auel, das wegen einiger Attraktionen als Anziehungspunkt für Erholungssuchende galt. Auch viele Wahlscheider Familien spazierten am Sonntag mit den Kindern zur „Burg“ (Schloß Auel). Von „Bürjermeester’s Matta“ (Marta Breunsbach) wußte Dr. Max Koch, Münchhof, daß deren Vater in den Jahren 1880/1890 die Lindenbäume im Auftrag der Bürgermeisterei Wahlscheid gepflanzt hatte. Fräulein Marta Breunsbach war rd. 60 Jahre treue Haushälterin bei Bürgermeister Schmitz und dessen Ehefrau in Münchhof; sie erhielt für diese treuen Dienste einen hohen Orden des Staates. | |
|
1931
Im Jahr 1117 wird bereits ein freies Gut Honrath (vermutlich die Burg) urkundlich erwähnt. Der Kirchturm, das älteste Bauwerk (12. Jahrhundert) von Honrath, war früher ein Bergfried und ist erst Mitte des 19. Jahrhunderts anläßlich einer Erweiterung... Im Jahr 1117 wird bereits ein freies Gut Honrath (vermutlich die Burg) urkundlich erwähnt. Der Kirchturm, das älteste Bauwerk (12. Jahrhundert) von Honrath, war früher ein Bergfried und ist erst Mitte des 19. Jahrhunderts anläßlich einer Erweiterung in die Kirche einbezogen worden. Ein gemeinsamer Wall und tiefer Graben schützten Bergfried und Burg.In Höhe des ersten Geschosses bestand früher eine Verbindung zwischen Kirche und Burg. Der heutige Bau der Burg stammt hauptsächlich aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Er steht auf Kellermauem, die viel älter sind. Möglicherweise bestanden die Kellermauem bereits 1209. Links von der Burg unter der hohen Linde stand früher eine Bank. Hier traf sich am Samstag die Dorfjugend zum gemeinsamen Singen. Rechts ist ein Teil des Brandweihers, ein besserer „Mestepohl“, erkennbar. Als die Dächer der beiden Türme renovierungsbedürftig wurden, baute man sie aus Kostengründen zu einfachen Spitzdächem um. | |
|
1914
Die Familie von Ley machte im 18. Jahrhundert Stiftungen im Zusammenhang mit der Errichtung der St. Mariä Himmelfahrt-Kirche Neuhonrath und erhielt ein Patronatsrecht. Gemeinsam mit dem Besitzer des freien Rittersitzes Auel konnte die Familie von Ley... Die Familie von Ley machte im 18. Jahrhundert Stiftungen im Zusammenhang mit der Errichtung der St. Mariä Himmelfahrt-Kirche Neuhonrath und erhielt ein Patronatsrecht. Gemeinsam mit dem Besitzer des freien Rittersitzes Auel konnte die Familie von Ley die Pfarrer von Neuhonrath bestimmen. Brigitte Gerdes-Bäcker, Honsbach: In der rechten Haushälfte ist im Keller noch ein Teil des Gewölbes der früheren – dem hl. Johannes geweihten – Kapelle vorhanden. Hier fanden nach der Reformation in der Zeit von 1710 bis 1716 die katholischen Christen wieder ein neues Zuhause. Ein Totalumbau (u.a. Aufstockung) des Gebäudes erfolgte in den 1930er Jahren.
| |
|
1914
- 1918 ln Neuemühle, wo wahrscheinlich erstmals im 18. Jahrhundert gesiedelt worden sein dürfte, lebten im Jahre 1875 in 2 Wohnhäusern 9 Personen. Eigentümer der „Neue Mühle“ in 1872: Wilhelm Steinsträßer Rechts sieht man den Mühlenteich. Im Tiefgeschoß... ln Neuemühle, wo wahrscheinlich erstmals im 18. Jahrhundert gesiedelt worden sein dürfte, lebten im Jahre 1875 in 2 Wohnhäusern 9 Personen. Eigentümer der „Neue Mühle“ in 1872: Wilhelm Steinsträßer Rechts sieht man den Mühlenteich. Im Tiefgeschoß des Fachwerkhauses befand sich das oberschlächtige Mühlenrad. Hier lief das Bachwasser von oben in die Schaufelfacher des Mühlrades. Die Fächer füllten sich, wurden schwer, drückten nach unten und setzten somit das Mühlrad in Bewegung. Wenn ein Mühlbach starkes Gefälle hatte, traf man in der Regel ein unterschlächtiges Mühlrad an. Vorhanden waren zwei Mühlsteine. Es wurde Schrot für Viehfutter gemahlen. Wilhelm Naaf, Aggerhof, schärfte von Zeit zu Zeit die Mühlsteine. Unter großer Staubentwicklung behaute er die Steine; d.h., er machte die Rillen wieder scharf. Das „Müllejässchen“ führte am heutigen Haus Dunkel vorbei direkt in die Mühle.
| |
|
1910
Es ist durchaus möglich, daß es sich bei dieser Mühle – wie der Name schon sagt – um eine zur Burg Haus-Dorp gehörende Mühle handelte. Hier vereinigen sich die beiden von Weeg und Haus-Dorp kommenden Siefen. Die beiden durch die Siefen fließenden... Es ist durchaus möglich, daß es sich bei dieser Mühle – wie der Name schon sagt – um eine zur Burg Haus-Dorp gehörende Mühle handelte. Hier vereinigen sich die beiden von Weeg und Haus-Dorp kommenden Siefen. Die beiden durch die Siefen fließenden Bäche tragen den Namen Atzenbach (in Platt: „Atzemich“). Im Volksmund hieß die Hofanlage Dorp-Mühle stets „Atzemich“. Vor dem Haus sehen wir die Eheleute Kaufmann, Wilhelm und Mathilde geb. Steeger mit ihren Kindern – von links: 1. Christian; 2. Marta verh. Stöcker, später Unterstesiefen; 3. Willi; 4. Emma verh. Scharrenbroich, später Overath, und 5. Erna verh. Schmitz, später Höfferhof; es fehlt der Sohn Fritz. 1919 wurde das Haus total erneuert und aufgestockt. Offenbar hatte Wilhelm K. in der Notzeit des 1. Weltkrieges mit den Erträgen aus der Mühle ausreichende Ersparnisse für den Totalumbau gebildet. | |
|
1935
Das Mühlrad rechts wurde von den beiden aus Richtung Weeg und Haus-Dorp kommenden Bächen (jeweils Atzenbach) angetrieben. Sie wurden vor der Mühle in je einer Kluhs gestaut. Karl Otto Kaufmann, der heutige Eigentümer: Das Wasser reichte... Das Mühlrad rechts wurde von den beiden aus Richtung Weeg und Haus-Dorp kommenden Bächen (jeweils Atzenbach) angetrieben. Sie wurden vor der Mühle in je einer Kluhs gestaut. Karl Otto Kaufmann, der heutige Eigentümer: Das Wasser reichte normalerweise für einen Mahlbetrieb von 4-6 Stunden (Es war also kein „Donnerwetter’s-Mühlchen“). In dem von Haus-Dorp kommenden Siefen steht heute noch ein in Betrieb befindliches „Kloppmännchen“ das Wasser nach Höfferhof zum Hause Menge drückt. Das Mühlrad trieb über eine Kette auch eine Dreschmaschine an. In dem unterhalb der Mühle befindlichen Anbau, aus dem ein hoher Schornstein emporragt, befand sich links das „Backes“ (Backhaus) und rechts der „Druchöven“. Durch die Tür im Anbau verschwanden die Bauern in der schlechten Zeit während des 1. Weltkrieges und in der Zeit danach mit „schwarzem“ Getreide und Mehl. | |
|
1930
- 1935 Auf dem Kastenwagen steht Johann Miebach, Honsbach. Beim Füttern der „Hohnder“ sieht man Hilde Schwarzrock geh. Blasberg. Josef Stocksiefen jun. kaufte Anfang der 1940er Jahre die Mühle von Baron La Valette. Vorherige Eigentümer bzw. Pächter waren:... Auf dem Kastenwagen steht Johann Miebach, Honsbach. Beim Füttern der „Hohnder“ sieht man Hilde Schwarzrock geh. Blasberg. Josef Stocksiefen jun. kaufte Anfang der 1940er Jahre die Mühle von Baron La Valette. Vorherige Eigentümer bzw. Pächter waren: In 1644 Erbengemeinschaft Rurich Wiessmanns, Johann Kortenbach und Heinrich Leyen; in 1831 Wilhelm Kochner; in 1872 Wilhelm Frackenpohl und ab ca. 1894 Josef Stocksiefen sen.. | |
|
1920
Der Bergrücken westlich von Jexmühle in Richtung Hove trägt die Flurbezeichnung „Auf der Hohenburg“. Auch die vorhandenen Bodenerhebungen lassen darauf schließen, daß hier einmal eine Burg gestanden hat. Die Mühle ist inzwischen zu einem Wohnhaus... Der Bergrücken westlich von Jexmühle in Richtung Hove trägt die Flurbezeichnung „Auf der Hohenburg“. Auch die vorhandenen Bodenerhebungen lassen darauf schließen, daß hier einmal eine Burg gestanden hat. Die Mühle ist inzwischen zu einem Wohnhaus umgebaut. Frühere Eigentümer der Jexmühle: Farn. Ley, Overath; in 1644 Farn, von Lüninck zu Honrath und danach Hans Christoffel von Hammerstein. In 1872 war Karl König Eigentümer. In diesem Jahrhundert erwarben die Geschwister Otto, Honrath, die Mühle. | |
|
1930
- 1939 Nach dem Bau der Eisenbahnlinie (1884) kamen viele Stadtbewohner zur Sommerfrische nach Wahlscheid. Die Wahlscheider Gastwirte hatten – wie auf alten Ansichtskarten zu sehen ist- dem Ort Wahlscheid sogar den Titel „Luftkurort“ verliehen. Im... Nach dem Bau der Eisenbahnlinie (1884) kamen viele Stadtbewohner zur Sommerfrische nach Wahlscheid. Die Wahlscheider Gastwirte hatten – wie auf alten Ansichtskarten zu sehen ist- dem Ort Wahlscheid sogar den Titel „Luftkurort“ verliehen. Im Hintergründ sieht man die Häuser der Familien Wasser und Heinen. Bei der Betrachtung des Bildes wird man etwas an Versailles erinnert. Gastwirt Hermann Schiffbauer hatte zum Unterbringen seiner zahlreichen Gäste sogar die Pensionshäuser (Dependancen) „Emmy“ (neben dem Auelerhof) und „Olga“ erworben bzw. gebaut. | |
Links steht die Oma Maylahn, rechts deren Tochter Julchen und in der Mitte Enkel Martha. Die auf dem Hof stehende „Mestekaar“ (Mistkarre) ist mit 2 „Kaarstip- pen“ aufgestippt. Links neben dem Haus steht ein Wagen-Fahrgestell, mit dem man Holzstämme... Links steht die Oma Maylahn, rechts deren Tochter Julchen und in der Mitte Enkel Martha. Die auf dem Hof stehende „Mestekaar“ (Mistkarre) ist mit 2 „Kaarstip- pen“ aufgestippt. Links neben dem Haus steht ein Wagen-Fahrgestell, mit dem man Holzstämme aus dem Wald schleifen konnte. Auf dem Hof laufen die „Hohnder“ (Hühner) und „Piepjer“ (junge Hühner). Rechts von der Stall-“Poez“ (Tür) sieht man eine Hühnerleiter zum „Hohndersch“ (Hühnerstall) führen. Auf diese Weise war das wertvolle Federvieh vor dem Fuchs gesichert. Die Hausfrau legte bis zu 3 Porzellaneier in ein Hühnemest. Das Eierlegen wurde dadurch angeregt und das Fremdlegen an anderen Stellen (z.B. in der Scheune) etwas eingeschränkt. Trotzdem kamen häufig im Frühjahr – für die Bauersleute überraschend — „Klotzen“ mit frisch ausgeschlüpften Küken über den Hof stolziert; in irgendeinem Versteck hatte die „Klotz“ die Eier ausgebrütet. Über die Schwelle der Haustür trug der Bräutigam seine Braut ins Haus. Die Verstorbenen wurden über sie aus dem Haus gebracht. | |
Folgende Eigentümer des ehemaligen Rittersitzes sind bekannt: Ende des 15. Jahrhunderts: Familie Ma[e]rkelsbach, genannt Allner 16. Jahrhundert: Nachkomme der o.a. Familie, verehelicht mit Wilhelm von Gülich, dem Amtmann von Blankenberg (diese... Folgende Eigentümer des ehemaligen Rittersitzes sind bekannt: Ende des 15. Jahrhunderts: Familie Ma[e]rkelsbach, genannt Allner 16. Jahrhundert: Nachkomme der o.a. Familie, verehelicht mit Wilhelm von Gülich, dem Amtmann von Blankenberg (diese Familie war reformiert). bis in das 18. Jahrhundert: Familie von Gülich (zwischen 1767 und 1785 wechselte der Besitzer mehrmals) a) Gottlieb Ludwig Josef von Leers auf Haus Leerbach, b) Anselm von Spies zu Büllesheim, c) Eheleute Ludwig Wilhelm Wackerzapp und Maria Elisabeth geb. Fuchs Vorübergehend war auch Antonetta Franziska d’Alvarado, Ehefrau des Reichsfreiherr Franz Edmund von Reuschenberg, churfürstlicher Geheimrat, Eigentümerin. nach 1787: Johann Rütger Siebel, Bürgermeister der Stadt Elberfeld nach 1825: Familie Johann Steeger seit Ende des 19. Jahrhunderts: Familien Steinsträßer/Wasser und Farn. Julius Fischer. Herr Bürgermeister Siebel, Elberfeld, der Eigentümer nach 1787, betrieb den „Eisenhammer“ im Naafbachtal unterhalb der inzwischen abgebrochenen „Weegermühle“. Das aus dem 16./17. Jahrhundert stammende Herrenhaus (5-geschossig!) des früheren Freigutes Dorp hat ein mächtiges – gotisch an- klingendes – Dachgeschoß. Im Garten, dem späteren „Bongert“ (Baumgarten), stehen links die Eheleute Fischer, Julius und Lina geh. Mylenbusch; bei den „Blaaren“ (Kinder) handelt es sich um Meta Heiser geh. Fischer und Max Fischer. Hier befindet sich heute der „Reitstall Haus-Dorp“. Im Garten vor dem links erkennbaren Nebengebäude lag der alte Grabstein der Familie Ma[e]rkelsbach, genannt Allner, der in den 30er Jahren in das Außenmauerwerk des Nebengebäudes eingemauert wurde. Links am Giebel des Herrenhauses ist ein „Duhfes“ (Taubenschlag) erkennbar. Die Kellermauem sind 1,10m–1,80m dick. Vom Keller aus soll nach einer Überlieferung ein unterirdischer Gang bis zum „Burgsiefen“ der sich ca. 300m unterhalb in Richtung Naafbachtal befindet, verlaufen sein. Noch im Wohnzimmerbereich der linken „Burghälfte“ sind die Außenmauern rd. 1m dick. Hans Karl Kirschbaum, Haus-Dorp, erzählte, daß sich in seinem Hause früher eine Gaststube befunden haben soll. Im Obergeschoß des Hauses hätten noch sein Vater und Frau Vierkötter, Haus Dorp, um die Jahrhundertwende das Tanzen gelernt. In der Familie Kirschbaum habe man früher gesagt: „Geh mal auf die Kegelbahn“. Damit habe man den Garten gemeint, wo sich früher eine kleine Kegelbahn befunden habe. Es ist überliefert, daß in der Burg Haus-Dorp Gottesdienste der Reformierten stattgefunden haben. Anschließend wird man sich wahrscheinlich im heutigen Haus Kirschbaum zu einem Umtrunk zusammengesetzt haben. Unterhalb von Haus-Dorp in Richtung Naafbachtal liegt der „Wingertsberg“ (Weingartsberg). Auf diesem, der Sonnenseite zugewandten Abhang, dürften unsere Vorfahren Weinstöcke angepflanzt haben. Ulrich Vierkötter, Haus-Dorp, berichtete, daß die „Loche“ (Grenzsteine) in der Umgebung von Haus-Dorp die Buchstaben RSD (Rittersitz Haus-Dorp) trugen. Ein Brandweiher befand sich ganz oben im Burg-Siefen. Foto der Westseite: Die doppelflügelige geschnitzte Haustür beweist, daß hier früher wohlhabende Leute wohnten. Vor der rechten Haushälfte (Familie Fischer) sieht man die alte Wasserpumpe. Vor ihrer linken Haushälfte haben sich die Eheleute Rudolf Steinsträßer mit den Kindern Berta, Martha, Minni und Luise aufgestellt. Mit von der Partie War Franz Hohn, der beim Pferd steht und der Familie St. 32 Jahre treu als Knecht diente. Rudolf St. und sein Knecht Franz „jinken ömeen“ (waren befreundet). Das Obergeschoß der Burg besteht aus Fachwerk und wurde nach Angaben von Max Fischer, Haus-Dorp, in den 20er Jahren verputzt. | |
Kixbirk lag südwestlich des heutigen Wasser-Hochbehälters Oberschönenberg. Im Volksmund nannte man das Anwesen: „Villa Eimermacher“. In der Tür steht Fritz Bräunsbach, Aggerhof. Hier wohnte – wenn er nicht in der „Blech“ (Gefängnis) saß –... Kixbirk lag südwestlich des heutigen Wasser-Hochbehälters Oberschönenberg. Im Volksmund nannte man das Anwesen: „Villa Eimermacher“. In der Tür steht Fritz Bräunsbach, Aggerhof. Hier wohnte – wenn er nicht in der „Blech“ (Gefängnis) saß – Wahlscheid’s bekannter „Spetzboov“ (Spitzbube) August Eimermacher mit seiner leiblichen Mutter (“et Maal“ = Amalie) und seinem Stiefvater Peter Eimermacher. Et Maal, „en Schionz“ (nachlässiges „Frauenzimmer“), hatte Sohn August mit in die Ehe gebracht. Vater Peter E., gelernter Zimmermann, war „ne Fuulhoof" (Faulpelz). Er hatte jahrelang einen für „sing Jehööch“ (das Innere eines renovierungsbedürftigen Hauses) fertig gezimmerten Dachstuhl vor dem Haus liegen lassen. Schließlich verrottete das Holz. Wenn sich Kinder seinem Haus näherten, um ihn zu zanken, „dät äe schängen“ (schimpfen) und „stööfte“ (jagte) sie fort. Für die Kinder hieß es dann „kaaschte oder tirre jön“ (laufen gehen). Der Spruch „Die unendliche Heimatliebe des Peter Eimermacher“ fiel den Wahlscheidem ein, wenn sie die Ruine „Kixbirk“ vor Augen hatten (überliefert von Emst Hohn, Aggerhof). Zuletzt schlief Peter E. vor Angst, das Haus könnte zusammenbrechen, unter seinem Küchenherd. Das schien ihm der sicherste Platz zu sein. „Debennen“ (Drinnen) war natürlich alles „knüselich“ (schmutzig). Überall, wo man hinschaute, war „Knies“ (Schmutz). Gebrüder Hugo und Emil Klein, Kleefhaus: “Eines Tages hörten wir ein lautes Krachen. Als wir am Fenster hinausschauten, sahen wir eine Staubwolke über „dr Kixbirk“. Unser Vater sagte sofort: „Dö es däm Pitter sing Huus zesammen jefalle.“ (Da ist dem Peter sein Haus zusammengefallen.) Wir liefen hin und sahen, daß die Mittelwand, die zuletzt noch im Obergeschoß stand, umgefallen war. Peter kehrte noch eine kurze Zeit draußen mit seinem Besen und begab sich dann wieder in das Innere des Hauses, als wenn nichts geschehen wäre.“ | |
|
1930
Der Hof lag südlich vom Hitzhof. Er gehörte zum Grundbesitz des Grafen von Nesselrode. Im Jahre 1829 lebten hier noch 5 Bewohner in einem Wohnhaus. 1840 war das Haus bereits abgebrochen. Auf dem nachstehenden Bild sieht man im Hintergrund auf der... Der Hof lag südlich vom Hitzhof. Er gehörte zum Grundbesitz des Grafen von Nesselrode. Im Jahre 1829 lebten hier noch 5 Bewohner in einem Wohnhaus. 1840 war das Haus bereits abgebrochen. Auf dem nachstehenden Bild sieht man im Hintergrund auf der anderen Aggerseite noch die Scheune des ehemaligen Auelshofes, der erstmals 1513 erwähnt wurde. Im Vordergrund verlaufen die Schienen der Eisenbahnlinie Siegburg/ Overath. Während man heute zur Sicherheit der Autofahrer am Straßenrand unendlich viele reflektierende Kunststoff-Begrenzungspfahle anbringt, pinselte man früher weiße Leuchtfarbe auf die Straßenbäume. Der Auelshof lag, vor Aggerhochwasser geschützt, auf einer kleinen Anhöhe. Der Auelsbach lief unmittelbar an der Hofanlage vorbei. | |
|
1891
Schloß Auel wurde im Jahre 1763 auf dem Grundriß des vorherigen mittelalterlichen Gebäudes von Peter-Josef von Proff errichtet. Die in einem Park gelegene und ursprünglich wasserumwehrte, dreiflügelige Anlage dürfte der schönste Profanbau der neuen... Schloß Auel wurde im Jahre 1763 auf dem Grundriß des vorherigen mittelalterlichen Gebäudes von Peter-Josef von Proff errichtet. Die in einem Park gelegene und ursprünglich wasserumwehrte, dreiflügelige Anlage dürfte der schönste Profanbau der neuen Stadt Lohmar sein. Im Jahre 1865 wurden die Wirtschaftsgebäude abgebrochen und die Wassergräben zugeschüttet. Das zweigeschossige Herrenhaus besitzt ein steiles Mansardendach über dem Mittelteil. Die Seitenteile sind mit niedrigeren Walmdächern eingedeckt. Im nördlichen Seitenteil befindet sich die Schloßkapelle. Das früher zur Gartenseite gelegene Seitenschiff wurde inzwischen abgerissen. In der Kapelle befinden sich zahlreiche religiöse Gemälde des 16. bis 18. Jahrhunderts und ein Rokokoaltar aus dem Jahr 1770. Eigentümer des Schlosses waren u.a. folgende Personen und Familien: Im Jahr 1391 wurde erstmalig Peter van me Auel urkundlich genannt. Gegen Ende des 15. Jahrh. (damals wurde Haus Auel auch Michelsauel [o. Meuchenauel] genannt): Wilhelm von Auel gen. Meuchen (Gemahl von Bertha von Plettenberg) ,vor der Mitte des 16. Jahrh.: Farn, von der Reven zu Lohmar und Nachkommen, die in die Familien von Hammerstein und Stael von Holstein zu Eulenbroich (Rösrath) einheirateten. ab 1702: Johann Kaspar Proff (gest. 1720) von Menden. Dessen Sohn Peter Josef (gest. 1766) errichtete die gegenwärtigen Gebäude von Auel und stiftete 1738 gemeinsam mit Max Adam von Ley zu Honsbach die Katholische Pfarre zu Neuhonrath (genannt „Baach“). Nachkommen heirateten in die Familien von Dötsch, von Broe und von La Valette Saint George ein. Seitdem ist die letztgenannte Familie Eigentümerin von Schloß Auel. Zu Haus Auel gehörten bzw. gehören folgende weitere Höfe: Windlöck, Birken, Rosauel, Höhnchen, Krebsauel, Bachermühle und Stieß (besteht nicht mehr). Napoleon soll 1811 bei der Kontrolle der Rheinarmee im Schloß Auel übernachtet haben. 1815 hat angeblich Zar Alexander bzw. sein Stab auf der Reise von Rußland nach Paris in Schloß Auel Station gemacht. | |
|
1930
- 1939 Blick vom Maarbach in Richtung Schachenauel in den 30er Jahren. Auf dem freien Feld befindet sich heute das Sportgelände Krebsauel. Der links erkennbare Garten gehörte zum benachbarten Bauernhof Krebsauel (Pächter Alois Lindner unterhielt hier ein... Blick vom Maarbach in Richtung Schachenauel in den 30er Jahren. Auf dem freien Feld befindet sich heute das Sportgelände Krebsauel. Der links erkennbare Garten gehörte zum benachbarten Bauernhof Krebsauel (Pächter Alois Lindner unterhielt hier ein Sägewerk; Eigentümer der Hofanlage war Baron von La Valette). Auf dem Bild sind zu sehen – jeweils von links: unten: 1. Hanni Frackenpohl; 2. Laura Müllenbach geb. Hohn; im Baum: 1. Hans Prinz; 2. Mia Büchel; 3. Karl Büchel; 4. Hedwig Franke geb. Bender. In Höhe des aggerabwärts gelegenen Hofes Krebsauel fließt der Krebsaueler Bach, der aus dem „In der großen Nursch“ gelegenen „Kohberg“ kommt, in den Maarbach. Der Schönenberger Siefen, den er durchfließt, beginnt „bonger“ (unterhalb) Oberschönenberg (früher Kixbirk). | |
|
1930
Der Weiler ist vermutlich erst im 18. Jahrhundert entstanden. Hier wohnten im Jahre 1875 insgesamt 8 Personen. Vor der Haustür sieht man den „Dürpelsteen“. Links davon befindet sich die Hühnerleiter zum „Hoondersch“ (Hühnerhaus). An der Wetterseite... Der Weiler ist vermutlich erst im 18. Jahrhundert entstanden. Hier wohnten im Jahre 1875 insgesamt 8 Personen. Vor der Haustür sieht man den „Dürpelsteen“. Links davon befindet sich die Hühnerleiter zum „Hoondersch“ (Hühnerhaus). An der Wetterseite (Schmeßsick) war das Haus schieferverkleidet und somit gut gegen Wind und Wetter geschützt. Ein mächtiger Nußbaum – an anderen Häusern mitunter auch eine uralte Linde oder Eiche – beschirmte früher mit weitem Geäst das Fachwerk-Bauemhaus. | |
Auf einer alten Flurkarte ist noch gut der – heute nicht mehr vorhandene – Brandweiher zu erkennen. Der Weiler, der auf der höchsten Erhebung des Kirchspiels Wahlscheid liegt, wurde bereits 1644 erwähnt. Im Jahre 1875 lebten hier in 6 Wohnhäusern 31... Auf einer alten Flurkarte ist noch gut der – heute nicht mehr vorhandene – Brandweiher zu erkennen. Der Weiler, der auf der höchsten Erhebung des Kirchspiels Wahlscheid liegt, wurde bereits 1644 erwähnt. Im Jahre 1875 lebten hier in 6 Wohnhäusern 31 Personen. Es handelt sich um das Geburtshaus des Pater Johannes (Philipp Höver), geb. am 10.11.1816, der als Stifter der Genossenschaft der „Armen Brüder vom Heiligen Franziskus“ in Aachen geehrt wird. Die Bauernhöfe waren früher meist von einem „Bungert“ (Baumgarten), auf dem das Jungvieh weidete, umgeben. Wohnteil und Viehstall gingen ineinander über. Die Haustür war in der Vorzeit quergeteilt und nannte sich „Gaader“ (im Volksmund auch „Klaafdüür“ genannt). Tagsüber blieb die untere Hälfte geschlossen, damit die Tiere nicht ins Haus kamen. Die obere Hälfte blieb geöffnet, damit das Licht einfallen und das Vieh auf dem Hof beobachtet werden konnte. Der Fußboden des Hausflurs (gleichzeitig Küche) war mit unregelmäßigen Bruchsteinplatten belegt. Von hier aus führte eine Tür in die Stube, eine Falltür in den Keller (teilunterkellert) und eine weitere Tür in „et Fooderdänn“ (Futtertenne) bzw. den Viehstall. Eine einfache Treppe führte zum „Older“ wo sich die Schlafstuben befanden. Im „Fooderdänn“ oder Flur stand die „Kühl“ ein gußeiserner Kessel, in dem im Winter das Viehfutter gedämpft wurde. Nach Reinigung wurde darin die Wäsche gekocht oder sogar gebadet. Der Küchenherd, der auch an warmen Tagen zum Kochen brannte, heizte der versammelten Großfamilie ordentlich ein. Hinzu kam mitunter der Staub, den die Großmutter am Spinnrad mit der Wolle verursachte. Am Abend trafen die Nachbarn, um (Petroleum-) Licht zu sparen, zum „Nopem“ ein. Die Ausdünstungen der Bauersleute, die tagsüber im Schweiße ihres Angesichts hart gearbeitet hatten (Dusche oder Bad kannte man nicht) sowie der Tabakqualm der Männer erfüllten den Raum. Wenn die Zimmerlampe mit Karbid brannte, mußte man darauf achten, daß die richtige Menge Wasser zugeführt wurde. Ansonsten bestand die Gefahr, daß die Karbid-Lampe explodierte. Die „jood Stow“ (gute Stube) wurde Kirmes, Weihnachten und wenn hoher Besuch kam, benutzt und beheizt. Im Schlafgemach der Bauersleute stand eine Kommode mit Waschschüssel und einer Wasserkanne. Das hohe Bett konnte von kleinen Leuten nur mit einer Fußbank erreicht werden. Das Bettgestell war mit Brettern ausgelegt. Man schlief auf einem mit Stroh gefülltem leinenem Bettsack. Wenn drei Kinder in einem Bett schliefen – was keine Seltenheit war -, lag ein Kind quer. Unter das Bett gehörte ein Nachtgeschirr. Deshalb empfing einen beim Betreten eines Schlafzimmers der eigentümliche Uringeruch. | |
|
1920
- 1929 In Grünenborn, das erstmals 1644 urkundenmäßig erwähnt wurde, lebten im Jahre 1875 in 6 Wohngebäuden 22 Personen. Auf dem Bild aus den 1920er Jahren sehen wir von links auf dem Karussell: u.a. Bruno... In Grünenborn, das erstmals 1644 urkundenmäßig erwähnt wurde, lebten im Jahre 1875 in 6 Wohngebäuden 22 Personen. Auf dem Bild aus den 1920er Jahren sehen wir von links auf dem Karussell: u.a. Bruno Haas und Otto Stöcker; links im Hintergrund: Frau Stöcker sen.; auf dem Fahrrad: Paul Kurtenbach; rechts daneben: Fritz Stöcker; auf der Leiter: Lieselotte Volberg geb. Lindenberg; rechts mit Kleinkind: Frau Erwin Lindenberg; rechts im Hintergrund: Lorenz Kurtenbach und Hermann Haas. Später stand das Karussell – in Tieflage – im Kurgarten des Auelerhofes.
| |
|
1910
Gustav Steeger, Hohnenberg, wußte noch, daß im Keller Kühe gestanden hatten. Ein Teil des Reihenhauses (rechts) dürfte aus dem 18. Jahrhundert stammen. Das Haus hatte damals eine nach oben hin offene Feuerstelle, genannt Boosen. Die Rauchabzüge... Gustav Steeger, Hohnenberg, wußte noch, daß im Keller Kühe gestanden hatten. Ein Teil des Reihenhauses (rechts) dürfte aus dem 18. Jahrhundert stammen. Das Haus hatte damals eine nach oben hin offene Feuerstelle, genannt Boosen. Die Rauchabzüge waren aus Eichenbrettern gezimmert und mit Pech gestrichen. Bei Abbruch alter Fachwerkhäuser findet man heute noch die vom Ruß gezeichneten Balken. Hohnenberg liegt unweit nördlich von Neuhonrath und gehörte bis 1969 zur bis dahin eigenständigen Gemeinde Wahlscheid. In Hohnenberg wohnten 1875 in 6 Wohnhäusern 24 Personen. | |
|
1914
Rechts im Bild sieht man eine „Adels-Schörreskaar“. Hähngen liegt im Nordosten der Stadt Lohmar in der Nähe von Neuhonrath und gehörte bis 1969 zur bis dahin eigenständigen Gemeinde Wahlscheid. Im Jahre 1875 wohnten in Hähngen 9 Personen in 3... Rechts im Bild sieht man eine „Adels-Schörreskaar“. Hähngen liegt im Nordosten der Stadt Lohmar in der Nähe von Neuhonrath und gehörte bis 1969 zur bis dahin eigenständigen Gemeinde Wahlscheid. Im Jahre 1875 wohnten in Hähngen 9 Personen in 3 Wohnhäusern.
| |
Die Hofanlage wurde auch Äuelchen (Verkleinerungsform des Siedlungsnamens Auel) genannt. Im Jahre 1875 lebten hier in 1 Haus 5 Personen. Bevor Willi Hohn in den Auelerhof verzog, bewirtschaftete er den Hof Äuelchen; man nannte ihn deshalb... Die Hofanlage wurde auch Äuelchen (Verkleinerungsform des Siedlungsnamens Auel) genannt. Im Jahre 1875 lebten hier in 1 Haus 5 Personen. Bevor Willi Hohn in den Auelerhof verzog, bewirtschaftete er den Hof Äuelchen; man nannte ihn deshalb „Äuelchen’s Willi“. Willi Hohn hatte aber auch noch die Spitznamen „Pefferooch und Pefferkoom“ weil er in der „Kruckpaasch“ (Krautpresse) in Höffen beim „Kruckstöchen“ half; seine Spezialität war das Beimischen von Pfeffer. Unterhalb des Hofes fließt der Maarbach. Er entspringt in den beiden unterhalb von Höffen und der „Goldenen Ecke“ beginnenden Siefen. Sie tragen die Namen „Hellensiefen“ (südlich gelegen; vom „Wilden Stein“ kommend) und „Schaafsiefen“ (nördlich gelegen). Menschen und Tiere lebten unter einem Dach. Im Kellergeschoß befand sich der Viehstall. Laura Müllenbach geb. Hohn, jetzt wohnhaft in Hofferhof: „Mit Wasser vom Hang waren wir reich gesegnet. Vor dem Haus befanden sich drei Fischweiher mit Wasserrosen. Den Maarbach nannte man hier auch Äuelchen’s Bach.“ Frühere Eigentümer des Hofes: Familie Otto und Familie Kirschbaum. | |
|
1930
- 1939 Zwischen 1838 und 1843 hat der aus Effert/Seelscheid stammende Heinrich Wilhelm Otto, der über viele Jahrzehnte erster Beigeordneter der Bürgermeisterei Wahlscheid war, das Haus gebaut. Heute befindet sich in dem im Eigentum der Familie Fischer... Zwischen 1838 und 1843 hat der aus Effert/Seelscheid stammende Heinrich Wilhelm Otto, der über viele Jahrzehnte erster Beigeordneter der Bürgermeisterei Wahlscheid war, das Haus gebaut. Heute befindet sich in dem im Eigentum der Familie Fischer stehenden Haus ein bekanntes Speiselokal. Der gleichnamige Bach, der hier in die Agger mündet, entspringt unterhalb des Weilers Hausen. | |
|
1914
Wohnhaus Breunsbach, das im Jahre 1799 errichtet wurde. Es handelt sich um eine sehr alte Hofanlage, die bereits im 15. Jahrhundert erwähnt wurde. Im Jahre 1875 lebten hier 38 Personen in 8 Wohngebäuden. Interessanter Flurname in der näheren... Wohnhaus Breunsbach, das im Jahre 1799 errichtet wurde. Es handelt sich um eine sehr alte Hofanlage, die bereits im 15. Jahrhundert erwähnt wurde. Im Jahre 1875 lebten hier 38 Personen in 8 Wohngebäuden. Interessanter Flurname in der näheren Umgebung: „Auf dem Heiperich“ unterhalb von Hausen in Richtung Stolzenbach gelegen. | |
|
1939
links: Haus Hölper – mitte: hier steht heute das total erneuerte Haus Nagel; auf dem Bild sind noch der alte „Pötz“ und rechts der „Göpel- Schopp“ erkennbar.Ganz rechts sieht man das alte Stellmacherhaus Lüghausen (links unten befand sich die... links: Haus Hölper – mitte: hier steht heute das total erneuerte Haus Nagel; auf dem Bild sind noch der alte „Pötz“ und rechts der „Göpel- Schopp“ erkennbar.Ganz rechts sieht man das alte Stellmacherhaus Lüghausen (links unten befand sich die Werkstatt). Laut W. Pape (s.o.) hieß die Siedlung, die ihren Namen von einem Personennamen „Macco“ ableitet, offenbar früher „Mackenberg“. Durch falsche Übersetzung des Mundartausdrucks „-berg“ kam es wahrscheinlich zu der Silbe „-bach“. Der verhältnismäßig große Weiler, in dem 1875 insgesamt 57 Personen in 14 Wohnhäusern wohnten, wurde bereits 1487 erwähnt.In der Mitte von Mackenbach lag der (Brand-)Weiher; unten im Dorf befand sich noch ein weiterer kleiner Weiher. Interessante Flurnamen in der näheren Umgebung: “Am dicken Loch“ – unterhalb von Mackenbach in Richtung Stolzenbach gelegen. “Auf der Müspel“ – unterhalb von Mackenbach in Richtung Agger gelegen. Wenn die Mackenbacher schnell zum Friedhof (dessen Flurbezeichnung lautet: „Am Brithof’) wollten, gingen sie durch die „Höll“. Wasserprobleme Auch Mackenbach, das man früher das „Handwerkerdorf’ nannte, hatte seine Trinkwasserprobleme. Kurt Oberdörster und seine Mutter, Frau Oberdörster geb. Fischer (geb. 1904): Mit einem „Kloppmännchen“ (dazu an anderer Stelle mehr) wurde das Wasser aus dem benachbarten Siefen in ein Bassin gepumpt, das sich an der höchstgelegenen Stelle in Mackenbach neben dem Haus Hohn/ Biermann befand. Streit gab es, wenn unten im Hof der Wasserverbrauch zu stark war und in den höhergelegenen Haushalten der Wasserkran nichts mehr hergab. Frau O. erzählte, daß oft während eines Waschvorganges das Wasser ausging und die Wäsche anschließend unten an der Agger ausgewaschen werden mußte. Im Winter bei Eis und Schnee mußte unten am „Kloppmännchen“ ein Feuer entfacht werden, damit das Gerät nicht einfror. | |
|
1914
In Weeg, das bereits in einer Urkunde aus der Zeit von 1358 – 1364 genannt wurde, und ehemaliger Freihof war, wohnten in 1875 in 12 Häusern 66 Einwohner. Interessante Flurnamen in der näheren Umgebung: „Im Gierchen“ – im „Rosental“ unterhalb von Weeg... In Weeg, das bereits in einer Urkunde aus der Zeit von 1358 – 1364 genannt wurde, und ehemaliger Freihof war, wohnten in 1875 in 12 Häusern 66 Einwohner. Interessante Flurnamen in der näheren Umgebung: „Im Gierchen“ – im „Rosental“ unterhalb von Weeg gelegen. Der Brandweiher bzw. Dorfteich lag mitten im Weiler, wo sich heute das Anwesen der Eheleute Otmar und Wilfriede Wasser befindet. Personen auf dem Bild – von links: 1. Das „Weech“ (Mädchen) ist Meta Heiser geb. Fischer; 2. Berta Fischer, Weeg; 3. Daniel Fischer junior (Ehemann von 2.); 4. ?; 5. Helene Fischer, Bonn, mit „Ditzje“ (Säugling); 6. Otto Fi- scher, Weeg und Bonn (Tierarzt), Ehemann von 5.; 7. ?; 8. Laura Lindenberg geb. Fischer, Weeg und Münchhof; 9. Gustav Lindenberg, Münchhof (Ehemann von 8.); 10. Daniel Fischer senior, Weeg; 11. Frau Karl Lindenberg (“d’r Böchelter“), Berta geb. Fischer, Weeg Die Familie hatte ihren Sonntagsstaat angezogen. Man ließ auch die wertvollsten Haustiere mit auf das Bild bannen. Im Hintergrund links sitzt der Knecht auf dem Pferd. Früher wohnten auf dem Bauernhof nicht nur Eltern und Kinder, sondern auch die Großeltern und unverheirateten Onkel, Tanten und Geschwister. Oma und Opa durften in der altgewohnten Umgebung und der Geborgenheit der Familie ihren Lebensabend verbringen. Mehrere Generationen lebten in Bescheidenheit auf engem Raum in der Großfamilie zusammen. Ein Opa machte sich nützlich, indem er im landwirtschaftlichen Betrieb „knuuvte, knüsterte (geschickt arbeitete) oder kröhste (herumwerkelte)“. Das Fachwerk im Erdgeschoß ist mit Ziegelsteinen ausgemauert. Nach Angaben von Hans Karl Kirschbaum, Haus-Dorp, hat Daniel Fischer, der damalige Bauherr, die Ziegelsteine selbst gebrannt. Den Rohstoff „Lehm“ gewann er aus dem Boden oberhalb der Grube Pilot.
| |
Die Kegelbahn war bis ca. 1930 unten offen. Ganz rechts ist die Schmiede erkennbar; sie ist inzwischen abgebrochen. Ferner sind die Scheune links, an das ganz links stehende Wohnhaus Frackenpohl angrenzend, und die weiter rechts stehende Scheune... Die Kegelbahn war bis ca. 1930 unten offen. Ganz rechts ist die Schmiede erkennbar; sie ist inzwischen abgebrochen. Ferner sind die Scheune links, an das ganz links stehende Wohnhaus Frackenpohl angrenzend, und die weiter rechts stehende Scheune (kommt nur mit dem Dach zum Vorschein) abgebrochen. In der Gaststätte „Zur Sonne“ betrieben die Eheleute Alfred und Wilhelmine Koch noch nach dem 2. Weltkrieg ein Kolonialwarengeschäft. Darüber hinaus verwalteten sie die Poststelle „Weeg/Siegburg-Land“. In der Gaststätte wurde am Kirmesdienstag die sogenannte „Blocher Kirmes“ gefeiert. Die Gaststätte „Zur Sonne“ war nach dem 1. Weltkrieg die Stammkneipe der sehr unternehmungslustigen jungen Männer aus Bloch. Diese Jungs, an deren Spitze „Heimatdichter“ Hermann Kirschbaum stand, riefen mit freudiger Zustimmung des Wirtes Alfred Koch die „Blocher Kirmes“ ins Leben. | |
|
1939
1875 wohnten in Münchhof 38 Einwohner in 7 Wohnhäusern. Interessante Flurbezeichnung in der näheren Umgebung: „Im Juhpert“ oberhalb der evangelischen Kirche St. Bartholomäus in Richtung Münchhof gelegen (Im Volksmund sagte man „Kuppert“). Münchhof... 1875 wohnten in Münchhof 38 Einwohner in 7 Wohnhäusern. Interessante Flurbezeichnung in der näheren Umgebung: „Im Juhpert“ oberhalb der evangelischen Kirche St. Bartholomäus in Richtung Münchhof gelegen (Im Volksmund sagte man „Kuppert“). Münchhof hatte einen Weiher bzw. Dorfteich. Der Weiher war verhältnismäßig groß. In den 1960er Jahren wurde er zugeschüttet und mit einem Wohnhaus bebaut. Der Weiler Münchhof – erstmals 1166 erwähnt – ist der älteste Weiler und Kern von Wahlscheid. Nikolaus Maas, Münchhof, hat erlebt, daß man bei Verlegen der Wasserleitung gegenüber einem der ältesten Häuser von Münchhof, dem „Schmitz-Huus“ (früher „Konsum“), auf Tongefäße, Pfeifen usw. stieß. Man grub damals nicht weiter, weil die Grenze des Nachbargrundstückes erreicht war. Von den Vorfahren ist überliefert, daß ein unterirdischer Gang von der Grube Pilot im Siefen bis zu dem vorgenannten Haus Schmitz bestanden haben soll. | |
|
1940
Erwin Piel beim Einholen von Schanzen in Mailahn. Manch ein „Knävvel“ (Knüppel) Holz liegt auf dem zweispännig gezogenen Leiterwagen. Links in der Scheune sieht man eine Kasten-Schubkarre und „en Schörreskaar“ (Schürreskarre). In Mailahn, das... Erwin Piel beim Einholen von Schanzen in Mailahn. Manch ein „Knävvel“ (Knüppel) Holz liegt auf dem zweispännig gezogenen Leiterwagen. Links in der Scheune sieht man eine Kasten-Schubkarre und „en Schörreskaar“ (Schürreskarre). In Mailahn, das erstmals 1586 in einer Urkunde erwähnt wurde, wohnten im Jahre 1875 29 Einwohner in 7 Wohnhäusern. Beim „Schanze-Maache“ (Binden von Reisigholz) „em Bösch“ blieb kein Reisig liegen. Für die Herstellung von Besen wurde ebenfalls Reisig verwandt. Mit ihm brachte man auch das Feuer auf Zunder, insbesondere dann, wenn man mit dem „Stöchihsen“ (Schüreisen) etwas „fuhrwerkte“. „Klötte“ (Briketts) waren früher für den armen Mann unerschwinglich. Zum Feuern des Ofens verwandte man Holz, das – geschützt vor Wind und Wetter – draußen vor dem Haus akurat „gestivvelt“ (genau aufgestapelt) wurde. Holz „spahlen“ (spalten) war eine Winterbeschäftigung für den Bauern. Günter Piel teilte mit, daß die Schanzen heute noch auf seinem Stall lagern; der Hauptbestandteil ist allerdings Wurmmehl. Sie sind mit einem „Strohbängel“ gebunden; man verwandte früher auch die sogenannte „Wedd“ (dünner Eichen-, Buchen- oder Weidenzweig), die „gefreidelt“ wurde. | |
|
1930
In Hohn, das erstmals 1644 erwähnt wurde, wohnten im Jahre 1875 insgesamt 27 Personen in 6 Wohnhäusern. Der „Kellerbach“ der direkt unterhalb der Straße Münchhof-Mailahn entspringt, und der Kattwinkelbach fließen in Hohn zusammen und bilden den... In Hohn, das erstmals 1644 erwähnt wurde, wohnten im Jahre 1875 insgesamt 27 Personen in 6 Wohnhäusern. Der „Kellerbach“ der direkt unterhalb der Straße Münchhof-Mailahn entspringt, und der Kattwinkelbach fließen in Hohn zusammen und bilden den Hohnerbach, der später noch den Klefhauserbach aufnimmt und nach Aggerhof hinunterfließt. Die Flurbezeichnung „Am Mühlenberg“ in unmittelbarer Nähe des Weilers deutet daraufhin, daß in Hohn auch eine Mühle vorhanden gewesen sein kann. Lina Müller geb. Kürten, Wahlscheider Straße, erzählte von ihrem Vorfahren Wilhelm Weber, dem Gründer des Männerchores Wahlscheid, der in Hohn wohnte: Er hatte eine kleine Landwirtschaft und flechtete im Winter Körbe und Mahnen. Seine Weidensträucher hegte und pflegte er, weil ihm deren Äste das notwendige Rohmaterial lieferten. Eine Werkstatt brauchte Wilhelm nicht; er verrichtete seine Arbeit in den Häusern der Bauern. Der Hohnerbach diente ihm zum Nässen des Holzes. Wilhelm war ein leidenschaftlicher Musiker und spielte mit seinem Kontrabaß in einer Kapelle. Eine große Freude für ihn war das gemeinsame Singen mit Schulkindern auf der Bank unter seinem Lindenbaum in Hohn. Diese Musikleidenschaft brachte er in den Männerchor Wahlscheid bei der Gründung im Jahre 1879 ein. Die Fachwerkhäuser errichteten unsere Vorfahren gemeinsam mit Verwandten und Nachbarn in Eigenleistung. Der Hausbau dauerte gewöhnlich 8 bis 12 Jahre, da das hierfür benötigte Eichenholz vorher 5 bis 8 Jahre trocknen mußte. Das Eichenholz stammte aus dem eigenen Wald. Im Schweiße ihres Angesichts mußten die Menschen ihre Arbeit verrichten, konnten sich bei der schweißtreibenden Arbeit aber erlauben, fette und kalorienreiche Nahrung zu sich zu nehmen. Die Fachwerk-Gefache wurden mit Weidengeflecht ausgefüllt und mit Lehm, der von Stroh durchsetzt war, verschmiert (“geschleevert“). Die Außenwände waren atmungsaktiv. Erdbeben und Bombenerschütterungen trotzten die Fachwerkhäuser. Die Gewölbekeller wurden mit trocken (ohne Mörtel) verlegten Bruchsteinen – mit der schmalen Seite nach unten – erstellt.
| |
|
2020
Katharinenbach besteht nur aus dem Pfarrgut der evangelischen Kirchengemeinde Wahlscheid. Mehrere Generationen der Familie Zimmermann bewirtschaften jetzt bereits das Gut. Zur Zeit betreibt hier das Wahlscheider Original „Baacher“ (Karl Heinz... Katharinenbach besteht nur aus dem Pfarrgut der evangelischen Kirchengemeinde Wahlscheid. Mehrere Generationen der Familie Zimmermann bewirtschaften jetzt bereits das Gut. Zur Zeit betreibt hier das Wahlscheider Original „Baacher“ (Karl Heinz Zimmermann) Landwirtschaft. Interessanter Flurname in der näheren Umgebung: „Auf dem Kraten- puhl“ (Krötenteich), gelegen zwischen Katharinenbach und Hohn. Der Hof, der im Jahre 1212 von Graf Heinrich von Sayn der Kirchengemeinde geschenkt wurde, liegt idyllisch oberhalb von Wahlscheid an der Sonnenseite eines Talkessels. | |
|
2020
In Schönenberg, das bereits im Jahre 1244 erwähnt wurde, wohnten 1875 in 10 Häusern 42 Personen. Interessanter Flurname in der näheren Umgebung: „In der Brautheide“ gelegen zwischen Schönenberg und Hohn. Haarpflege: Stöcker’s Karl vom... In Schönenberg, das bereits im Jahre 1244 erwähnt wurde, wohnten 1875 in 10 Häusern 42 Personen. Interessanter Flurname in der näheren Umgebung: „In der Brautheide“ gelegen zwischen Schönenberg und Hohn. Haarpflege: Stöcker’s Karl vom „Schüümerich“ (Schönenberg) schnitt früher den Männern mit einem von Hand zu bedienenden Gerät die Haare. Wie beim Zahnarzt ging damals auch das Haarschneiden nicht ohne „Ping“ (Schmerzen) über die Bühne. Das Handgerät zupfte die Haare zum Teil einzeln aus. Die Männer stöhnten dann: „Et trickt, et trickt“ (Es zieht). Nur Gustav O. sagte stets: „Ech spürre nüüß“ (Ich spüre nichts). Er war offenbar „fried“ (widerstandsfähig). | |
|
2020
In Klefhaus, das bereits im Jahre 1244 erwähnt wurde, wohnten in 1875 in 13 Wohnhäusern 60 Personen. Interessante Flurnamen in der näheren Umgebung: „Auf dem Schlienerf’, südlich von Klefhaus gelegen, sowie „Auf dem Hollender Stück“ gelegen zwischen... In Klefhaus, das bereits im Jahre 1244 erwähnt wurde, wohnten in 1875 in 13 Wohnhäusern 60 Personen. Interessante Flurnamen in der näheren Umgebung: „Auf dem Schlienerf’, südlich von Klefhaus gelegen, sowie „Auf dem Hollender Stück“ gelegen zwischen Klefhaus und Höffen. Von Klefhaus aus wurde in den 20er Jahren die Initiative zur Gründung des originellen „Orchester Klefhaus“ ergriffen. Sehr deutlich sind auf einer Flurkarte aus dem Jahr 1824 viele schmale durch Erbteilung entstandene Streifen-Parzellen zu erkennen. Immer wieder wurden Grundstücke unter den Kindern aufgeteilt, bis eine ordentliche Bewirtschaftung nicht mehr möglich war. Nur eine Flurbereinigung brachte dann wieder geordnete Verhältnisse. | |
|
1917
Im Zuge der Verbreiterung der „Bonner Straße“ mußte das im Kurvenbereich stehende Haus abgebrochen werden. Rechts vom Haus ist die „Ahl Schmitt“ erkennbar; diese Schmiede ist auf einer weiteren Aufnahme, die in dem Kapitel „Gewerbe“ erscheint, gut zu... Im Zuge der Verbreiterung der „Bonner Straße“ mußte das im Kurvenbereich stehende Haus abgebrochen werden. Rechts vom Haus ist die „Ahl Schmitt“ erkennbar; diese Schmiede ist auf einer weiteren Aufnahme, die in dem Kapitel „Gewerbe“ erscheint, gut zu sehen. Wir sehen auf dem Bild – von links – folgende Personen: vorne: 1.–3.: Kinder Karl, Hugo und Otto Kühler; 4., 5. und 7.: unbekannt; 6. Oma Amalie Maylahn geb. Schiffbauer, (Ehefrau des Wilhelm) hinten: 1. Lina Kühler geb. Hölper; 2. Karl Kühler; 3. Karl Maylahn, Schmied; 4. Frau Karl Maylahn, Amalie geb. Hölper; 5. Max Maylahn, Postbeamter, Solingen; 6. Wilhelm Maylahn; 7. Gustav Maylahn, Postbeamter; 8. Marta Maylahn (Ehefrau des 7.) Kattwinkel wurde erstmals im 19. Jahrhundert erwähnt; hier wohnten in einem Wohnhaus 7 Bewohner im Jahre 1875. Im letzten Jahrhundert prägten die Familien Maylahn (Schmiede) und Schiffbauer (Landwirt, Kolonialwarengeschäft und Putzmacherin) den Weiler (dazu mehr in dem Kapitel Gewerbe). | |
|
1919
Das sehr schöne Fachwerkhaus mit seiner idyllischen Lage ist in einem guten Zustand erhalten. Otto Hohn, der Eigentümer des Hauses, ist im Besitz eines Lageplanes, den der Graf von Nesselrode wahrscheinlich im 18. Jahrhundert anfertigen ließ. Die... Das sehr schöne Fachwerkhaus mit seiner idyllischen Lage ist in einem guten Zustand erhalten. Otto Hohn, der Eigentümer des Hauses, ist im Besitz eines Lageplanes, den der Graf von Nesselrode wahrscheinlich im 18. Jahrhundert anfertigen ließ. Die benachbarten Höfe, u.a. der Hitzhof und der nicht mehr bestehende Auelshof, gehörten früher zum Nesselrodischen Grundbesitz. Zwischen den Lorbeerbäumen stehen von links: 1. und 2.: Bedienstete; 3.: Johann Wilhelm Hohn mit langer Pfeife; 4.: Amalie Hohn geb. Piel;5.: Lydia Hohn geb. Fischer
| |
|
1920
Links sieht man das Haus Lindenberg (später Peter Wasser; 1992 Josef Brinkmann). Rechts steht das Haus Karl Weber (Eigentümer 1992: Günther Kuhn). Man erkennt noch einen „Pötz“ (links) und ein „Backes“ (rechts). Im Jahr 1875 lebten in „oberste... Links sieht man das Haus Lindenberg (später Peter Wasser; 1992 Josef Brinkmann). Rechts steht das Haus Karl Weber (Eigentümer 1992: Günther Kuhn). Man erkennt noch einen „Pötz“ (links) und ein „Backes“ (rechts). Im Jahr 1875 lebten in „oberste Scheid“ 31 Personen in 5 Häusern. In „unterste Scheid“ wohnten 58 Personen in 13 Häusern. | |
In Agger wohnten im Jahre 1875 11 Personen in 4 Wohnhäusern. Sehr früh wird der im Eigentum der katholischen Kirchengemeinde Overath stehende Hof Grünagger erwähnt. Brücke Tournisauel/Naafshäuschen: Die Brücke in Tournisauel war in den letzten 150... In Agger wohnten im Jahre 1875 11 Personen in 4 Wohnhäusern. Sehr früh wird der im Eigentum der katholischen Kirchengemeinde Overath stehende Hof Grünagger erwähnt. Brücke Tournisauel/Naafshäuschen: Die Brücke in Tournisauel war in den letzten 150 Jahren Gegenstand vieler Bürgereingaben und Gemeinderatsentscheidungen. In der Sitzung vom 24.03.1847 beschäftigte sich der Gemeinderat Wahlscheid mit der Einführung von Überfahrgeld für die in 1846 errichtete Fußbrücke in Tournisauel. Bis dahin bestand nur die Möglichkeit, sich von einer „Privat-Fähranstalt“ übersetzen zu lassen. Um das Brückengeld im Auelerhof zu sparen, benutzten die Fuhrleute den links der Agger am sogenannten „Schiefenberg“ vorbeiführenden Weg (an der Pastorat in Wahlscheid). In Tournisauel entluden die Fuhrleute ihre Karren und trugen das geladene Gut über die Fußbrücke! In der Sitzung vom 21.03.1867 beschäftigte sich der Gemeinderat Wahlscheid nochmals mit der Errichtung einer Fahrbrücke. Zur Untermauerung des Antrages führte man damals aus, daß der Dampfziegelbäcker Johann Wimar Hohn, Honsbach vor einigen Jahren auf dem rechten Aggerufer ( alte Ortsbezeichnung "am Panneschopp" einen Dampfziegelofen erbaute, "während er den dafür erforderlichen Ton bei Schachenauel auf dem linken Aggerufer gewinnt. ...Im Sommer backt Hohn Dachziegel und im Winter fährt er den Ton an..." Von Bachermühle aus konnte man nur durch eine Furt nach Sachachenauel gelangen. Zeitweise gab es eine Not-Fußbrücke. Im Jahr 1901 wurde eine Straßenbrücke in Bachermühle gebaut. | |
|
1930
Landwirt Rudolf Kiel mit seinem Ochsen oberhalb Schiffarth beim „Eijjen“ (Eggen). Die „Äet“ (Egge) wurde zum Arbeitseinsatz auf dem „Äeteschledden“ (Eggenschlitten) befördert. In Schiffarth wohnten im Jahre 1872 insgesamt 39 Personen in 6 Häusern... Landwirt Rudolf Kiel mit seinem Ochsen oberhalb Schiffarth beim „Eijjen“ (Eggen). Die „Äet“ (Egge) wurde zum Arbeitseinsatz auf dem „Äeteschledden“ (Eggenschlitten) befördert. In Schiffarth wohnten im Jahre 1872 insgesamt 39 Personen in 6 Häusern und 7 Haushaltungen, die ausnahmslos evangelisch waren. Schiffarth gehörte zusammen mit Brückerhof und Hitzhof zur Gemeinde Scheiderhöhe/Amt Lohmar bis zur kommunalen Neugliederung in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ob der Schiff-/Nachenbau bei der Namensgebung eine Rolle spielte, ist nicht bekannt. Am Berghang im Vordergrund des Bildes liegt Schiffarth. Im Hintergrund die herrliche Aggeraue. Frau Otto Lindenberg, Mathilde geb. Stöcker, Auelerhof (früher wohnhaft in Röttgen), kann sich erinnern, als junges Mädel in dem in der Aggeraue gelegenen „Spich“ (feuchte Stelle bzw. alter Aggerarm) beim Heumachen geholfen zu haben. Das „Spich“ erstreckte sich vom Brückerhof bis nach Stolzenbach. Wenn die Agger Hochwasser hatte, füllte sich das „Spich“ schnell mit Wasser auf. Nachstehend eine Anekdote von Rudolf Kiel und seinem Ochsen, erzählt von den Eheleuten Karl Müllenbach, Hofferhof, und Friedrich Mylenbusch, Müllerhof, sowie Paul Hohn, Heiligenstock: Während andere Bauern ihren Zugtieren bei der Arbeit kurze Kommandos gaben, unterhielt sich Bauer Rudolf Kiel mit seinem Ochsen. Wenn er beim Pflügen wendete, sagte er z.B.: „Dienst wie vorhin“ oder „Das ganze kehrt“. Rudolf und sein Ochse pflegten die Arbeit ganz bedächtig zu erledigen. Wenn er morgens oben auf der Ley mit seinem Ochsen zur Bestellung des Ackers angekommen war, dauerte es nicht lange, bis er wieder ausspannte und sich die beiden zum Mittagsmahl nach Hause begaben. Rudolf soll auch zum Ochsen gesagt haben: „Ich muß dich strafen“, schlug aber mit seinem Stock nicht auf den Körper des Ochsen, sondern auf das Geschirr. Das Halten eines Ochsen war im Hause des vorgenannten Rudolf Kiel Tradition. Schon Schwiegervater Lemmer hatte den Ochsen „Hannes“, dessen Stärke bekannt war. | |
|
1930
- 1939 Das Dorf Honrath, das auf einem nach drei Seiten stark abfallenden Bergrücken liegt, bestand früher aus Kirche, Burg, Pfarrhaus, Schule und Gasthaus. Die heutige „Alte Honrather Straße“ stellte die einzige Verbindung zu den auf der Höhe liegenden... Das Dorf Honrath, das auf einem nach drei Seiten stark abfallenden Bergrücken liegt, bestand früher aus Kirche, Burg, Pfarrhaus, Schule und Gasthaus. Die heutige „Alte Honrather Straße“ stellte die einzige Verbindung zu den auf der Höhe liegenden Weilern dar. Auf dem Bild ist – links oben von der Kirche – der Weiler Oberhaus zu erkennen.
| |
Das Lebensmittelgeschäft („Wenkel“) Naaf/Gronewald in Honrath (heutiger Hauseigentümer: Fam. Hoffstadt) um ca. 1930. Personen von links: 1. Wilhelm Naaf Honrath; 2. Wilhelm Gerhards, Honrath; 3. Ewald Gerhards; 4. hinten nur mit Kopf: Paula... Das Lebensmittelgeschäft („Wenkel“) Naaf/Gronewald in Honrath (heutiger Hauseigentümer: Fam. Hoffstadt) um ca. 1930. Personen von links: 1. Wilhelm Naaf Honrath; 2. Wilhelm Gerhards, Honrath; 3. Ewald Gerhards; 4. hinten nur mit Kopf: Paula Wiedenhöfer; 5. Wilhelm Wiedenhöfer; 6. hinten: Elli Gronewaldgeh. Wiedenhöfer, Honrath; 7. vorne: Ernst Wiedenhöfer; 8. Erika Riemscheid; 9. hinten: Gustav Wiedenhöfer; 10. Klara Heinen geb. Naaf Eine Zeitlang wurde das Geschäft als „Konsumgesellschaft Glück auf eGmbh“ betrieben. In Honrath lebten im Jahre 1871 52 Personen in 9 Häusern. | |
|
1930
- 1939 "Höendede" Veteranen unter dem großen Birnbaum am "ahl Noafs Huus (später Gronewald) Von links: 1. Wilhelm Naaf, Honrath; 2. Karl Lindenberg, Oberhaus; 3. August Piel, Birken (das Honrather Original) "Höendede" Veteranen unter dem großen Birnbaum am "ahl Noafs Huus (später Gronewald) Von links: 1. Wilhelm Naaf, Honrath; 2. Karl Lindenberg, Oberhaus; 3. August Piel, Birken (das Honrather Original) | |
|
1918
Personen von links: in der Tür des „Schnieder’s Huus“ August Lindenberg mit Pfeife; 2. am Spinnrad: Julie Lindenberg geb. Radermacher; 3. Frau Lindenberg, genannt „Franz Bill“ (sie hatte in ihren hohlen Zähnen „Stöppchen“, die sie beim Essen... Personen von links: in der Tür des „Schnieder’s Huus“ August Lindenberg mit Pfeife; 2. am Spinnrad: Julie Lindenberg geb. Radermacher; 3. Frau Lindenberg, genannt „Franz Bill“ (sie hatte in ihren hohlen Zähnen „Stöppchen“, die sie beim Essen herausnahm und auf den Tisch legte); 4. Kind Otto Lindenberg (im Kleidchen!) und 5.? In 1875 wohnten in Heiden 36 Personen in 7 Häusern. . | |
|
1930
- 1939 Auf dem Foto sieht man Verwandte der Familie Königs. Abgebrochen sind inzwischen das ganz links stehende alte Haus Stommel, die in der Mitte des Bildes erkennbare Scheune Heuser und der rechts danebenstehende Stall. Ganz rechts im Hintergrund sieht... Auf dem Foto sieht man Verwandte der Familie Königs. Abgebrochen sind inzwischen das ganz links stehende alte Haus Stommel, die in der Mitte des Bildes erkennbare Scheune Heuser und der rechts danebenstehende Stall. Ganz rechts im Hintergrund sieht man die Scheune der Familie Breideneichen. Schachenauel war früher eine kunterbunt zusammengewürfelte Streusiedlung. Die Wege verliefen in Schlangenlinien um die „Mestepöhl, Ferkespremmche (Einfriedung für Schweine) on ahl Jchööchte“ herum. Verhältnismäßig viele Nicht- bzw. Kleinst-Landwirte (mit Hühnern, Schafen, Ziegen und Schweinen) bewohnten Schachenauel, das man auch Klein-Amerika nannte. Ca. ¾ der Bürger gehörten früher dem katholischen und ¼ dem evangelischen Glauben an. Ins Auge fallt heute ein altes Bruchsteinhaus am Maarweg. Frau Altenrath, die Eigentümerin, berichtete, daß ihr Opa Johann Klug, ein Backofenbauer, das Haus in Selbsthilfe vor der Jahrhundertwende errichtet hat. Die Bruchsteine stammten aus einem nahen unterhalb des Hauses Wohlhage befindlichen Steinbruch. Die ersten für den Hausbau vorgesehenen Bruchsteine habe er sogar gegen gutes Geld für den Brückenbau in Bachermühle verkauft, so daß er nochmals neue Steine brechen mußte. Im Jahre 1875 wohnten in Schachenauel 122 Personen in 29 Wohnhäusern. | |
Im unteren Bereich der „Aacherjaß“ stand die „Honnichsburch“. (damaliger Eigentümer: Albert Weber; heutige Besitzer: Familie Niebaum). Hier wohnten früher – nach einer Erzählung von Frau Emma Steeger – die nachstehend abgebildeten drei Damen... Im unteren Bereich der „Aacherjaß“ stand die „Honnichsburch“. (damaliger Eigentümer: Albert Weber; heutige Besitzer: Familie Niebaum). Hier wohnten früher – nach einer Erzählung von Frau Emma Steeger – die nachstehend abgebildeten drei Damen Schönenberg. Weil diese „so süß“ waren, nannte man ihr Haus die „Honnichsburch“. Auf dem Bild sieht man Minchen und Jettchen und in der Mitte: Hannchen Specht geb. Schönenberg. Jettchen Sch. leitete über viele Jahre das „Mathilden-Stift“ im Aggerhof. Ein Zeitungsartikel aus 1934, der nachstehend abgedruckt ist, berichtet von den Damen. | |
Im Jahre 1871 wohnten hier 37 Einwohner in 12 Häusern. Der Hohner-Bach, der heute am Hause Boddenberg auf direktem Wege in Richtung Agger (Schiffarth) fließt, nahm früher einen Umweg über den Müllerhof. Er verlief hinter Lindenberg’s Schlachthaus... Im Jahre 1871 wohnten hier 37 Einwohner in 12 Häusern. Der Hohner-Bach, der heute am Hause Boddenberg auf direktem Wege in Richtung Agger (Schiffarth) fließt, nahm früher einen Umweg über den Müllerhof. Er verlief hinter Lindenberg’s Schlachthaus (Opa des damaligen Bürgermeisters Rolf Lindenberg) und nannte sich hier „Müller-Bach“.
| |
|
1920
- 1929 Den Schornstein hat der Fotograf nachträglich ins Bild retuschiert. Vor der Krautpresse liegen Zuckerrüben. Die Ladeflächen der beiden „Mistekaare“ sind durch die Montage von „Hüfels-Brädder“ (von häufeln kommend?) erhöht. Bis zur Errichtung des... Den Schornstein hat der Fotograf nachträglich ins Bild retuschiert. Vor der Krautpresse liegen Zuckerrüben. Die Ladeflächen der beiden „Mistekaare“ sind durch die Montage von „Hüfels-Brädder“ (von häufeln kommend?) erhöht. Bis zur Errichtung des „Bau’s“ (alter Familienbesitz Mylenbusch) wurden die Häuser in Wahlscheid in Fachwerk gebaut. Beim „Bau“ handelte es sich um das erste große Haus, das in Backsteinen in Wahlscheid errichtet wurde. Im Hinblick auf das imposante Aussehen des Hauses sprach die Bevölkerung daraufhin nur noch vom „Bau“. | |
|
1930
- 1939 Der Hohner-Bach verläuft vor dem Haus „tösche“ (zwischen) Garten und Wiese. Der Garten, in dem es u.a. „Schavuel“ (Wirsing), „Schlot“ (Salat), „Öllich“ (Zwiebel), „Koenschlöt“ (Feldsalat) und „Knueschele“ (Stachelbeeren) gab, stand immer im... Der Hohner-Bach verläuft vor dem Haus „tösche“ (zwischen) Garten und Wiese. Der Garten, in dem es u.a. „Schavuel“ (Wirsing), „Schlot“ (Salat), „Öllich“ (Zwiebel), „Koenschlöt“ (Feldsalat) und „Knueschele“ (Stachelbeeren) gab, stand immer im Mittelpunkt der Einwohner. Nach Angaben von Ernst Kürten befand sich früher im Garten „et Schnickhüüschen“ (Schnitthaus oder Schreiner-Werkstatt), das der Großvater von Otto Specht handwerklich zur Herstellung von Holzstielen genutzt haben soll. Ein Wasserrad zum Antrieb von Geräten soll ebenfalls hier gestanden haben. Gegenüber dem Haus Dr. Lohmar befand sich ein Weiher; der Hohner-Bach war hier gestaut. Bis zu dem „Schnickhüüschen“ rodelten früher die Kinder die „Aacherjaß“ (Aggergasse; heutiger Pestalozziweg) hinunter. Dieser Weg war noch im vorigen Jahrhundert die einzige Verbindung aus dem Aggerhof zur St. Bartholomäus-Kirche und Schule. Hugo Schiffbauer, der heute in dem Haus Specht wohnt, wurde von Vorfahren überliefert, daß in dem Haus früher Gottesdienste stattgefunden haben sollen. Dies ist durchaus möglich, da die Protestanten während der Wirren der Reformationszeit eine Zeitlang die St. Bartholomäus-Kirche nicht betreten durften. Ebenso soll sich laut Hugo Sch. damals in dem Haus eine Gaststätte mit Kegelbahn befunden haben. Auch das ist glaubhaft, da sich die Bewohner aus den entfernten Weilern – insbesondere früher – nach einem Gottesdienstbesuch gerne zusammensetzten. Man war meist miteinander verwandt, sah sich die ganze Woche nicht und hatte sich viel zu erzählen. | |
|
1891
Der Eigentümer (vom Fotografen 1891 als Einsiedler bezeichnet) sitzt vor seinem „Jehööch“ (altes Haus). Viele „Kruffes“ (kleine Räume) hatte der Anbau links; hier wohnte nach dem 1. Weltkrieg die Familie Zimmermann mit 9 Kindern. Die kleinen Räume... Der Eigentümer (vom Fotografen 1891 als Einsiedler bezeichnet) sitzt vor seinem „Jehööch“ (altes Haus). Viele „Kruffes“ (kleine Räume) hatte der Anbau links; hier wohnte nach dem 1. Weltkrieg die Familie Zimmermann mit 9 Kindern. Die kleinen Räume im atmungsaktiven Fachwerkhaus waren kuschelig. Strahlenbelastung aus Baumaterial kannte man nicht. Nur die Weidenbäume deuten daraufhin, daß vor dem Haus – von der Bäckerei Specht kommend – der Hohner-Bach herfloß. Im Bild rechts sind die Münchhofener Straße als damaliger schmaler Weg und ein weiteres – inzwischen abgebrochenes – Fachwerkhaus erkennbar; möglicherweise handelt es sich um die frühere „Näelschmitt“ (Nagelschmiede) der Familie Brass. „Brass Hann“, die Oma der „Kürten Jonge“ war eine resolute Frau. Dazu Enkel Emst Kürten, Münchhof: Um die Einkommenslage etwas zu verbessern, hielt sie Schweine. Obwohl sie keine Waage besaß, konnte ihr hinsichtlich des Gewichtes der Schweine keiner etwas vormachen; sie ermittelte mit einem Bandmaß den Umfang des Tieres und konnte so das genaue Gewicht des Schweines bestimmen.
| |
|
1913
- 1914 Der „Fließengarten“ bestand nur aus einem Haus. Wilhelm Fischer mit seinen fünf Söhnen (davon betätigten sich vier als Gastwirte in umliegenden Großstädten), Schwiegertöchtern und Tochter Julie Schaub geb. Fischer (sitzend rechts; Mutter von... Der „Fließengarten“ bestand nur aus einem Haus. Wilhelm Fischer mit seinen fünf Söhnen (davon betätigten sich vier als Gastwirte in umliegenden Großstädten), Schwiegertöchtern und Tochter Julie Schaub geb. Fischer (sitzend rechts; Mutter von „Schaub’s“ Jenny Bender). Das Foto stammt aus der Zeit kurz vor dem 1. Weltkrieg. An der Haustür erkennt man die Hausnummer 1, obwohl nur ein Haus im Fließengarten stand. Die bestickte Kappe des im „Sorge“ (Korblehnsessel) sitzenden Familienoberhauptes war sein Markenzeichen. Seine lange Porzellanpfeife zündete er mit einer „Fimp“ (Holzspahn, der in die Ofenglut gehalten wurde) an. Auch in Krisenzeiten sorgten die Männer dafür, daß die Pfeife nicht ausging. Hugo Ingersauel vom Berg soll in Notzeiten „Kliesomenkaaf’ (Kleesamenspreu) geraucht haben. Wenn der Klee reif war, wusch er ihn und drehte ihn durch die „Wannmüll“. Die Spreu rauchte er in der Pfeife. Das Haus und die Straße lagen auf gleicher Höhe. Sie waren durch einen Grünstreifen voneinander getrennt. Die an der Hauswand befindlichen Kellerlöcher, durch die im Herbst die Briketts und Kartoffeln in den Keller gelangten, wurden im Winter mit Heu, Stroh oder Kuhmist dichtgemacht. 1945 mußte das Haus – nach der Explosion des Munitionszuges am Wahlscheider Bahnhof – abgebrochen werden. Im Hintergelände errichtete „Schaub’s Jenny“ in den Jahren 1946/48 den „Neubau“ Wahlscheider Straße 48. In dem auf dem Bild erkennbaren alten Haus eröffnete Kurt Schaub (Vater von Horst und Christa) sein Elektro-Haushaltwaren-Geschäft. | |
|
1920
- 1929 Ins Auge fiel schon immer die Villa Haas (heute Leonore Bonow).Der Keller wurde mit Bruchsteinen – meist von darauf spezialisierten oberbergischen Maurern – gebaut. Es handelte sich um hammerrechte Steine, die aus heimischen Grauwacke-Steinbrüchen... Ins Auge fiel schon immer die Villa Haas (heute Leonore Bonow).Der Keller wurde mit Bruchsteinen – meist von darauf spezialisierten oberbergischen Maurern – gebaut. Es handelte sich um hammerrechte Steine, die aus heimischen Grauwacke-Steinbrüchen kamen. Jeder Stein mußte mit Geschicklichkeit und Kraft zugehauen werden. Die Villa wurde 1911 errichtet. Leonore Bonow, die heutige Eigentümerin, zu dem Haus: „Es war das erste Haus, das Architekt Fritz Becker aus Siegburg-Mülldorf plante. Es ist eigentlich stillos, weist aber Merkmale des Jugendstils und der Gründerjahre auf und ist geschlossen in seinem Anblick.“ | |
|
1930
Das Pastorat wurde urkundlich das erste Mal 1609 erwähnt. Pfarrer Wilhelm Kauert hatte in den 30er Jahren das „Hohndersch“ (Hühnerhaus) aus der Scheune in das Pastoratsgebäude hinter seine Küche (auf dem Bild rechts) verlegen lassen, nachdem... Das Pastorat wurde urkundlich das erste Mal 1609 erwähnt. Pfarrer Wilhelm Kauert hatte in den 30er Jahren das „Hohndersch“ (Hühnerhaus) aus der Scheune in das Pastoratsgebäude hinter seine Küche (auf dem Bild rechts) verlegen lassen, nachdem Wahlscheid’s bekannter Räuber August Eimermacher (dazu an anderer Stelle mehr) einige Hühner gestohlen und geschlachtet hatte. An dieser Sicherheitsvorkehrung erkennt man, wie wichtig damals Hühner auch für einen Pfarrerhaushalt waren. | |
Der Auelerhof ist lieblich eingeschlossen von Feld und Wald. Im Jahre 1871 wohnten dort 145 Personen in 31 Häusern. Aus der „Dell“ wo sich heute der Kinderspielplatz befindet, ging man den „Steier’s“ (Steeger) Berg hoch zum Heiligenstock . Das... Der Auelerhof ist lieblich eingeschlossen von Feld und Wald. Im Jahre 1871 wohnten dort 145 Personen in 31 Häusern. Aus der „Dell“ wo sich heute der Kinderspielplatz befindet, ging man den „Steier’s“ (Steeger) Berg hoch zum Heiligenstock . Das evangelische Altenheim steht auf dem „Rösemig“. Im Auelerhof herrschte durch die gleichnamige Gaststätte und das dort befindliche Postamt bereits früher ein reges Leben. Landwirtschaft im Auelerhof betrieben nach dem 1. Weltkrieg: Otto Hohn (heute Helmut Hohn als letzter Landwirt im Jrongk), Otto Kirschbaum (heutiges Anwesen Zimmermann, Haus Säemann) und Emil Wasser. Von 1928 bis ca. 1933 befand sich in der Gaststätte Aggerufer eine Molkerei und Käserei der Firma Flockerts Söhne, Köln. Die frisch angelieferte Milch der Wahlscheider Bauern (damals lieferten sie noch nicht direkt nach Köln) wurde in großen Bassins für Schichtkäse gesäuert. | |
|
1932
In der Nacht zum Pfingstsonntag gingen früher nach einem alten Brauch die jungen Männer - "Pengsjonge" - des Dorfes "Pengseier senge". In Gruppen gingen sie von Dorf zu Dorf, sangen ihre Pfingstlieder und erhielten von den Dorfbewohnern Pfingsteier.... In der Nacht zum Pfingstsonntag gingen früher nach einem alten Brauch die jungen Männer - "Pengsjonge" - des Dorfes "Pengseier senge". In Gruppen gingen sie von Dorf zu Dorf, sangen ihre Pfingstlieder und erhielten von den Dorfbewohnern Pfingsteier. Zum Abschluss kehrten sie irgendwo mit ihrem Korb voller Eier ein, schlugen die Eier in die Pfanne und genossen bis in den frühen Morgen hinein bei guter Laune den Eierkuchen. Alte Schachenaueler berichteten: " Hermann Wasser, Honsbacher Mühle, genannt "Bär" freute sich sehr, wenn die "Pengsjonge" nachts zum Eierverzehr bei ihm einkehrten. Dann versetzte er sie mit seinen in großen Fässern lagernden Wein und Trester in gute Laune." Auf dem Bild links im Kinderwagen liegen wahrscheinlich die gesammelten "Pengseier". "Däe Bär" hält schon einen großen Weinbehälter für die Bewirtung bereit. Die Dame rechts trägt in ihrer rechten Hand die "Pann", um die Eier zu backen.
| |
|
1920
- 1929 Wahlscheid, ein „Tor zum Bergischen Land“, liegt im unteren Aggertal am Fuße des Niederbergischen Landes. Hinter Lohmar/Donrath, einem Zipfel der dichtbesiedelten Köln-Bonner Bucht, nehmen die Ausläufer des Bergischen Landes deutlich an Höhe zu. Wald... Wahlscheid, ein „Tor zum Bergischen Land“, liegt im unteren Aggertal am Fuße des Niederbergischen Landes. Hinter Lohmar/Donrath, einem Zipfel der dichtbesiedelten Köln-Bonner Bucht, nehmen die Ausläufer des Bergischen Landes deutlich an Höhe zu. Wald und Wiesen beherrschen die Landschaft.Die typischen Merkmale des Bergischen Landes, nämlich Hügel, Berge und Täler sowie Wechsel zwischen Feld, Wald und Wiese sind in Wahlscheid in einer Vielzahl vorhanden. Die Talsohle von Wahlscheid befindet sich auf ca. 70m Höhe. Viele kleine Bachtäler, Schluchten und Siefen zerfurchen die Bergrücken, die zu der Südbergischen Lößhochfläche gehören. Die Höhenrücken steigen bis zu ca. 200m an.Das untere Aggertal kann sich hinsichtlich seiner Schönheit mit jedem anderen deutschen Landstrich messen. Was sieht man auf dem Bild? Emst Hohn, Aggerhof, erinnerte sich, daß man damals in der Höhe des Steinbruchs eine Behelfsbrücke über die Agger errichtete; Loren (Kippwagen) übernahmen den Transport der Steine. Im Bildhintergrund fließt die Agger – einem breiten Band gleich – durch die reizende Aue der Sieg und dem Rhein entgegen. Vereinzelt stehende Weiden lockern die Landschaft auf. ln Wahlscheid fließt die Agger an zwei Stellen „strack“ (geradewegs) auf die beiden Felswände „Pastoratsberg“ und „Spechtsberg“ (Ausläufer der „Ley“) zu, als wenn sie sich durch sie hindurchbohren wollte. Sie wird im 90° Winkel in ihre Schranken verwiesen, macht aber anschließend mit kleinen Stromschnellen und Strudeln auf sich aufmerksam. Zwischen dem „Pastuurschloch“ (Untiefe der Agger in der Nähe des Pastorats) und dem „Päedskümpel“ fließt die Agger durch die gesamte ca. 500m breite Talsohle. | |
Der Lohmarer Wald, etwa zwischen Siegburg und Lohmar im Süden und Norden, sowie zwischen Agger und Zeithstraße im Westen und Osten gelegen, war schon vor über 1000 Jahren ein begehrtes Gebiet. Das Kloster Vilich übte nach der Klostergründung 987 mit... Der Lohmarer Wald, etwa zwischen Siegburg und Lohmar im Süden und Norden, sowie zwischen Agger und Zeithstraße im Westen und Osten gelegen, war schon vor über 1000 Jahren ein begehrtes Gebiet. Das Kloster Vilich übte nach der Klostergründung 987 mit seiner ersten Äbtissin, der hl. Adelheidis, die erste Lehnsherrschaft über den Lohmarer Markenwald aus. Dazu gesellten sich später die Benediktiner-Abtei Siegburg und das Cassiusstift in Bonn. Die Kanoniker dieses Stiftes der Heiligen Cassius und Florentius (die beiden Stadtpatrone von Bonn) besaßen offiziell seit 1131 in Lohmar den Fronhof (siehe auch Lohmarer HBl Heft 7/1993). Von diesem konnten sie vor Ort über ihren eingesetzten Pächter, auch Halfen genannt, unmittelbaren Einfluss auf den Lohmarer Wald ausüben. Auch die weltlichen Herrschaftskreise wie die von Jülich-Berg und von Blankenberg zogen ihre Vorteile aus den so genannten Waldgerechtigkeiten. Im Laufe der Zeit gingen aber auch immer mehr Waldrechte an Privatpersonen und Familien in Lohmar und Siegburg, sogar nach Troisdorf, Menden und Sieglar. Die Rechte wurden in der Folge von den Ahnen ererbt. So entstand der damalige Begriff der Ahnerben. Der Kreis der an den Erträgnissen des Markenwaldes berechtigten Märkern, die man nach ihrer standesmäßigen Herkunft in Obermärker und Niedermärker einteilte, wurde so mit den Jahren größer. Wegen der vielfältigen Nutzung des Waldes durch eine größere Zahl von Märkern wurden Richtlinien und Regeln aufgestellt. Diese fanden ihren Niederschlag in den so genannten Waldweistümern und in den Waldbüchern. Das älteste noch vorhandene Weistum des Lohmarer Markenwaldes stammt aus dem Jahr 1494. Es wurde nachweislich in den Jahren zwischen 1500 und 1671 zehnmal ergänzt und erweitert und vielleicht auch auf neue Erkenntnisse der Mehrheit der Märker hin verändert. Alle schriftlichen Unterlagen, wie Weistum, Waldbücher und Protokolle wurden in der Waldkiste aufbewahrt. Auch andere wichtige Gegenstände wurden in ihr verwahrt. Dazu gehörten das Waldbeil und das Brenneisen, mit dem die zur Eichelmast berechtigten Schweine gebrandmarkt wurden. Die Waldkiste war mittels dreier Schlösser verschlossen und wurde damals in der Pfarrkirche Sankt Johannes Enthauptung Lohmar deponiert. | |
1954/55 kam es auf dem ehemaligen Gelände des Landwirts Bernhard Kurscheid zwischen Lohmar-Ort und Ziegelfeld zum ersten Bauabschnitt in Lohmar. Zu dieser Zeit erreichte die Beschäftigungszahl 399 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz betrug 12 Mill. DM.... 1954/55 kam es auf dem ehemaligen Gelände des Landwirts Bernhard Kurscheid zwischen Lohmar-Ort und Ziegelfeld zum ersten Bauabschnitt in Lohmar. Zu dieser Zeit erreichte die Beschäftigungszahl 399 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz betrug 12 Mill. DM. 1956 folgte die erste Maschinenhalle und damit die Verlagerung der wachsenden Gelenkwellen- Fertigung nach Lohmar. 1957 wurde das Programm durch Rohrverschraubungen für die Hydraulikund Pneumatik erweitert. Im Oktober 1958 begann man mit der Errichtung des Hauptverwaltungsgebäudes nach den Plänen von Architekt Stricker, in das man schon im Juli des folgenden Jahres einziehen konnte. Bauaufsicht und Bauleitung hatten Rainer Schäferdiek und Franz Flögerhöfer. Auf diese Weise erfolgte die Verlegung des gesamten Unternehmens von Siegburg nach Lohmar. | |
Im Winkel von Bachstraße und Hermann-Löns-Straße, wo heute das neue Seniorenheim steht, fanden Archäologen bei Ausgrabungen im Jahr 2005 Reste von Grubenhäusern, Keramik und Münzen aus nachrömischer Siedlungszeit – Bild unten zeigt die Rekonstruktion... Im Winkel von Bachstraße und Hermann-Löns-Straße, wo heute das neue Seniorenheim steht, fanden Archäologen bei Ausgrabungen im Jahr 2005 Reste von Grubenhäusern, Keramik und Münzen aus nachrömischer Siedlungszeit – Bild unten zeigt die Rekonstruktion eines fränkisch-merowingischen Hofgutes. | |
|
450
- 520 In der Verfüllung eines Grubenhauses (Stelle 4) fand sich ein Börsenfund mit fünf merowingischen Nachprägungen von römischen Silbermünzen. Eine davon zeigt die Abbildung des byzantinischen Kaisers Anastasios I. (491 bis 518 n. Chr.) und datiert um... In der Verfüllung eines Grubenhauses (Stelle 4) fand sich ein Börsenfund mit fünf merowingischen Nachprägungen von römischen Silbermünzen. Eine davon zeigt die Abbildung des byzantinischen Kaisers Anastasios I. (491 bis 518 n. Chr.) und datiert um 520 n. Chr. Die anderen Münzen sind in die zweite Hälfte des 5. Jh. einzuordnen. Aufgrund der Münze des Kaisers Anastasios I. kann ein ungefähres Ende der Siedlung in der ersten Hälfte des 6. Jh. eingeordnet werden. | |
|
1081
Die erste urkundliche Nennung von Lohmar erhalten wir aus einer Urkunde von 1081, nach der Erzbischof Sigewin von Köln dem Kölner St, Georgsstift u. a. einen Hof zu Lohmar schenkt: "Lomere mansum unum, soluentem sex solidos", einen Mansus (ca. 40... Die erste urkundliche Nennung von Lohmar erhalten wir aus einer Urkunde von 1081, nach der Erzbischof Sigewin von Köln dem Kölner St, Georgsstift u. a. einen Hof zu Lohmar schenkt: "Lomere mansum unum, soluentem sex solidos", einen Mansus (ca. 40 Morgen Ackerland), zu zahlen 6 Solidos (Goldstücke). | |
|
1986
Im Jahre 1209 wird die Pfarrkirche St. Margaretha in Honrath erstmals Urkundlich genannt. Damals schenkten Graf Adolf von Hückeswagen und seine Gemahlin Adele das Patronat der Honrather Kirche mit allen Appertinentien mit Ausnahme der an den Westturm... Im Jahre 1209 wird die Pfarrkirche St. Margaretha in Honrath erstmals Urkundlich genannt. Damals schenkten Graf Adolf von Hückeswagen und seine Gemahlin Adele das Patronat der Honrather Kirche mit allen Appertinentien mit Ausnahme der an den Westturm anschließenden festen Burg, dem Kloster Gräfrath bei Solingen. Der staufische Westturm aus Bruchsteinmauerwerk aus dem 12. Jahrhundert wurde nach einem Brand von 1895 erneuert Das romanische Langhaus ist in den Jahren 1856/57 erneuert worden, es ersetzte das alte baufällig gewordene Hauptschiff. 1259 ging die Burg an den Grafen von Sayn zu Blankenberg und 1363 zusammen mit dem Kirchspiel Honrath an die Grafen von Berg. 1610 fiel die Burg durch Heirat an die Familie von Hammerstein und seit dem Jahre 1716 an die jeweiligen Besitzer des Schloss Auel. 1614 wird die Kirchengemeinde Honrath evangelisch. | |
|
1940
- 1986 Das Bild zeigt den noch steinsichtigen Turm und das Kirchenschiff. Im Jahre 1209 wird die Pfarrkirche St. Margaretha in Honrath erstmals urkundlich genannt. Damals schenkten Graf Adolf von Hückeswagen und seine Gemahlin Adele das Patronat der... Das Bild zeigt den noch steinsichtigen Turm und das Kirchenschiff. Im Jahre 1209 wird die Pfarrkirche St. Margaretha in Honrath erstmals urkundlich genannt. Damals schenkten Graf Adolf von Hückeswagen und seine Gemahlin Adele das Patronat der Honrather Kirche mit allen Appertinentien mit Ausnahme der an den Westturm anschließenden festen Burg, dem Kloster Gräfrath bei Solingen. Der staufische Westturm aus Bruchsteinmauerwerk aus dem 12. Jahrhundert wurde nach einem Brand von 1895 erneuert. Das romanische Langhaus ist in den Jahren 1856/57 erneuert worden, es ersetzte das alte baufällig gewordene Hauptschiff. | |
Der Junggesellenverein Lohmar feierte sein Stiftungsfest am 3. Juli 1938 . Eine Delegation steht vor dem Eingang zum Hause Becker auf der Hauptstraße Nr. 124. Im Hintergrund ist das Haus Gerhards,Hauptstraße Nr. 122. Von links nach rechts sieht man... Der Junggesellenverein Lohmar feierte sein Stiftungsfest am 3. Juli 1938 . Eine Delegation steht vor dem Eingang zum Hause Becker auf der Hauptstraße Nr. 124. Im Hintergrund ist das Haus Gerhards,Hauptstraße Nr. 122. Von links nach rechts sieht man 1. Richard Höndgesberg, 2. Fendelschwenker Willi Kurtsiefer, 3. Andreas Roland und 4. Adolf Becker. Von den Kindern ist der Junge links Rainer Fischer. | |
Die Honoratioren des Junggesellenvereins Lohmar 1957 in der Kutsche. Wahrscheinlich beim 60. Stiftungsfest 1957 hat der Junggesellenverein Lohmar seine Honoratioren beim Umzug durch das Dorf in einer Kutsche mitgeführt. Auf dem Foto sind zu sehen:... Die Honoratioren des Junggesellenvereins Lohmar 1957 in der Kutsche. Wahrscheinlich beim 60. Stiftungsfest 1957 hat der Junggesellenverein Lohmar seine Honoratioren beim Umzug durch das Dorf in einer Kutsche mitgeführt. Auf dem Foto sind zu sehen: v.l.n.r Hans Ketteler?, unbekannt, Hennes Höndgesberg, Herbert Nöttel, Adolf Becker, Bältes Dunkel, unbekannt, Johannes Schröder, Helmut Kotz. | |
|
1930
Wir sehen den Förster Johann Peter Kuttenkeuler um 1930. Er wurde am 22.5.1867 in Donrath geboren und heiratete am 18.7.1908 Maria Wilhelmina Pieper, mit der er zwei Töchter hatte. Seine Eltern waren Johannes Kuttenkeuler und Anna Helena Becker. Wir sehen den Förster Johann Peter Kuttenkeuler um 1930. Er wurde am 22.5.1867 in Donrath geboren und heiratete am 18.7.1908 Maria Wilhelmina Pieper, mit der er zwei Töchter hatte. Seine Eltern waren Johannes Kuttenkeuler und Anna Helena Becker. | |
|
1942
Ludwig Polstorff wurde 1862 in Güstrow (Mecklenburg-Schwerin) geboren, ging nach dem „Einjährigen“ zum preußischen Militär und wurde 1885 ins Rheinland versetzt. 1892 heiratete er hier seine Frau Auguste Diederichs. Er war evangelisch, sie... Ludwig Polstorff wurde 1862 in Güstrow (Mecklenburg-Schwerin) geboren, ging nach dem „Einjährigen“ zum preußischen Militär und wurde 1885 ins Rheinland versetzt. 1892 heiratete er hier seine Frau Auguste Diederichs. Er war evangelisch, sie katholisch; daher mußte er aus der Armee austreten. Mit seiner Ehefrau hatte er drei Kinder, die er katholisch erziehen ließ. Von 1896 bis 1906 war Ludwig Polstorff Bürgermeister in Zerf bei Trier und kam 1906 nach Lohmar, wo er vom 1.4.1906 bis zum 31.12.1927 ebenfalls das Amt des Bürgermeisters ausübte. Hier baute er an der Hauptstraße (heute Nr. 25) ein neues Bürgermeisteramt, das 1908 bezogen wurde. Er sorgte für eine zentrale Wasserversorgung und für Gas und Strom in Lohmar, nahm teil am passiven Widerstand gegen die französische Besatzung nach dem Ersten Weltkrieg und wurde deshalb als missliebige Person für 1½ Jahre ausgewiesen. Ludwig Polstorff hat sich nicht nur in seinem Amt, sondern auch um die Minderheit der evangelischen Einwohner verdient gemacht. (Quelle: Festschrift der Evangelischen Kirchengemeinde Lohmar, Lohmar 1989, Seite 39ff.) Am 6.12.1906 hat Polstorff den „Bienenzuchtverein Lohmar und Umgegend e.V.“ gegründet und war bis 1943 deren Vorsitzender. Ferner gründete er am 9.6.1909 den „Kreisbienenzuchtverband Sieg“ und blieb deren Vorsitzender bis 1946. | |
|
1934
Das Foto ist aus dem Jahre 1934 und zeigt Professor Joseph Carl Maria Prill mit 82 Jahren. Joseph Prill wurde am 9.6.1852 in Beuel geboren. Er wurde am 9.11.1875 im Kölner Dom zum Priester geweiht, war von 1880 bis 1883 im Vatikan und von 1889 bis... Das Foto ist aus dem Jahre 1934 und zeigt Professor Joseph Carl Maria Prill mit 82 Jahren. Joseph Prill wurde am 9.6.1852 in Beuel geboren. Er wurde am 9.11.1875 im Kölner Dom zum Priester geweiht, war von 1880 bis 1883 im Vatikan und von 1889 bis 1918 Religionslehrer am Burg- Gymnasium in Essen. Dort lernte er auch Rektor Peter Klein aus Donrath kennen, der ebenfalls in Essen lehrte. Professor Prill besuchte häufiger Rektor Klein in seiner Villa auf der Burghardt in Donrath. Da ihm die Gegend um Donrath so gut gefiel, kaufte er 1911 auf dem Hollenberg zwei Morgen Land und baute dort für sich die Villa „Haus Hollenberg“ (siehe S. 24). Doch schon 1924/25 wurde auf Ersuchen seiner Schwester, Mutter Oberin Willibalda vom Waisenhaus in Köln-Sülz, das von der „Genossenschaft vom armen Kinde Jesu“ betrieben wurde, die Villa für ein Schwestern-Erholungsheim erweitert. 1960-1963 baute die Genossenschaft dort das „Kinderdorf Hollenberg“ und 1964 wurde die wunderschöne Villa abgerissen. Unter der Leitung von Professor Prill wurde 1900 die Lohmarer Pfarrkirche auf drei Schiffe erweitert und 1930 die Halberger Kapelle umgebaut. Professor Joseph Carl Maria Prill starb am 8.10.1935 auf dem Hollenberg. Quelle: Monographie von Wilhelm Pape, Professor Prill und der Hollenberg Lohmar 1993. | |
|
1910
Auf dem Foto ist Pfarrer Paul Joseph Düsterwald um 1910 abgebildet. Er wurde am 29.10.1839 in Vielich geboren, am 7.4.1866 zum Priester geweiht, war nach Kaplanstellen in Odenkirchen und Grimminghausen von 1886 bis 1895 Pfarrer in Scheiderhöhe und... Auf dem Foto ist Pfarrer Paul Joseph Düsterwald um 1910 abgebildet. Er wurde am 29.10.1839 in Vielich geboren, am 7.4.1866 zum Priester geweiht, war nach Kaplanstellen in Odenkirchen und Grimminghausen von 1886 bis 1895 Pfarrer in Scheiderhöhe und von 1895 bis 1922 Pfarrer in Lohmar. Im Alter von 87 Jahren ist er am 19.12.1926 geehrt mit dem Titel eines Ehrenkammerherrn Sr. Heiligkeit, im Siegburger Krankenhaus verstorben. Als er nach Lohmar kam, baute er als erstes 1896 ein neues stattliches Pfarrhaus, damit er standesgemäß wohnen konnte. Ferner wurde in seiner Zeit im Jahr 1900 die Pfarrkirche zwischen Turm und Chor abgerissen und dazwischen ein neuromanisches dreischiffiges Langhaus gebaut. In dieser Zeit war vor der alten Vikarie eine hölzerne Notkirche errichtet worden. Aber Weihnachten konnte schon wieder die Messe in der Kirche gefeiert werden.Als er 1922 in den Ruhestand ging hatte er sich geweigert das Pfarrhaus zu räumen, so daß sein Nachfolger, Pfarrer Johannes Hellen fünf Jahre in der alten Vikarie wohnen mußte (danach wohnte dort der Küster ThomasKappes). | |
| |
| |
| |
|
1980
| |
Auf dem Foto sieht man jeweils von links nach rechts in der hinteren Reihe: 1. unbekannt, 2. Fritz Ullrich, 3....
Auf dem Foto sieht man jeweils von links nach rechts in der hinteren Reihe: 1. unbekannt, 2. Fritz Ullrich, 3. unbekannt, 4. Diethelm Schmitz (Rechtsanwalt), 5. Christel Schulten geb. Broicher, 6. Reinhold Schmidt (Sohn von Rektor Schmidt), 7. Marlene Michels geb. Schönenborn, 8. Hans Braschoß, 9. Rosemarie Klein geb. Küpper, 10. Josef Jung, 11. unbekannt, 12. Hubert Hagen, 13. Anneliese Krieger geb. Rottländer; in der mittleren Reihe: 1. Paul Klein, 2. Hedwig Ramme, 3. und 4. unbekannt, 5. Hans Köb, 6. Günter Klein, 7. Bruno Kümmler, 8. Elisabeth Meldau geb. Baum, 9. Thea Inden geb. Müller, 10. Richard Ramme, 11. Resi Katterfeld geb. Pape, 12. Hermann Mosbach; und in der vorderen Reihe: 1. Hans Altwickler, 2. Irene Henseler geb. Keymer, 3. Kätti Schüller, 4. und 5. unbekannt, 6. Lehrer Fritz Nußbaum (war von 1930 – 1934 an der Volksschule in Lohmar), 7. Lene van Joch, 8. Katharina Müller, 9. unbekannt, 10. Friedrich Ramme, 11. Leni Distelrath, 12. Theo Dunkel und 13. Balthasar Krieger. | |
| |
| |
| |
|
27. Oktober 1967
| |
| |
| |
|
1930
- 1939
| |
|
1971
- 1972
| |
|
1966
| |
|
1966
| |
|
1960
- 1969
| |
| |
| |
|
1960
- 1969
| |
| |
|
1965
Mittlere Reihe von links nach rechts:
| |
| |
|
1950
| |
|
1960
- 1969
| |
| |
| |
| |
|
1955
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
1951
- 1952
| |
|
14. August 1950
| |
Diese Teilansicht der Kirche St. Georg im Heidedorf Altenrath zeigt die Nordwestfassade der äußerlich noch unverputzten Kirche. Die bittere Erkenntnis, dass die Luftverunreinigungen (CO) den Steinzerfall an historischen Gebäuden ganz besonders... Diese Teilansicht der Kirche St. Georg im Heidedorf Altenrath zeigt die Nordwestfassade der äußerlich noch unverputzten Kirche. Die bittere Erkenntnis, dass die Luftverunreinigungen (CO) den Steinzerfall an historischen Gebäuden ganz besonders begünstigt, hatte sich erst viel später, in den sechziger Jahren eingestellt. Auf dem Bild zu sehen sind die Sakristei, das Querschiff, die Apside (das Seitenschiff), das Hauptschiff und der Turm der Kirche sowie ein Teil des historischen Kirchhofs. Größere Restaurierungen fanden 1951 und zwischen 1964 und 1967 statt. Seit Mitte der sechziger Jahre sind der Turm und das Kirchenschiff außen verputzt. | |
| |
|
1940
- 1949
| |
| |
| |
| |
|
1940
- 1949
| |
|
1930
- 1950
| |
|
2000
Die Burg Sülz ist eine aus pfalzgräflichem Besitztum hervorgegangene und spätestens 1075 urkundlich erwähnte Wasserburg. Das Gut liegt an der westlichen Grenze des Lohmarer Stadtgebietes im Sülztal, an der L288, zwischen Donrath und Rösrath und... Die Burg Sülz ist eine aus pfalzgräflichem Besitztum hervorgegangene und spätestens 1075 urkundlich erwähnte Wasserburg. Das Gut liegt an der westlichen Grenze des Lohmarer Stadtgebietes im Sülztal, an der L288, zwischen Donrath und Rösrath und zählt zu den ältesten Adelssitzen des rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreises. Aus der historischen Zeit haben sich nur der von Ecktürmen flankierte Westflügel und eine Fachwerkscheune erhalten. Der Westflügel der Burg liegt parallel zur Sülztalstraße. Der aus Bruchstein gemauerte nordwestliche Flügel ist eine nachträgliche Ergänzung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Außerdem fügte man Teile des nördlichen Flügels hinzu und ergänzte das Anwesen mit jüngeren Nebengebäuden zu einer vierflügeligen Hofanlage. 1996 wurde die Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Lohmar mbH gegründet. Sie erwarb die Burg und die landwirtschaftlichen Flächen und verkaufte die Burg 1998 weiter. Mit viel Glas und Metall und unter Beibehaltung historischer Bausubstanz entstand der „Technologiehof Burg Haus Sülz“, ein helles und freundliches, übersichtliches Haus mit hohem Wiedererkennungswert und eigenem Charakter, das 2000 eröffnet wurde. Auf den ehemals landwirtschaftlichen Flächen entstand der Gewerbepark Burg Sülz und der Krewelshof. | |
| |
|
1940
| |
| |
|
1938
Das Lohmarer Jungvolk vor dem Haus Scharrenbroich (heute Nr. 18/20) auf der Hauptstraße in Lohmar sammelt sich zum Abmarsch. Es soll zu Fuß über Rösrath zum Königsforst gehen und dann mit der Bahn nach KölnDünnwald ins Zeltlager. Im Jungvolk wurden... Das Lohmarer Jungvolk vor dem Haus Scharrenbroich (heute Nr. 18/20) auf der Hauptstraße in Lohmar sammelt sich zum Abmarsch. Es soll zu Fuß über Rösrath zum Königsforst gehen und dann mit der Bahn nach KölnDünnwald ins Zeltlager. Im Jungvolk wurden Jungen im Alter von 10 - 14 Jahren auf die spätere Rolle in der Hitlerjugend vorbereitet.Sie hießen "Pimpfe". | |
Hier steht ein Teil der Messdiener von Lohmar 1938 mit Kaplan Müller vor dem Pfarrheim in der Kirchstraße. Das Pfarrheim war an die Kaplanei angebaut – beide sind noch unverputzt. Bis um das Jahr 2000 war in den Gebäuden das Wasserwerk...
Hier steht ein Teil der Messdiener von Lohmar 1938 mit Kaplan Müller vor dem Pfarrheim in der Kirchstraße. Das Pfarrheim war an die Kaplanei angebaut – beide sind noch unverputzt. Bis um das Jahr 2000 war in den Gebäuden das Wasserwerk untergebracht. Heute ist dort der Lidl-Parkplatz. | |
|
1930
- 1939
| |
|
1937
- 1938
| |
| |
| |
| |
Hauptlehrer Richard Müller mit seiner Klasse 1936 Hauptlehrer Richard Müller mit seiner Klasse 1936 | |
| |
|
1935
| |
|
1932
- 1933
| |
| |
| |
|
1928
- 1929
| |
|
1924
- 1925
| |
Die Fotografie der 1920er Jahre zeigt das angeschnittene Fachwerkhaus am Griesberg, Mühlenweg (Ecke Mühlen- bzw. Auelsbach), das Gebiet zwischen der unteren Buchbitze und der Kieselhöhe, direkt im Anschluss an der Lohmarer Mühle. Beim Haus in der... Die Fotografie der 1920er Jahre zeigt das angeschnittene Fachwerkhaus am Griesberg, Mühlenweg (Ecke Mühlen- bzw. Auelsbach), das Gebiet zwischen der unteren Buchbitze und der Kieselhöhe, direkt im Anschluss an der Lohmarer Mühle. Beim Haus in der Mitte, kurz vor dem Grundstück des ehemaligen Schmitthofs, handelt es sich um das Fachwerkgebäude der Eheleute Katharina und Wilhelm Kurtsiefer (heute Fam. Samorey), Mühlenweg 40. Der Mühlenweg, der über die Brücke des Mühlenbachs (Auelsbach) führt, ist noch nicht befestigt. Der Bach fließt noch das letzte Stück in der offenen Vorflut ehe er in der Verrohrung der Bachstraße verschwindet. | |
Um 1920 stehen auf der „Alte Lohmarer Straße“ in Höhe des Hauses Henseler (Alte Lohmarer Str. 46) drei alte Frauen in ihrer typischen Alltagskleidung. Von links nach rechts sind das Anna Maria Haas (geb. 1863), Anna Maria Lohr... Um 1920 stehen auf der „Alte Lohmarer Straße“ in Höhe des Hauses Henseler (Alte Lohmarer Str. 46) drei alte Frauen in ihrer typischen Alltagskleidung. Von links nach rechts sind das Anna Maria Haas (geb. 1863), Anna Maria Lohr (geb. 1857) und Anna Margarethe Hagen (geb. 1853, Oma von Hubert Hagen in der Gartenstraße). Alle drei haben ein Tuch über dem linken Armhängen. Mit solchen Tüchern gingen zur damaligen Zeit die Frauen in den Wald, um darin „Streu“ (Laub,verdorrtes Farn, Gras usw.) für das Vieh zu sammeln. Das wurde dann zusammengebunden und auf dem Kopf nach Hause getragen. | |
|
1918
| |
Auf dem Foto...
Auf dem Foto von 1910 sind jeweils von links nach rechts in der oberen Reihe zu sehen: 1. Katharina Kirschbaum, verh. Klein (Mutter von Erich und Günter Klein), 2. und 3. Geschwister Scharrenbroich aus Eichen, 4. unbekannt, 5. Elisabeth Herkenrath, verh. Specht, 6. Paula Duffhaus, 7. Sibille Pape; zweite Reihe: 1. ? Küpper aus Ellhausen, 2. und 3. unbekannt, 4. Maria Boddenberg, 5. Settchen Altwickler, 6. unbekannt, 7. Sophie Küpper von Lohmarhohn, 8. Katharina Kemmerich, verh. Urbach (Mutter unseres Autors Karlheinz Urbach, St. Augustin); dritte Reihe: 1. unbekannt, 2. Gertrud Wester, 3. Katharina Fischer, 4. Sibilla Eimermacher aus Broich/Donrath,5. unbekannt, 6. Anna Eschbach aus Ellhausen, 7. Maria Klein, verh. Meiger, 8. Gertrud Hagen, verh. Pohl, 9. Anna Weingarten, 10. Anna Allmann, 11. Josefa Orth, 12. Elisabeth Fischer, verh. Schrahe, 13. Gretchen Orth, 14. Maria Lohr, verh. Distelrath, 15. Gretchen Bouserath; vierte Reihe: 1. Therese Dunkel, verh. Pape, 2.-4. unbekannt, 5. Maria Kemmerich, verh. Schopp, 6. Maria Dunkel, verh. Emmerich, 7. Katharina Altwickler, verh. Höndgesberg (Mutter von Hans Höndgesberg, Kieselhöhe). | |
|
1900
| |
|
1880
- 1890 Das alte Fachwerkhaus Schmitz „Im alten Breidt“ Nr. 11 – hier auf einem Foto vermutlich um 1880/90 – war ursprünglich im Besitz der Familie Wacker, die in den Kirchenbüchern von Lohmar schon 1763 als in Breidt ansässig erscheinen. Anna Sibilla Wacker... Das alte Fachwerkhaus Schmitz „Im alten Breidt“ Nr. 11 – hier auf einem Foto vermutlich um 1880/90 – war ursprünglich im Besitz der Familie Wacker, die in den Kirchenbüchern von Lohmar schon 1763 als in Breidt ansässig erscheinen. Anna Sibilla Wacker heiratete 1879 Wilhelm Schmitz, womit das Haus in den Besitz der Familie Schmitz überging. Das Haus, das unter Denkmalschutz steht, ist heute noch im Fachwerk erhalten. Dort betreibt Frau Irmina Schmitz einen Designbetrieb für modische Stoff- und Lederwaren. Die Personen vor dem Haus sind leider unbekannt. | |
|
1910
- 1920 Ein Blick in die Vergangenheit – auf dem Foto um 1915/20 ist der Weiler Pützrath, ein Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Scheiderhöhe zu sehen. Auf dem Bild ist der Hof der Familie Josef Herkenrath sowie ganz rechts die Gast- und Schankwirtschaft von... Ein Blick in die Vergangenheit – auf dem Foto um 1915/20 ist der Weiler Pützrath, ein Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Scheiderhöhe zu sehen. Auf dem Bild ist der Hof der Familie Josef Herkenrath sowie ganz rechts die Gast- und Schankwirtschaft von Johann und Elisabeth Paffrath, der spätere „Flohberg“ zu erkennen. Direkt hinter dem Hof und dem neueren Stallgebäude, ganz links, befand sich ein Obstbungert mit einer sogenannten Kälberwiese. Im Vordergrund sieht man Anna Gertrud Herkenrath, geb. Hoeck, mit einer grasenden Kuh, dahinter ihr Mann, Josef Herkenrath, dann versetzt ihre jüngste Tochter Gertrud, 1903 geboren, zwei Brüder und die ältere Tochter. Der Vater von Josef Herkenrath, 1858 geb., hatte bereits vorher den Hof bewirtschaftet. Später war dort die Sülztalsauna, Pützrather Weg 2, angesiedelt. | |
|
1980
- 1989 Das Foto stammt aus den 1980er Jahren. Es zeigt die im Gammersbacher Tal, zwischen Muchensiefen und Oberschönrath, gelegene Gammersbacher Mühle, die 1688 als Wasserkornmühle zum ersten Mal genannt wurde. Damals gehörte sie zum adeligen Haus... Das Foto stammt aus den 1980er Jahren. Es zeigt die im Gammersbacher Tal, zwischen Muchensiefen und Oberschönrath, gelegene Gammersbacher Mühle, die 1688 als Wasserkornmühle zum ersten Mal genannt wurde. Damals gehörte sie zum adeligen Haus Schönrath. In einer Aufstellung der Marie (Bürgermeisterei) Lohmar von 1812 wird die Gammersbacher Mühle mit dem Besitzer Gerhard Bonn in der Gemeinde Scheiderhöhe und der Hausnummer 19 aufgeführt. Heute ist die Gammersbacher | |
Anläßlich des Feuerwehrfestes 1960 ist von den Mitgliedern der Lohmarer Feuerwehr ein Foto gemacht worden. Zu sehen sind: Sitzend v.l.n.r.:1. Jean Krieger, 2. Wilhelm Ennenbach, 3. August Kirschbaum, 4. Hansi Meng (hockend), 5. Karl Schultes, 6.... Anläßlich des Feuerwehrfestes 1960 ist von den Mitgliedern der Lohmarer Feuerwehr ein Foto gemacht worden. Zu sehen sind: Sitzend v.l.n.r.:1. Jean Krieger, 2. Wilhelm Ennenbach, 3. August Kirschbaum, 4. Hansi Meng (hockend), 5. Karl Schultes, 6. Wilhelm Söntgerath. Stehend v.l.n.r.: 7. Theo Schopp, 8. Johannes Niethen, 9. Toni Trompetter, 10. Heinrich Funken, 11. Willi Rösing, 12. Gebhard Meng, 13. Karl Heinz Höndgesberg, 14. Reinhard Neumann, 15. Heinz Damerau, 16. Bernd Oehm, 17. Richard Hein, 18. Josef Bürling, 19. Hans Josef Höndgesberg, 20. Armin ...?, 21. Hans Sieben, 22. Hans Kappes, 23. Heinz Steimel, 24. Hans Meng, 25. Horst Dieter Höndgesberg und 26. Willi Höndgesberg. | |
Auf einer Luftaufnahme von etwa Ende der 1950er Jahre ist das alte Kirchdorf in Lohmar noch fast unverschandelt zu sehen. Zwischen Brückenstraße und Autobahn sind links der Kirchstraße bis auf eine Ausnahme nur Fachwerkhäuser zu sehen. Die Ausnahme... Auf einer Luftaufnahme von etwa Ende der 1950er Jahre ist das alte Kirchdorf in Lohmar noch fast unverschandelt zu sehen. Zwischen Brückenstraße und Autobahn sind links der Kirchstraße bis auf eine Ausnahme nur Fachwerkhäuser zu sehen. Die Ausnahme ist das Haus Nr. 9, das dem Stellmacher Josef Schmitz genehmigt wurde, den Neuhof zu bauen. Das Gebäude des Fronhofes (Nr. 12) – heute durch Verputz und An- und Umbauten als solcher nicht mehr zu erkennen – ist noch als schönes großes Fachwerkhaus zu sehen. Der Fronhof, erstmals 1131 erwähnt, ist neben Haus Sülz der älteste Hof im Lohmarer Stadtgebiet. Seine Reste sind bis heute noch nicht denkmalgeschützt! Noch ein Schandfleck ist in der Mitte des linken Bildrandes zu sehen. Dort sieht man am Burghaus (Nr. 1) ein neuzeitlicher Anbau, der in den 1950er Jahren ohne Genehmigung errichtet wurde und bis heute nicht wieder abgerissen ist. In der Mitte des Fotos steht die wunderschöne Pfarrkirche St. Johannes Enthauptung, deren Langhaus 1900 unter der Leitung von Prof. Prill vom Hollenberg im romanischen Stil erbaut wurde. Der Turm ist von 1778 und der Chor stammt noch aus romanischer Zeit.
| |
Die drei Musikerfreunde aus Lohmar – von links nach rechts Paul Abel mit Gitarre, Erni Wagner mit Baß und Werner Schönenborn mit Akkordeon – machten bei den verschiedensten Anlässen im Dorf Tanz- und Stimmungsmusik, u.a. auf dem „Schüredenn“... Die drei Musikerfreunde aus Lohmar – von links nach rechts Paul Abel mit Gitarre, Erni Wagner mit Baß und Werner Schönenborn mit Akkordeon – machten bei den verschiedensten Anlässen im Dorf Tanz- und Stimmungsmusik, u.a. auf dem „Schüredenn“ (Scheunentenne) im Hof Höndgesberg auf der Kieselhöhe, wo die Dorfjugend das Tanzen lernte. | |
Das erste Kino nach dem Krieg in Lohmar war in einer Halle der Firma Fischer (siehe „Lohmar in alten Zeiten“, Bd.1, Seite 189) und wurde 1951 in eine ausgebaute Scheune im Schulteshof (neben der Gaststätte Schnitzler) verlegt.Das Kino wurde Ende 1962... Das erste Kino nach dem Krieg in Lohmar war in einer Halle der Firma Fischer (siehe „Lohmar in alten Zeiten“, Bd.1, Seite 189) und wurde 1951 in eine ausgebaute Scheune im Schulteshof (neben der Gaststätte Schnitzler) verlegt.Das Kino wurde Ende 1962 aufgegeben. Heute stehen hier die "Lohmarer Höfe". Das Kino wurde von einer Familie Mertchen aus Köln betrieben. Diese hatten fünf Kinos, eins in Lohmar, eins in Overath und die anderen in Köln. Die Leitung für das Kino in Lohmar hatte Frau Elisabeth Kowalski; sie verkaufte auch die Eintrittskarten aus einem kleinen Kiosk heraus am Eingang zum Kino. Filmvorführer war Willi Jäger, der im Hause Semm – Ecke Bachstraße/Hauptstraße – wohnte. Die Ehefrau von Willi Jäger und Selma Kümmler entwerteten die Eintrittskarten und waren Platzanweiserinnen. Selma Kümmler hatte auch die letzten 2-3 Jahre FrauKowalski im Kiosk für den Kartenverkauf vertreten. Herr Kümmler bewachte zeitweise die Fahrräder. Nach Aussage von Hermann Josef Kümmler wurde einmal der Film „Schneewittchen“ von Walt Disney gezeigt. Wegen der Hexenverbrennungsszene war der Film erst ab 12 Jahre freigegeben. Vor Beginn der Vorführung kam Kaplan Toni Ley ins Kino und holte alle Kinder unter 12 Jahren aus der Vorführung heraus.
| |
|
1958
Lohmarhohn, ist ein Gehöft im Wald auf dem Weg von der Schmiedgasse nach Gut Kröhlenbroich. Das Foto von etwa 1958 gibt den Blick von der Schmiedgasse kommend kurz vor dem Gehöft Lohmarhohn wieder. Man sieht rechts das von den Steyler Patres... Lohmarhohn, ist ein Gehöft im Wald auf dem Weg von der Schmiedgasse nach Gut Kröhlenbroich. Das Foto von etwa 1958 gibt den Blick von der Schmiedgasse kommend kurz vor dem Gehöft Lohmarhohn wieder. Man sieht rechts das von den Steyler Patres renovierte Haupthaus und links ein Fachwerkstall, die mit einem Tor – das aber immer offen stand – verbunden war. Dahinter ist ein neu errichteter moderner Viehstall. | |
1955 fand ein Radrennen statt, das auch durch Lohmar führte. Die Zuschauer stehen an der Donrather Kreuzung und erwarten die Rennfahrer, die von der Sülztatstraße in Richtung Lohmar einbiegen. Im Hintergrund ist die Pumpstation für die Lohmarer... 1955 fand ein Radrennen statt, das auch durch Lohmar führte. Die Zuschauer stehen an der Donrather Kreuzung und erwarten die Rennfahrer, die von der Sülztatstraße in Richtung Lohmar einbiegen. Im Hintergrund ist die Pumpstation für die Lohmarer Wasserversorgung und die Autobahn zu sehen. | |
Auf dem Foto vom Anfang der 1950er Jahre ist das noch unbebaute „Donrather Dreieck“ etwa von der Kuttenkaule aus zu sehen. Rechts ist die noch vollständige Lindenallee zwischen Lohmar und Donrath und links die Verbindungsstraße zwischen Hauptstraße... Auf dem Foto vom Anfang der 1950er Jahre ist das noch unbebaute „Donrather Dreieck“ etwa von der Kuttenkaule aus zu sehen. Rechts ist die noch vollständige Lindenallee zwischen Lohmar und Donrath und links die Verbindungsstraße zwischen Hauptstraße und Jabachtalstraße. Das gesamte Dreieck wurde landwirtschaftlich genutzt. Ganz hinten im ersten Haus wohnte der Polizei-Hauptwachtmeister Ernst Pack mit Familie, dahinter ist das Gut Jabach und vor diesem Haus, kaum zu erkennen, ist das Fachwerkhaus Faßbender (lt. Rolf Demmer, de Mahnemächers), das dem Neubau Fa. Suretec weichen musste. | |
Anfang der 1950er Jahre benötigte die Firma Walterscheid in Siegburg Ländereien, um mit ihrer Achswellenproduktion und der Fertigung von landwirtschaftlichen Gelenkwellen zu expandieren. Da in Siegburg diese Möglichkeit nicht bestand, hatte Bernhard... Anfang der 1950er Jahre benötigte die Firma Walterscheid in Siegburg Ländereien, um mit ihrer Achswellenproduktion und der Fertigung von landwirtschaftlichen Gelenkwellen zu expandieren. Da in Siegburg diese Möglichkeit nicht bestand, hatte Bernhard Walterscheid-Müller (er ist 1952 von Jean Walterscheid adoptiert worden) nach einer Örtlichkeit in Lohmar gesucht und konnte am Ziegelfeld ein Gelände von 15000 qm von dem Landwirt Bernhard Kurscheid erwerben. Das Foto von etwa 1954, auf dem von links nach rechts der Techn. Direktor Becker, der Firmenbesitzer Jean Walterscheid, Amtsdirektor Priel und der Bürgermeister Wilhelm Schultes zu sehen sind, ist sicherlich bei einem Ortstermin am Ziegelfeld entstanden. | |
|
1955
- 2019 Das Haus "Dunkels Eck" (Ecke Bachstraße/Mittelstraße - heute Rathausstraße) ist ein Jugendstilbau aus der Zeit 1919/20. Hier wohnten damals Paterre die Familie von Jakob Dunkel (einer der vier Dunkel-Brüder, die das Tiefbauunternehmen Dunkel... Das Haus "Dunkels Eck" (Ecke Bachstraße/Mittelstraße - heute Rathausstraße) ist ein Jugendstilbau aus der Zeit 1919/20. Hier wohnten damals Paterre die Familie von Jakob Dunkel (einer der vier Dunkel-Brüder, die das Tiefbauunternehmen Dunkel betrieben). Seine Frau Else betrieb hier einen Lebensmittelladen. Die Ladeneinganstür ist erhalten geblieben. In dem Haus wohnte auch Katharina Dunkel geb. Schmidt, die Stiefmutter von Jakob und im Dachgeschoss Paul Hartmann mit Familie. Die Verkehrsführung an der sog. „Dunkels Eck“ ist 2010 umgestaltet worden. Die Anbauten an das Haus, die als Bürogebäude der Tiefbaufirma genutzt worden waren, wurden abgerissen. Zuvor war das Anwesen an die Firma Wohnbau Schulte GmbH verkauft worden. Nach deren Bauplänen sollte der Bereich umgestaltet werden mit einer Mischnutzung aus Gewerbe und Wohnen. Das entsprechende Bebauungsplanverfahren stellte die Stadt Lohmar 2009 ein, da das Projekt wegen der Insolvenz der Wohbaufirma nicht mehr weiter verfolgt wurde. Heute steht das Haus mit mehreren Mietwohnungen in neuem Eigentum. | |
|
1950
- 1960 Die Aufnahme aus den 1950er bis 60er Jahren hält die wesentlichen baulichen Merkmale der Kirche von Neuhonrath aus der Zeit der Restaurierung 1898/97 fest. Die Umfassungsmauern sind noch unverputzt. Die achtgradlinig geschlossenen bisherigen Fenster... Die Aufnahme aus den 1950er bis 60er Jahren hält die wesentlichen baulichen Merkmale der Kirche von Neuhonrath aus der Zeit der Restaurierung 1898/97 fest. Die Umfassungsmauern sind noch unverputzt. Die achtgradlinig geschlossenen bisherigen Fenster wurden in Rundbogenfenster geändert. (Anmerkung: heute, nach der Restaurierung nach 1969 ist die Kirche verputzt und die Fenster wieder im Sturz gradlinig ausgeführt worden). Neben der kath. Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt, kann man vor dem Kirchhof die ehemalige Scheune der Vikarie, das im Jahr 1968 zur Lehrerwohnung umgebaute ehemalige Fachwerkschulhaus und rechts davon das aus Grauwacke errichtete Schulgebäude für den Unterricht der Kinder erkennen. Ansonsten ist der Hügel rund um die Kirche noch nicht bebaut. 1953 wird das zweiklassige neue Schulgebäude mit Unter- und Oberklasse am rechten Bildrand feierlich eingeweiht. | |
|
1950
- 1959 Auf dem Foto aus der Mitte der 1950er Jahre sieht man einige Mitglieder des Junggesellenvereins „Gemütlichkeit“ Lohmar im Saal „Hotel zur Linde“. Auf dem Foto aus der Mitte der 1950er Jahre sieht man einige Mitglieder des Junggesellenvereins „Gemütlichkeit“ Lohmar im Saal „Hotel zur Linde“. | |
|
1953
Wahrscheinlich im Herbst 1953 überschreitet das 4. und 5. Schuljahr der Lohmarer Volksschule für einen Spaziergang in den Wald die noch gepflasterte Autobahnbrücke. Zu sehen sind: 1.-3. unbekannt 4. Adelinde Schrage 5. unbekannt 6. Marlies Kümmler... Wahrscheinlich im Herbst 1953 überschreitet das 4. und 5. Schuljahr der Lohmarer Volksschule für einen Spaziergang in den Wald die noch gepflasterte Autobahnbrücke. Zu sehen sind: 1.-3. unbekannt 4. Adelinde Schrage 5. unbekannt 6. Marlies Kümmler 7. und 8. unbekannt, 9. Nelli Braun 10. Friedchen Schmitz 11. Maria Heimig (1954 beim Völkerballspiel auf dem Schulhof verstorben) 12 Hannelore Jeschonnek 13.-20. unbekannt | |
|
1950
- 1959 Bei trübem Wetter, am Tag Fronleichnam. Links oberhalb der Kirchenmauer stehen zwei Fahnen mit den Farben gelb und weiß und die beiden stattlichen Kastanienbäume. Auf der rechten Seite: Im Vordergrund die Front des Lebensmittel, Feinkost-,... Bei trübem Wetter, am Tag Fronleichnam. Links oberhalb der Kirchenmauer stehen zwei Fahnen mit den Farben gelb und weiß und die beiden stattlichen Kastanienbäume. Auf der rechten Seite: Im Vordergrund die Front des Lebensmittel, Feinkost-, Spirituosen- und Textilladen von Paula Kömmelt, später Klein-Hessling. Dann (nicht auf dem Foto) die Schlosserei mit dem HaushaltwarenGeschäft Merten. In der Straße Pfaffendriesch die Metzgerei Hubert Müller. An der Ecke Hohle Gasse das Lebensmittelgeschäft mit Drogerie-, Kurz- und Textilwaren von Else Orth, Unterhalb des Hauses Orth befindet sich das weitere Lebensmittelgeschäft von Wilhelm Wacker. An der Hohle Gasse liegen die Schuppen und Garagen von Schwamborn. Hier war der zentrale Ort für die Aufstellung des Kirmeskerls, des Briefkastens und Anschlagbretts für amtliche und Vereinsmitteilungen. Vor dem Schuppen stand ein Milchbock, wo täglich die Milchkannen der Bauern von der Molkerei abgeholt wurden. Im Hintergrund sind die Gaststätten Schwamborn und Wiel zu sehen. | |
|
22. Juli 1951
- 5. September 1951 Die Gründungsmitglieder des Pfadfinderstamms „Sankt Johannes Lohmar“ (Gründungsjahr Mai 1949) gingen im Sommer 1951 bereits auf große Fahrradtour zum Bodensee. Auf der Rückfahrt besuchten sie das erste internationale Treffen „Begegnung europäischer... Die Gründungsmitglieder des Pfadfinderstamms „Sankt Johannes Lohmar“ (Gründungsjahr Mai 1949) gingen im Sommer 1951 bereits auf große Fahrradtour zum Bodensee. Auf der Rückfahrt besuchten sie das erste internationale Treffen „Begegnung europäischer Jugend“ auf dem Hochplateau der Loreley. An diesem spektakulären europäischen Jugendtreffen vom 22. Juli bis 5. September 1951 nahmen in dieser Zeit über 35.000 Jugendliche im Alter von 16-25 Jahren, aus den unterschiedlichsten demokratischen Nationen teil. Die Leitung dieser Veranstaltung übernahm der Deutsche Bundesjugendring. Das Thema lautete „Jugend baut Europa“ (Als Gegenpol wurden parallel hierzu in Ost-Berlin die dritten Jugendweltfestspiele abgehalten). Am Mittwochabend fand das große internationale Treffen auf der Loreley mit einer eindrucksvollen Feierstunde seinen Abschluss.Unter dem begeisterten Beifall der Jugend rief der Präsident des Europa-Rates, Paul Henry Spaak aus: „Eine junge Generation, die den Krieg erlebt hat, will ein Leben der Freiheit und des Friedens. Wir wollen nun nicht mehr auseinandergehen, um uns noch einmal zu bekämpfen“. Der Wimpel des europäischen Jugendtreffens – mit dem „noch geschwungenen E“, zunächst als Europaflagge geplant – wobei die Grundidee einem Entwurf von Duncan Sandys, dem Schwiegersohn Winston Churchills, entsprang. Er sah ein grünes (ursprünglich rotes) „E“ auf weißem Grund vor und wurde zunehmend als das europäische Symbol verwendet. Die Flagge war erstmals 1949 bei einer europäischen Wirtschaftskonferenz in London gehisst worden. Sie wurde abgelehnt, da einem reinen Buchstabensymbol zu wenig emotionale Bindungskraft zugeschrieben wurde. Heute besteht die Europaflagge aus einem Kranz von zwölf goldenen fünfzackigen Sternen auf azurblauem Hintergrund. Sie wurde 1955 vom Europarat eingeführt und 1986 von der Europäischen Gemeinschaft übernommen. | |
|
14. September 1952
Am 14. September 1952 war die Grundsteinlegung zum Bau der Marienkirche in Donrath. Auf dem Foto sieht man von links nach rechts Dr. Peter Bernhard Kallen, Pfarrer Wilhelm Offergeld und Kaplan Toni Ley. Kaplan Ley liest gerade den Text der Urkunde... Am 14. September 1952 war die Grundsteinlegung zum Bau der Marienkirche in Donrath. Auf dem Foto sieht man von links nach rechts Dr. Peter Bernhard Kallen, Pfarrer Wilhelm Offergeld und Kaplan Toni Ley. Kaplan Ley liest gerade den Text der Urkunde vor. Pfarrer Offergeld schreibt in der „Festschrift zum 25-jährigen Bestehen der Marienkirche in Donrath“ zur Grundsteinlegung: „Mitte September begann das Mauerwerk sich aus der Erde zu erheben und die Grundsteinlegung konnte erfolgen. Dazu wurde der 14. September 1952 ausersehen, der ein Sonntag war und zu einem Feiertag für die Gemeinde Donrath wurde. An der mit Fahnen und lichtem Grün geschmückten Baustelle wogte eine frohbewegte Menge, als Pfarrer Offergeld unter Assistenz von Dr. Kallen und Kaplan Ley den Grundstein segnete. Der Grundstein ist ein Geschenk von Dr. Kallen, der ihn aus Rom mitgebracht hatte, wo er aus der hl. Pforte zu Beginn des Hl. Jahres 1950 ausgebrochen wurde.“ | |
|
1950
Damals war es üblich, dass sich die Kommunionkinder vor der Hl. Messe in dem Schulgebäude in der Kirchstraße trafen. Dort wurde die Garderobe – Mäntel oder Jacken – abgelegt und Helfer sorgten für die richtige Aufstellung, um mit Musik und in... Damals war es üblich, dass sich die Kommunionkinder vor der Hl. Messe in dem Schulgebäude in der Kirchstraße trafen. Dort wurde die Garderobe – Mäntel oder Jacken – abgelegt und Helfer sorgten für die richtige Aufstellung, um mit Musik und in Begleitung der Geistlichkeit zur Kirche zu ziehen. Die Kirchstraße war mit Fähnchen und die Kirche mit langen Fahnen geschmückt. Die Kommunionkinder-Jungen sind von links nach rechts: 1. und 2. unbekannt, 3. Karl Heinz Rötzel, 4. unbekannt, 5. Karlheinz Heller (Heimkind), 6. und 7. Prospero Alfred und Raimund (Heimkinder), 8. Kurt Sauer, 9. Hans Josef Höndgesberg, 10. Karl Heinz Höndgesberg, 11. Heribert Frielingsdorf,12. und 13. unbekannt, 14. Walter Paffrath (Heimkind), 15. unbekannt, 16. Erich Berx, 17. Norbert Steinbach, 18. Manfred Wacker, 19. und 20. unbekannt, 21. Karl Josef Kappes, 22. unbekannt, 23. Manfred Frost, 24. unbekannt, 25. Hans Günter Pick, 26. Günter Söntgerath, 27. unbekannt, 28. Bernd Schmidt, 29. Helmut Scheid, 30. Ellen Postertz verh. Trompetter (Führengel) 31. Gerda Müller verh. Steudter (Führengel). | |
Das Bild aus der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre zeigt die Gewanne Eisenmarkts Garten („et Saujässje“), die Einmündung von der Bachstraße aus mit Abzweig zum Eisenmarkt, Bildmitte der Guttenhof mit Scheune im hinteren Hofraum, dessen erste... Das Bild aus der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre zeigt die Gewanne Eisenmarkts Garten („et Saujässje“), die Einmündung von der Bachstraße aus mit Abzweig zum Eisenmarkt, Bildmitte der Guttenhof mit Scheune im hinteren Hofraum, dessen erste urkundliche Erwähnung im Jahre 1653 erfolgte. Der von 1813-1826 amtierende Bürgermeister Balthasar Schwaben hat von 1819 im Guttenhof gewohnt und von dort auch seine Geschäfte erledigt. Die beiden Nebengebäude der „Villa Friedlinde“, rechts das Fachwerkhaus, das heutige „HGV-Haus“, Archiv des Heimat- und Geschichtsvereins Lohmar, dahinter ein weiteres verputztes, weiß gestrichenes Nebengebäude, das Anfang der 70er Jahre abgerissen wurde und von dem Teile Anfangs vom Eigentümer, der Kölner Kaufmannsfamilie Baumann, als Zwischenlager ihres Lebensmittelgroßhandels und der Kaffeerösterei genutzt wurde. Hinter den beiden Nebengebäuden kann man ganz schwach, zwischen den Bäumen des Parks, Teile des Mansardewalmdachs der so genannten „Villa Baumann“ (heute Villa Friedlinde) erkennen, die 1972 von der Gemeinde gekauft und für ihre Zwecke umgebaut wurde. Lange bevor die Provinzialstraße von Siegburg nach Overath, den eigentlichen Hauptdorfweg durch Lohmar, die Bachstraße, ersetzte und mit einer Pflasterung versehen wurde (1929), waren die innerörtlichen Verbindungen von Ortsteil zu Ortsteil oder von den in Nord-Süd verlaufenden Hauptwegen (-straßen), die hierzu quer verlaufenden vielen kleinen Pfade, die sogenannten „Päddche“. Den Namen „et Saujässje“ hatte das Gässchen vom Auftreiben des Hornviehs und der Schweine zur Eckern- und Eichelmast in den Erbenwald erhalten. Lohmarer Alteingesessene hatten das Recht, ihr Vieh dort im Gemeindewald weiden zu lassen. | |
|
1950
- 1955 Die Luftaufnahme zeigt von links das Haus Krengel/Fielenbach mit Schreinerei, den Bauernhof, Kornbrennerei und Gaststätte Schwamborn. Rechts daneben befindet sich die Gaststätte und Sattlerei Wiel. Im Vordergrund befinden sich Schuppen und Garagen... Die Luftaufnahme zeigt von links das Haus Krengel/Fielenbach mit Schreinerei, den Bauernhof, Kornbrennerei und Gaststätte Schwamborn. Rechts daneben befindet sich die Gaststätte und Sattlerei Wiel. Im Vordergrund befinden sich Schuppen und Garagen der Familie Schwamborn. Dort war der Treffpunkt „der Birker Pänz“ zum Versteckenspielen und zum Fußball. Die weiteren Fachwerkhäuser zur Hohle Gasse hin sind: Das Kempshaus, und Haus Küpper. Im Hintergrund sind Gärten und Wiesen zu sehen, die heute überwiegend bebaut sind. | |
|
1950
- 1955 Die Luftaufnahme vom Anfang der 1950er Jahre zeigt die Burganlage mit Vorburg und Haupthaus bevor sie etwa 1955 ohne Genehmigung mit dem hässlichen Schwemmsteinanbau erweitert wurde. Die Aggerwiesen sind noch mit Obstbäumen bepflanzt und nördlich ist... Die Luftaufnahme vom Anfang der 1950er Jahre zeigt die Burganlage mit Vorburg und Haupthaus bevor sie etwa 1955 ohne Genehmigung mit dem hässlichen Schwemmsteinanbau erweitert wurde. Die Aggerwiesen sind noch mit Obstbäumen bepflanzt und nördlich ist noch das kleine Fichtenwäldchen, das sogenannte „Schultes Böschelche“ mit dem „Kradepol“ zu sehen. Zu dieser Zeit war die rechte Seite von der Familie Heinrich Wasser und die linke Seite von der Familie Heinrich Schultes bewohnt. | |
|
1950
- 1959 Wahrscheinlich Anfang bis Mitte der 1950er Jahre auf Weiberfastnacht entstand dieses Foto der jecken Frauen von Lohmar. Wo das Foto entstand konnte nicht geklärt werden. Von links nach rechts: 1. Kätti ?, 2. unbekannt, 3. Thea Ruhrmann (Ehefrau von... Wahrscheinlich Anfang bis Mitte der 1950er Jahre auf Weiberfastnacht entstand dieses Foto der jecken Frauen von Lohmar. Wo das Foto entstand konnte nicht geklärt werden. Von links nach rechts: 1. Kätti ?, 2. unbekannt, 3. Thea Ruhrmann (Ehefrau von Frisör Heinrich Ruhrmann,wohnten im Haus von Dr. Römer – heute Parfümerie Rüdell), 4. Anna Schmitz geb. Röger,Altenrather Str., 5. Klara Scheiderich, Hauptstr. (heute Lottoannahme) 6. Else Dunkel geb. Röger, „Dunkels Eck“, 7. unbekannt, 8. Anna Postertz geb. Frost, Kirchstraße, 9. Maria Rottland, 10. Käthe Reers, 11. Elisabeth Sauer geb. Wacker, Brennstoffhandel Hauptstr., 12. Mathilde Müller geb. Rottland, Altenrather Str., 13. Elisabeth Scheiderich, geb. Schopp ? | |
Hier haben sich die Frauen des Kirchstraßen-Kegelklubs „Stell Jonge“ vor einem Ausflug Anfang der 1950er Jahre vor dem Haus Knipp in Lohmar in der Kirchstraße für ein Foto aufgestellt.Hinter dem Bus ist das Geschäft Gogol und rechts in dem etwas... Hier haben sich die Frauen des Kirchstraßen-Kegelklubs „Stell Jonge“ vor einem Ausflug Anfang der 1950er Jahre vor dem Haus Knipp in Lohmar in der Kirchstraße für ein Foto aufgestellt.Hinter dem Bus ist das Geschäft Gogol und rechts in dem etwas vorgebauten Erker wohnte Lehrer Hermann Bollmann. Vlnr: 1. Johanna (Hannsche) Becker 2. Cäcilia Severin geb. Hilgers 3. Anna Postertz geb. Frost 4. Anna Schmitz geb. Röger 5. Katharina Schönenborn geb. Broicher 6. Maria Kath. Schell geb. Herkenrath 7. unbekannt 8. darüber der Busfahrer 9. Maria Wacker geb. Roth 10. Katharina Spürk geb. Roth, 11. Katharina Heimig geb. Pape 12. Gertrud Schnitzler geb. Tewes 13. Frau von Hans Scharrenbroich. | |
|
1950
Mit diesem Foto von etwa 1950, einem Blick von der Scherferhardt auf den Aggerbogen der „Donrather Schweiz“ mit dem im Hintergrund aggertalabwärts liegenden Zentralort Lohmar, wirbt die Gemeinde für die Orte Lohmar und Donrath im unteren Aggertal um... Mit diesem Foto von etwa 1950, einem Blick von der Scherferhardt auf den Aggerbogen der „Donrather Schweiz“ mit dem im Hintergrund aggertalabwärts liegenden Zentralort Lohmar, wirbt die Gemeinde für die Orte Lohmar und Donrath im unteren Aggertal um Sommergäste. Die beiden schön gelegenen Fremdenverkehrsorte (ehemals Luftkurorte) am Zusammenfluss von Agger und Sülz, bieten durch ihre landschaftlichen Schönheiten besten Ferienaufenthalt und Erholungsmöglichkeit. Kurze und ausgedehnte Spaziergänge in den abwechselungsreichen Laub- und Nadelwäldern, durch Wiesentäler und über Höhen mit weiten Fernsichten auf Rheintal, Siebengebirge und Eifel, bringen Entspannung, Gesundung und Lebensfreude. | |
In den Jahren nach dem Krieg war ein Motorrad oder ein Auto noch eine Seltenheit – zumal bei Jugendlichen. Das Haupt-Fortbewegungsmittel war das Fahrrad. Von und zu den Fabriken im Umkreis fuhren Heerscharen von Radfahrern. Hier auf dem Foto stehen... In den Jahren nach dem Krieg war ein Motorrad oder ein Auto noch eine Seltenheit – zumal bei Jugendlichen. Das Haupt-Fortbewegungsmittel war das Fahrrad. Von und zu den Fabriken im Umkreis fuhren Heerscharen von Radfahrern. Hier auf dem Foto stehen einige Lohmarer Jugendliche um 1950 mit ihren Fahrrädern auf der Hauptstraße, etwa dort, wo heute der Eissalon ist. Zwei von ihnen halten eine Flasche (Dornkaat) in der Hand. Von links nach rechtssind zu sehen: Arthur Höck, Georg Stoecker, Fritz Kurtsiefer, Paul Abel, Hans Liesenfeld, Günter Klein (der spätere Heimatmaler) und Dieter Lindner (später Körting) | |
|
1950
An einem Wochenende um 1950 herum war eine Feierlichkeit im Saal des „Hotel zur Linde“, die auch Willy Küpper besuchte. Der Freundeskreis um Erwin Henseler wollte Willy Küpper, der in der Kirchstraße Nr. 4 ein Fotogeschäft betrieb, einen Streich... An einem Wochenende um 1950 herum war eine Feierlichkeit im Saal des „Hotel zur Linde“, die auch Willy Küpper besuchte. Der Freundeskreis um Erwin Henseler wollte Willy Küpper, der in der Kirchstraße Nr. 4 ein Fotogeschäft betrieb, einen Streich spielen – sie wollten ihm mit Kleister und Tapete das Schaufensterscheibe zukleben. Nun hatte Willy Küpper aber das Schaufenster beleuchtet und man wollte doch nicht unbedingt gesehen werden. Daher riefen sie bei der „Linde“ an und baten dem Herrn Küpper auszurichten, er möge doch die Schaufensterbeleuchtung ausschalten, sie wohnten gegenüber und es wäre schon spät, das helle Licht würde sie beim Schlafen stören. Kurze Zeit später kam Willy Küpper aus dem Saal und schaltete in seinem Geschäft die Beleuchtung aus. Nun hatte die Clique freie Bahn. Mit einer Leiter und den nötigen Utensilien aus dem Malerbetrieb in der Altenrather Straße ging es flugs ans Werk. Zum Schluss wurde noch mit großen Lettern auf die abgeklebte Schaufensterscheibe geschrieben: "Klavierunterricht demnächst hier!" Das Foto zeigt in der Küche von Anna Raßmes in fröhlicher Runde von links nach rechts Ferdi Eich, Anna Raßmes, Hubert Hagen und Erwin Henseler | |
1949 machte der Kirchenchor Lohmar mit Ehepartnern einen Ausflugnach Altenahr. In der Außengastronomie eines Lokals ist das obigeFoto entstanden. Man sieht 1. Else Ramme 2. Klara Küpper 3. ? Löhrer 4. Kätti Schönenborn,5. Elisabeth... 1949 machte der Kirchenchor Lohmar mit Ehepartnern einen Ausflugnach Altenahr. In der Außengastronomie eines Lokals ist das obigeFoto entstanden. Man sieht 1. Else Ramme 2. Klara Küpper 3. ? Löhrer 4. Kätti Schönenborn,5. Elisabeth Scheiderich 6. Margarethe Rottländer 7. Carl Scheiderich 8. Heinz Schell 9. Maria Katharina Schell (Ehefrau von 8) 10. Else Schmitz (Ehefrau von 16) 11. Anna Schmitz 12. Käthe Hagen? 13. Katharina Heimig 14. Anna Röger 15. Thomas Kappes, 16. Lehrer Josef Schmitz 17. Wilhelm Pape | |
|
1950
Foto des Lohmarer Kirchenchores um 1950 im Pfarrgarten. Zu sehen sind 1. Peter Meurer aus Altenrath, 2. Bernhard Müller (ab 1952 Walterscheid-Müller), 3. Jean Pütz, 4. Wilhelm Krieger, 5. Heinrich Steimel, 6. Erich Klein, 7. Heinrich Jammersbach, 8.... Foto des Lohmarer Kirchenchores um 1950 im Pfarrgarten. Zu sehen sind 1. Peter Meurer aus Altenrath, 2. Bernhard Müller (ab 1952 Walterscheid-Müller), 3. Jean Pütz, 4. Wilhelm Krieger, 5. Heinrich Steimel, 6. Erich Klein, 7. Heinrich Jammersbach, 8. Gerta Broicher verh. Bürvenich, 9. Hedwig Ramme, 10. Margarethe Becker, 11. Anna Hagen geb. Kronenberg (de Mam), | |
|
12. November 1949
- 27. November 1949 Nach 17 Jahren wurde in der Pfarrei Lohmar vom 12. bis zum 27. November 1949 von Redemtoristenpatres eine Volksmission durchgeführt. Die Patres waren der Leiter Franz Zimmermann und Pater Roosen aus Köln-Mühlheim und Pater Lange aus Geistingen. Da... Nach 17 Jahren wurde in der Pfarrei Lohmar vom 12. bis zum 27. November 1949 von Redemtoristenpatres eine Volksmission durchgeführt. Die Patres waren der Leiter Franz Zimmermann und Pater Roosen aus Köln-Mühlheim und Pater Lange aus Geistingen. Da die Volksfrömmigkeit nach dem Krieg sehr groß war, waren alle Veranstaltungen sehr gut besucht. Pfarrer Wilhelm Offergeld schreibt in der Pfarrchronik: „Zur Vorbereitung besuchten Pfarrer und Kaplan in den letzten Monaten alle Familien der Pfarre und luden zur Teilnahme ein. Ein Flugblatt, das sie bei dieser Gelegenheit überreichten, wies auf die Bedeutung der Mission hin. Täglich wurde bei den Gottesdiensten um eine segensreiche Mission gebetet. Die Vorträge für die Kinder begannen am Nachmittag des 11. Nov. und waren täglich in der Kindermesse um 7.45 Uhr und nachmittags um 14.30 Uhr. Die Kindermission dauerte bis Sonntag, den 20. Nov. und schloss mit der Gemeinschaftskommunion um 8.30 Uhr. Die Eröffnungspredigt für die Erwachsenen war Samstag, den 12. Nov. abends um 20.00 Uhr. Täglich war für die Erwachsenen Predigt nach der hl. Messe um 6.20 Uhr und um 8.30 Uhr und abends um 17.00 und 20.00 Uhr. Für die Außenorte waren im Saale Brinkmann („Weißes Haus“, Anm. des Autors) in Donrath Missionsvorträge: morgens 8.30 Uhr Messe mit Predigt; abends 20.00 Uhr Missionspredigt. In der Kapelle in Halberg war sonntags in der hl. Messe um 7.30 Uhr und nachmittags um 14.00 und 16.00 Uhr Missionspredigt.“ Täglich nahmen an den Veranstaltungen in Lohmar über 1000 und in Donrath über 500 Gläubige teil. Es wurden insgesamt über 5000 Kommunionen ausgeteilt. Auf dem Foto sieht man von links nach rechts Pater Lange, Pastor Offergeld, Pater Franz Zimmermann und Pater Roosen im Eingang der Pastorat stehen. * Redemptoristen, lat. Congregatio Sanctissimi Redemtoris C.SS.R. (Kongregation des heiligsten Erlösers) ist ein 1732 in Scala bei Neapel gegründeter Priester- und Brüderorden mit Sitz in Rom. Die Redemptoristen widmen sich der Seelsorge und Mission. Eine Niederlassung des Ordens ist in Hennef-Geistingen gewesen. | |
|
24. April 1949
Der Weiße Sonntag 1949 war relativ spät – erst am 24. April. Scheinbar war auch das Frühjahr sehr mild, denn die Bäume haben alle schon Blätter getrieben. Daher wurde das Foto mit den Kommunionkindern in Lohmar im Pfarrgarten gemacht: 1. unbekannt... Der Weiße Sonntag 1949 war relativ spät – erst am 24. April. Scheinbar war auch das Frühjahr sehr mild, denn die Bäume haben alle schon Blätter getrieben. Daher wurde das Foto mit den Kommunionkindern in Lohmar im Pfarrgarten gemacht: 1. unbekannt 2. Karola Wetkamp, verh. Moldenhauer 3. Margret Ramme, verh. Joannidis 4. Gerda Müller, verh. Steudter 5. Marlies Spürk, verh. Schubert 6. Elisabeth Kühnelt, verh. Kron 7. unbekannt 8. Heinz Brands, 9. Heinz Müller (Mühlenweg) 10. unbekannt 11. Horst Zanker 12. unbekannt 13. Erika Scheid, verh. Rauch, 14. Ellen Postertz, verh. Trompetter 15. Helga Harnisch 16. unbekannt 17. ? Eschbach 18. Edith Schönenborn, verh. Schmidt 19. Luzi Lange 20. Heinz Wering 21. Willi Gerhards 22. Paul Ramme 23. Peter Ramme 24. Peter Sterzenbach 25. Brigitte Benderscheid, verh. Modemann 26. unbekannt 27. Wilma Stöcker 28. ? Limbach 29. Maria Zanker, verh. Mischkowski 30. Anneliese Schmitz, verh. Lemmer 31.Beate Contzen, verh. Ennenbach, 32. Bernd Kurscheid 33. Peter Kurtsiefer 34. Willi Kruft 35. Ferdi Gilgen 36. Gerd Schmidt (Bubbes) 37. Agnes Mehlem 38. Helga Kümpel, verh. Sieben 39. Helene Kurtsiefer, verh. Ames 40. Renate Rottländer, verh. Demmig, 41. Irmtrud Heß, verh. Kolf 42. Hannelore Köb, verh. Hanke 43. Klaus Schörk 44. ? Bürling 45. Paul Berg 46. unbekannt | |
Der Ort „Roter Hahn“ war nach dem Krieg ein beliebtes Ausflugsziel. Er liegt in der Nähe von Koblenz an den Ausläufern des Westerwaldes und heißt eigentlich Arenberg. „Roter Hahn“ wird er genannt nach der alten Poststation, wo auch die Pferde... Der Ort „Roter Hahn“ war nach dem Krieg ein beliebtes Ausflugsziel. Er liegt in der Nähe von Koblenz an den Ausläufern des Westerwaldes und heißt eigentlich Arenberg. „Roter Hahn“ wird er genannt nach der alten Poststation, wo auch die Pferde gewechselt wurden. Im Sommer 1949 hatte der Kinderchor Lohmar unter der Leitung von Thomas Kappes einen Ausflug dorthin gemacht. Da entstand auch obiges Foto. Von links nach rechts: | |
|
1. Juli 1947
Am 1. Sonntag im Juli 1947 feierte der Junggesellenverein sein 50. Stiftungsfest. Beim Umzug durch den Ort gehen die Senioren des Vereins gerade an den Häusern Kümmler und Schallenberg an der Hauptstraße (59, 61) vorbei. Im Haus links in der Tür in... Am 1. Sonntag im Juli 1947 feierte der Junggesellenverein sein 50. Stiftungsfest. Beim Umzug durch den Ort gehen die Senioren des Vereins gerade an den Häusern Kümmler und Schallenberg an der Hauptstraße (59, 61) vorbei. Im Haus links in der Tür in der weißen Bluse steht Frau Kümmler (et „Icke“). Vor dem Haus Schallenberg kann man die einsäulige Esso-Tankstelle erkennen, die Karl Schallenberg (de „Kani“) damals noch betrieb. Die Hauptstraße war um diese Zeit noch gepflastert.
| |
|
1945
- 1949 Ende der 1940er Jahre machte der Kirchenchor einen Ausflug nach Königsbach bei Koblenz. Dort im Schloss Königsbach ist obiges Foto entstanden. Zu sehen sind: 1. Leni Distelrath, 2. Christine Kappes, 3. Marianne Kneutgen, 4. Ilse Berg, 5. Wilhelm... Ende der 1940er Jahre machte der Kirchenchor einen Ausflug nach Königsbach bei Koblenz. Dort im Schloss Königsbach ist obiges Foto entstanden. Zu sehen sind: 1. Leni Distelrath, 2. Christine Kappes, 3. Marianne Kneutgen, 4. Ilse Berg, 5. Wilhelm Krieger, 6.-8. unbekannt, 9. Erich Klein?, 10. ? Lohmar, 11. Frau Palm, 12. Katharina Krieger, 13. Bernhard Palm, 14. Ilse Wolter?, 15. Gerta Kurtsiefer, 16. Else Ramme, 17. u. 18. unbekannt, 19. Heinrich Roland, 20. Margarethe Burger, 21.-26. unbekannt, 27. Theo Söntgerath, 28. Heinrich Schröder, 29. Lieschen Schröder, 30.-37. unbekannt, 38. Thomas Kappes, 3. Wilhelm Schmitz (Kirchstraße, de Stürmesch Well), 40. unbekannt, 41. Peter Buchholz, unbekannt, | |
Wahrscheinlich auf Rosenmontag 1948 entstand die Aufnahme, auf der viele maskierte Lohmarer Kinder auf der Treppe der Gaststätte "Zum Jägerhof" fotografiert wurden. Zu sehen sind: 1. u. 2. unbekannt, 3. Hilde Schmitz, 4. Hedwig Schmitz verh. Furk,... Wahrscheinlich auf Rosenmontag 1948 entstand die Aufnahme, auf der viele maskierte Lohmarer Kinder auf der Treppe der Gaststätte "Zum Jägerhof" fotografiert wurden. Zu sehen sind: 1. u. 2. unbekannt, 3. Hilde Schmitz, 4. Hedwig Schmitz verh. Furk, 5. unbekannt, 6. Hedi Zimmermann verh. Raemich, 7. Anneliese Psyk, 8. Bernhard Labitzke, 9. u. 10. unbekannt, 11. Karl Heinz Höndgesberg, 12. Hildegard Hölper verh. Krumbe,13.-15. unbekannt, 16. Martin Jansen, 17. u. 18. unbekannt, 19. Margret Gunenberg, 20. Edith Schönenborn, 21. unbekannt, 22. Peter Ramme?, 23. Maria Stöcker verh. Anders, 24. unbekannt, 25. Steffi Henschel, 26. Marlene Hein verh. Reinartz, 27. Elisabeth Frielingsdorf, 28. Doris Schüchen verh. Zibell, 29. und 30. unbekannt, '31. Wilma Stöcker, 32. Anneliese Dziallas, 33.-35. unbekannt, 36. Eckehard Penquitt, 37 unbekannt, 38. Margret Ramme verh Joannidis, 39. Giesela Klug verh. Steimel, 40. Johanna Frielingsdorf verh. Thomas, 41. u. 42. unbekannt, 43. Heinz Ramme, 44. Rainer Krämer, 45. u. 46. unbekannt, 47. Karin Breidenbach. | |
|
1948
Heinrich Eschbach vom Fischgeschäft Eschbach an der Hauptstraße Nr. 56 (ehemals Pusteblume) verkaufte nicht nur Fisch, sondern fuhr auch nach dem Krieg bis Ende der 1950er Jahre mit einem umgebauten Fahrrad als Eiswägelchen durch den Ort und... Heinrich Eschbach vom Fischgeschäft Eschbach an der Hauptstraße Nr. 56 (ehemals Pusteblume) verkaufte nicht nur Fisch, sondern fuhr auch nach dem Krieg bis Ende der 1950er Jahre mit einem umgebauten Fahrrad als Eiswägelchen durch den Ort und verkaufte Eis. Heinrich Eschbach war ein vielseitiger Musiker, war Mitglied in der Musikergruppe Stentz, die ihren Übungsraum in der Fabrik Fischer hatte und von Johann Fischer gefördert wurde, und leitete viele Jahre einen Mandolinenverein in Lohmar. Das Foto zeigt den Mandolinenverein etwa 1948 bei einem Konzert.
| |
Foto von R. Starke neben der Gaststätte Jägerhof, Hauptstraße 35. Schorn, Franz Ramme, Berthold Harnich, Walter Linden, Franz-Heinz Alda, oben Werner Ennenbach, HansJosef Speer, Peter Thomas, oben Heinz-Josef Frielingsdorf, Heinz Ruhrmann, oben... Foto von R. Starke neben der Gaststätte Jägerhof, Hauptstraße 35. Schorn, Franz Ramme, Berthold Harnich, Walter Linden, Franz-Heinz Alda, oben Werner Ennenbach, HansJosef Speer, Peter Thomas, oben Heinz-Josef Frielingsdorf, Heinz Ruhrmann, oben Herbert Höndgesberg und .. Antzenberger, Willi Höndgesberg, oben Alfred Vierkötter, Joachim Dreilich, oben Heribert Frielingsdorf, Horst Pütz, oben Josef Faßbender, Hugo Steimel, oben Helmut Steimel. | |
|
1947
Foto von R. Starke vor dem Haus von Schuhmacher Scharrenbroich, Hauptstraße 18. An den Hauswänden sind noch die Einschlaglöcher von Granatsplittern zu sehen. Helga Henkel verh. Nitsch, Helga Dichanz verh. Lindemann, Marianne Tüttenberg verh. Pohl,... Foto von R. Starke vor dem Haus von Schuhmacher Scharrenbroich, Hauptstraße 18. An den Hauswänden sind noch die Einschlaglöcher von Granatsplittern zu sehen. Helga Henkel verh. Nitsch, Helga Dichanz verh. Lindemann, Marianne Tüttenberg verh. Pohl, Inge Linden, Inge Henkel verh. Naumann, Maria van der Viefen verh. Bruns, Käthe Ennenbach verh. Giesen, Eveline Gschwind verh. Körting, davor Bert Schüller, Werner Ennenbach, Karl-Josef Hein, Heribert Frielingsdorf, sitzend: Hans-Josef Speer, Heinz-Josef Frielingsdorf, Franz Ramme, Franz-Josef Kümmler.
| |
Nachdem deutsche Truppen auf Ostersonntag, dem 1.4.1945 die Stahlbogenbrücke über die Agger gesprengt hatten, organisierte sich Willi Weppler, ein ehemaliger Pioniersoldat, ein Wehrmachts-Schlauchboot, band vorne und hinten ein langes Seil daran und... Nachdem deutsche Truppen auf Ostersonntag, dem 1.4.1945 die Stahlbogenbrücke über die Agger gesprengt hatten, organisierte sich Willi Weppler, ein ehemaliger Pioniersoldat, ein Wehrmachts-Schlauchboot, band vorne und hinten ein langes Seil daran und konnte es so als Fähre von einem Ufer zum anderen ziehen. Die Freude währte allerdings nicht lange. Amerikanische Besatzungssoldaten konfiszierten das Schlauchboot und schnitten es kaputt. Daraufhin baute man eine tiefliegende hölzerne Notbrücke, die aber schon am 4.2.1946 vom Hochwasser wieder weggeschwemmt wurde. So frustrierend und ärgerlich die Willkür der Besatzungssoldaten auch war, Willi Weppler ließ sich nicht entmutigen. Als die erste Notbrücke weggeschwemmt war, baute er aus leeren Benzinkanistern als Pontons eine neue Fähre (siehe obiges Foto) und diesmal sogar mit einem Steuerruder, so daß die Fähre alleine mit Rollen an einem Stahlseil entlang auf die gegenüberliegende Seite gesteuert werden konnte. Er hatte sogar, wie man auf dem Foto sehen kann, hüben und drüben Landungsstege gebaut, um die Fähre besser besteigen und verlassen zu können. Durch die 1948 gebaute hochstehende hölzerne Notbrücke wurde dann die Fähre überflüssig. | |
Ende 1923/Anfang 1924 kaufte die Genossenschaft „Vom armen Kinde Jesu“ – Mutterhaus der Gründerin Clara Fey in Aachen – von den Besitzern der Fassfabrik Endrulat und Eschbach (heute Gewerbegebiet Auelsweg) Lohmarhöhe, um dort ein Heim für... Ende 1923/Anfang 1924 kaufte die Genossenschaft „Vom armen Kinde Jesu“ – Mutterhaus der Gründerin Clara Fey in Aachen – von den Besitzern der Fassfabrik Endrulat und Eschbach (heute Gewerbegebiet Auelsweg) Lohmarhöhe, um dort ein Heim für verwahrloste Kinder und Waisenkinder aus Köln einzurichten. Hier war auch bis in die 1960er Jahre der erste Lohmarer Kindergarten. Auf dem Foto von Weiberfastnacht 1947 stehen die Kinder des Kindergartens maskiert vor dessen Eingang. | |
Kurze Zeit nach dem Krieg wurde mit den Steinen des abgebrannten Hotels die Gaststätte Schnitzler wieder aufgebaut. Ende August 1946 war schon der Rohbau weitgehend fertig und man hatte an der Fassade auf einem Stuhl den Kirmeskerl (Peijass)... Kurze Zeit nach dem Krieg wurde mit den Steinen des abgebrannten Hotels die Gaststätte Schnitzler wieder aufgebaut. Ende August 1946 war schon der Rohbau weitgehend fertig und man hatte an der Fassade auf einem Stuhl den Kirmeskerl (Peijass) befestigt. An dem Wiederaufbau der Gaststätte hatten sich die Männer des Kirchenchores durch „Steinekloppen“ und Hand- und Spanndienste verdient gemacht. | |
Auf dem Foto sind die Jungen, die am Weißen Sonntag 1940 mit zur Ersten Hl. Kommunion gegangen sind. Von links nach rechts sieht man: 1. Wolfgang Kirschbaum (Heimkind) 2. Martin Schmitz (Ziegelfeld) 3. Reinhold Merten 4. Josef Mörs (Heimkind) 5.... Auf dem Foto sind die Jungen, die am Weißen Sonntag 1940 mit zur Ersten Hl. Kommunion gegangen sind. Von links nach rechts sieht man: 1. Wolfgang Kirschbaum (Heimkind) 2. Martin Schmitz (Ziegelfeld) 3. Reinhold Merten 4. Josef Mörs (Heimkind) 5. Willi Rösing 6. (vor 5.) Peter Kissel 7. Paul Abel 8. Hans Meier (Donrath) | |
Eva Bartels war vom 1.4.1940 bis 1.5.1943 Lehrerin an der Katholischen Volksschule in Lohmar in der Kirchstraße. Sie hatte etwa im Sommer 1941 mit dem dritten und vierten Schuljahr einen Spaziergang zur Pützerau (hieß damals Talweg) in den Wald... Eva Bartels war vom 1.4.1940 bis 1.5.1943 Lehrerin an der Katholischen Volksschule in Lohmar in der Kirchstraße. Sie hatte etwa im Sommer 1941 mit dem dritten und vierten Schuljahr einen Spaziergang zur Pützerau (hieß damals Talweg) in den Wald gemacht und dabei die Jungen und Mädchen getrennt fotografieren lassen. Es sind von den Jungen zu sehen:
| |
Wahrscheinlich an einem Sonntag um 1940 herum bringt Peter Büscher vom Ziegelfeld in Lohmar seinen Besuch für die Rückreise zum Bahnhof in die Kirchstraße, die damals Bahnhofstraße hieß. Auf dem Foto geht die Gesellschaft gerade am Sportplatz vorbei,... Wahrscheinlich an einem Sonntag um 1940 herum bringt Peter Büscher vom Ziegelfeld in Lohmar seinen Besuch für die Rückreise zum Bahnhof in die Kirchstraße, die damals Bahnhofstraße hieß. Auf dem Foto geht die Gesellschaft gerade am Sportplatz vorbei, der zu dieser Zeit auf den „Broichs Wiesen“ war. Es ist eines der wenigen Fotos vom Sportplatz an dieser Stelle. Das Gebiet wurde schon Mitte der 1950er Jahre bebaut und heißt heute „Am Burgweiher“. Den Sportplatz auf den Broichs Wiesen haben die englischen Besatzungssoldaten, die am Ziegelfeld ein Barackenlager hatten, nach dem Ersten Weltkrieg, etwa 1918/19 angelegt. Der 1919 gegründete Sportverein Lohmar durfte diesen Platz mitbenutzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wiederum Besatzungssoldaten dem Lohmarer Verein den Platz wieder weggenommen. Nach vielen Verhandlungen und mit Mühe und Not hatte letztlich der Lohmarer Bürgermeister Wilhelm Schultes ein Stück Land an der Altenrather Straße für einen neuen Sportplatz zur Verfügung gestellt, der in den 1980er Jahren wegen der Friedhofserweiterung aufgegeben wurde. | |
Die Mädchen des 6. Schuljahres der Kath. Volksschule in Lohmar sind 1938 im Pfarrgarten vor dem Pastorat fotografiert worden. Auf dem Foto sieht man: 1. Katharina Bühne 2. Leni Distelrat 3. Hedwig Ramme, verh. Rech 4. Thea Dunkel, verh. Kliesen 5.... Die Mädchen des 6. Schuljahres der Kath. Volksschule in Lohmar sind 1938 im Pfarrgarten vor dem Pastorat fotografiert worden. Auf dem Foto sieht man: 1. Katharina Bühne 2. Leni Distelrat 3. Hedwig Ramme, verh. Rech 4. Thea Dunkel, verh. Kliesen 5. Resi Pape, verh. Katterfeld 6. Agnes Deurer 7. Anneliese Rottländer, verh. Krieger 8. Katharina Knipp 9. Veronika Faßbender | |
|
Januar 1939
Im Januar 1939 hatte der Lohmarer Turnverein seine Karnevalssitzung abgehalten. Auf dem Foto sind der Elferrat, der Herold, ein Polizist und noch zwei weitere Jecken abgebildet. Zu sehen sind: Im Januar 1939 hatte der Lohmarer Turnverein seine Karnevalssitzung abgehalten. Auf dem Foto sind der Elferrat, der Herold, ein Polizist und noch zwei weitere Jecken abgebildet. Zu sehen sind: | |
|
19. April 1933
- 25. April 1940 Johann Ballensiefer war vom 19.4.1933 bis zu seinem Tod im Reservelazarett in Bochold am 25.4.1940 Leiter derEllhauser Schule. Auf dem Foto von 1937 ist er mit seinen Schülern an der Ellhauser Schule zu sehen: 1. Änni Eschbach 2. Maria Becher 3.... Johann Ballensiefer war vom 19.4.1933 bis zu seinem Tod im Reservelazarett in Bochold am 25.4.1940 Leiter derEllhauser Schule. Auf dem Foto von 1937 ist er mit seinen Schülern an der Ellhauser Schule zu sehen: 1. Änni Eschbach 2. Maria Becher 3. Hilde Küpper 4. Käthe Klein verh. Jünnemann 5. Maria Domm verh. Broich 6. Margarethe Koll 7. Lieschen Schmitz 8. Hans Becher 9. Johann Ballensiefer (Lehrer) 10. Hildegard Krumbe verh. Scholz 11. Ilse Doner verh. Röhrbein 12. Resi Busch verh. Schuhmacher 13. Leni Becher verh. Krauthäuser 14. Mathilde Krumbe verh. Schmitz 15. Margarethe Holden 16. Willi Wielpütz 17. Hans Schmidt 18. Willi Oberscheid 19. Heinrich Höffer 20. Peter Oberscheid 21. Maria Höffer verh. Oberscheid 22. Christel Domm 23. Käthe Meier verh. Overath 24. Käthe Koll verh. Mattik 25. Maria Klein 26. Kathrinchen Faßbender verh. Hoffmann 27. Josef Lagier 28. Leni Oberscheid verh. Riemschoß 29. Hermann Tölle 30. Helene Burger verh. Klug 31. Edeltraud Dilly 32. und 33. unbekannt 34. Heinrich Burger 35. unbekannt 36. Josephine Höffer verh. Forsbach 37. Sophie Domm verh. Zanpinie 38. Gertrud Koll 39.Günter Limbach 40. Hans Meier 41. Kurt Pütz 42. Paul Becher 43. Reinhold Klein 44. Anneliese Müller verh. Bonn 45. Inge Mylenbusch verh. Labudde 46. Änne Krumbe verh.Dünnwald 47. Leni Schmitz verh. Klein 48. Erika Overath 49. Willi Krumbe 50. Bernhard Schmitz 51. Josef Meurer 52. Karl Küpper 53. Heinz-Robert Limbach 54. unbekannt 55. Willibald Jakobs 56. Hans Josef Hosp 57. Richard Langel 58. Hans Lange | |
|
21. Juni 1938
Die Aufnahme von der Empore der Kirche St. Mariä Geburt entstand zu Beginn des Gottesdienstes: Der Zelebrant, ein Benediktinerpater, verrichtet mit den Messdienern das Stufengebet. Links kniet auf dem schön geschnitzten Betstuhl der Kölner... Die Aufnahme von der Empore der Kirche St. Mariä Geburt entstand zu Beginn des Gottesdienstes: Der Zelebrant, ein Benediktinerpater, verrichtet mit den Messdienern das Stufengebet. Links kniet auf dem schön geschnitzten Betstuhl der Kölner Weihbischof Wilhelm Stockums. Vor ihm steht auf gleicher Seite Pfarrer Anton Michels, der das Stufengebet mit den Gläubigen gleichzeitig verrichtet. Rechts am Pfeiler steht ein weiterer Priester, vermutlich der Pfarrer von Seelscheid. Das vordere Mittelschiff ist gefüllt von Firmlingen der letzten fünf Kommunionjahrgänge, darunter auch Messdiener und unsere Geschwister Theo und Elisabeth. | |
Die Pützerau (richtiger würde es, wie auf dem Foto, Pützerhau heißen, weil „au“ auf Wasser und „hau“ auf Wald hindeutet) zweigt auf dem höchsten Punkt der ersten Anhöhe der „Alte Lohmarer Straße“ nach Süden ab. Die Straße hieß früher Talweg weil es... Die Pützerau (richtiger würde es, wie auf dem Foto, Pützerhau heißen, weil „au“ auf Wasser und „hau“ auf Wald hindeutet) zweigt auf dem höchsten Punkt der ersten Anhöhe der „Alte Lohmarer Straße“ nach Süden ab. Die Straße hieß früher Talweg weil es ein alter Prozessionsweg zum Hl. Rochus nach Seligenthal war. 1933 hatte die Rheinische Heimstättengesellschaft mit Siedlern begonnen die „Wildnis“ Pützerhau urbar zu machen und dort vier Doppelhäuser und ein Einzelhaus im Stil der aus Amerika bekannten Trapper-Blockhütten zu bauen. Daher nannte man die Siedlung scherzhaft „Klein Alaska“. Die damaligen Siedler waren im 1. Doppelhaus die Eheleute Jakob Müller und Karl Kurtsiefer, im 2. Wilhelm Pauli und Johann Lüdenbach, im 3. Peter Arnold und Peter Rottländer, im 4. Josef Blum und Otto Schug und im 5. – das Einzelhaus –, die Eheleute Johann Burger und Margarethe geb. Dunkel. Scheinbar hatte man unmittelbar danach auch schon begonnen Häuser in Massivbauweise zu errichten, so das Haus des Hermann Stöcker, das im Anschluß an die Blockhäuser emporragt. Der unbefestigte Weg und der angrenzende Wald vermitteln um diese Zeit tatsächlich den Eindruck von „Klein Alaska“. | |
Klassenlehrerin für das erste Schuljahr war sowohl in den 1950er Jahren wie auch früher Gertrud Wingensiefen. Von 1927 bis 1956 führte sie die Erstklässler in das Schulleben ein. Sie war eine sehr beliebte mütterliche, liebevolle Lehrerin. Das Foto... Klassenlehrerin für das erste Schuljahr war sowohl in den 1950er Jahren wie auch früher Gertrud Wingensiefen. Von 1927 bis 1956 führte sie die Erstklässler in das Schulleben ein. Sie war eine sehr beliebte mütterliche, liebevolle Lehrerin. Das Foto oben zeigt einen Blick in den Klassenraum des ersten Schuljahres von 1938. In dem Klassenraum standen zwei Reihen 4er-Bänke mit Klappsitzen. Auf dem Foto ist die Reihe zum Schulhof hin festgehalten worden. Zu sehen sind von hinten nach vorne und auf den Bänken von links nach rechts: | |
|
1937
Mit großer Beteiligung der Birker Bevölkerung wurden die jährlichen Maifeste gefeiert. Das Foto zeigt das Maikönigspaar Josef Orth aus Birk und Agnes Weiler (Müller) im einem PKW Cabriolet, Marke „Adler“, vor dem gepflegten Fachwerkhaus Merten,... Mit großer Beteiligung der Birker Bevölkerung wurden die jährlichen Maifeste gefeiert. Das Foto zeigt das Maikönigspaar Josef Orth aus Birk und Agnes Weiler (Müller) im einem PKW Cabriolet, Marke „Adler“, vor dem gepflegten Fachwerkhaus Merten, Birker Straße. Der Adjutant Josef Oligschläger mit Zylinder, Stehkragen und weißen Handschuhen. Die vier Blumenmädchen sind von links Anneliese Orth (Burand), Christel Nöbel, Paula Meurer, (Schmitz) und Marianne Orth (Salgert). | |
|
10. Mai 1936
Marianische Jungfrauenkongregation war der Verein katholischer unverheirateter Frauen in Lohmar, der 1903 gegründet wurde. Aufgenommen wurde man nach der Entlassung aus der Volksschule. Am 10. Mai 1936 hat sich diese Kongregation nach der Aufnahme... Marianische Jungfrauenkongregation war der Verein katholischer unverheirateter Frauen in Lohmar, der 1903 gegründet wurde. Aufgenommen wurde man nach der Entlassung aus der Volksschule. Am 10. Mai 1936 hat sich diese Kongregation nach der Aufnahme der neuen Mitglieder im Pfarrgarten mit Kaplan Hoppe für ein Gruppenfoto versammelt. Zu sehen sind: 1. Anni Becker verh. Posten, 2. Elisabeth Schopp verh. Scheiderich, 3. unbekannt, 4. Kätti Müller (Schwester von Bernhard W alterscheid-Müller), 5. Sibille Kreuzer verh. Pahl, 6. Margarethe Becker verh. Hessler, 7. Hilde Klein verh. Maiwald, 8. Leni Zimmermann verh. Haas, 9. Leni Weingarten verh. Dienemann, 10. Hilde Schwillens, 11. Irmgard Terhard verh. Peterhensa, 12.-14. unbekannt,15. Änne Pohl, 16. Kätti Scheiderich verh. Altenrath, 17. Margarethe Dunkel verh. Burger, 18. unbekannt, 19. Kätti Weingarten verh. Steinbach, 20. Christine Roland verh. Fichtner, 21. unbekannt, 22. Margarethe Rörig verh. Streichardt, 23. unbekannt, 24. Käthe Reers?, 25. Rosemarie Fischer , 26. unbekannt, 27. Käthe Eschbach verh. Roland Heinrich, Hauptstr. 23 (heute Stadthaus), 28. und 29. unbekannt 30. Maria Wacker verh. Schüller, 31. Maria Nieten, 32. Tilda Nieten verh. Melzer, 33. und 34. unbekannt, 35. Kätti Altwickler verh. Steinbrecher, 36. Anneliese Weingarten (Donrath), 37. unbekannt, 38. Gertrud Piller verh. Kiel, 39. – 41. unbekannt, 42. Lisbeth Kruft verw. Bois, verh. Diebel, 43. Gretchen Kronenberg, 44. Anna ?, 45. Kaplan Josef Hoppe, 46. – 51. unbekannt | |
|
1936
- 1937 Auf dem Foto von etwa 1936/37 ist die Familie Rörig von der Hauptstraße (heute Stadthaus) zu sehen. Hinten sind die Geschwister links Margarethe Rörig verh Streichardt (die Mutter des Vorsitzenden des HGV Gerd Streichardt) und rechts Josef Röhrig... Auf dem Foto von etwa 1936/37 ist die Familie Rörig von der Hauptstraße (heute Stadthaus) zu sehen. Hinten sind die Geschwister links Margarethe Rörig verh Streichardt (die Mutter des Vorsitzenden des HGV Gerd Streichardt) und rechts Josef Röhrig (Amtskämmerer) zu sehen. Vorne links sitzt die Mutter der beiden, Maria Rörig geb. Hagen, und rechts der Vater Josef Rörig (gebürtig aus Grimberg). In der Mitte sitzt Oma Anna Margarethe Hagen geb. Kemmerich. | |
|
1935
- 1936 Der Bauernhof Kurscheid war in Lohmar an der Hauptstraße in Richtung Siegburg auf der rechten Seite neben der heutigen Mundorf-Tankstelle. Auf dem Foto von etwa 1935/36 wird Grünfutter für das Vieh in das Silo gefüllt. Rechts ist das Wohnhaus und... Der Bauernhof Kurscheid war in Lohmar an der Hauptstraße in Richtung Siegburg auf der rechten Seite neben der heutigen Mundorf-Tankstelle. Auf dem Foto von etwa 1935/36 wird Grünfutter für das Vieh in das Silo gefüllt. Rechts ist das Wohnhaus und geradeaus sind Scheune und Stallung. Die Hofanlage wurde etwa 1961/62 abgerissen und an der Hauptstraße zwei große Mietshäuser gebaut (Hauptstraße Nr. 94a und 94b). | |
|
1934
- 1935 Jungen des Jahrganges 1922 bei einem Spaziergang 1934/35.Der Spaziergang dürfte im frühen Frühjahr stattgefunden haben, denn die Jungen sind mit dicken Jacken oder Mänteln bekleidet – tragen aber trotzdem kurze Hosen! Wahrscheinlich bei einem... Jungen des Jahrganges 1922 bei einem Spaziergang 1934/35.Der Spaziergang dürfte im frühen Frühjahr stattgefunden haben, denn die Jungen sind mit dicken Jacken oder Mänteln bekleidet – tragen aber trotzdem kurze Hosen! Wahrscheinlich bei einem Spaziergang mit der Schulklasse 1934 oder 1935 haben sich die Jungen des Jahrgangs 1922 für ein Foto aufgestellt. Zu sehen sind: obere Reihe: Peter Lohmar, Hans Schug, Peter Arnold, Ludwig Halberg (später Lebensmittelgeschäft Halberg anyder Hauptstraße Nr. 46) und Ludwig Bouserath; kniend: Johannes Hagen untere Reihe: Ewald Becker, Walter Schug (später Rohrmeister im Wasserwerk Lohmar) und Willi Kraheck (später Dreherei im Haus Schmitz/Heinen an der Hauptstraße Nr. 38). | |
|
28. Mai 1935
Am 28. Mai 1935 heiratete der Lohmarer Landwirt Bernhard Kurscheid Elisabeth Scheiderich, Hauptstraße (heute Bestattungsgeschäft Arz). Am 28. Mai 1935 heiratete der Lohmarer Landwirt Bernhard Kurscheid Elisabeth Scheiderich, Hauptstraße (heute Bestattungsgeschäft Arz). | |
|
1930
Das Bild der 1930er-Jahre von der östlichen Peripherie Lohmars mit Blick vom Hardter „Hennefer Törchen“ zeigt, dass der Anteil des Acker- und Grünlandes in Lohmar groß war. Erst in der Nachkriegszeit, etwa Mitte der 1950er-/ Anfang der 1960er-Jahre,... Das Bild der 1930er-Jahre von der östlichen Peripherie Lohmars mit Blick vom Hardter „Hennefer Törchen“ zeigt, dass der Anteil des Acker- und Grünlandes in Lohmar groß war. Erst in der Nachkriegszeit, etwa Mitte der 1950er-/ Anfang der 1960er-Jahre, wurde das offene Landschaftsbild im Vordergrund zu sehen, verdichtet und bebaut. Aus den Feld-, Wiesen- und Fußwegen parallel zum unteren Bildrand wurden die Straßenzüge „Im Korresgarten, Christianstraße und Auf der Hardt“, senkrecht dazu am rechten Bildrand die Hermann-Löns-Straße und links der Feldpfad der zum Talweg führt und der am Dreieck Waldweg/Bachstraße in den Waldweg einmündete. In der Bildmitte sind Fachwerkhäuser eines Teils der Bachstraße, des ehemaligen Waldwegs (heute Humperdinckstraße) mit Abzweig zum späteren „Grünen Weg“ zu erkennen, von links nach rechts gesehen: Das giebelständige Haus Wolters, der Doppelgiebel des Hauses von Joseph Heuser, „de Hüsers Bepp“, das Haus von Mahlbergs, Ecke Waldweg/Bachstraße, Lehrs zweistöckiges Fachwerkhaus mit Mansardedach, Ecke Steinhöfer Weg/Bachstraße, die giebelständige Scheune und die vordere Traufe des Wohnhauses von Jacob Gerhards, van der Viefens Fachwerkhaus, das Wohnhaus Schüller, ehem. Schlosserei von Wilhelm Pape ju., Haus Paul Krautheuser, der Vorgängerbau von Erich Krautheuser, Dunkels Haus, Ecke Grüner Weg, (heute Eva und Sohn Bernd Palm), etwas versetzt dahinter an der Bachstraße die beiden Nebengebäude der „Villa Friedlinde“, rechts das Fachwerkhaus ist das heutige „HGV-Haus“, dahinter ein weitres verputztes, weiß gestrichenes Nebengebäude der Villa Baumann (heute Villa Friedlinde), das Anfang der 70er Jahre abgerissen wurde, und links davon der Guttenhof mit Abzweig zum Eisenmarkt im „Saujässje“, rechts davon die Villa Baumann mit Einfriedungsmauer parallel zum noch offen fließenden Auelsbach. Die größeren Gebäude der Hauptstraße von links: die Einmündung der heutigen Gartenstraße in die Hauptstraße, das Haus von Joseph Becker, schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite das Lebensmittelgeschäft von Theodor Kemmerich (später von Wilhelm Urbach), gegenüber Hauptstraße 91, rechts die Einmündung in den heutigen Steinhöfer Weg, das Haus von Metzger Peter Krumm, daneben das heutige Tapeten- und Farbengeschäft Zimmermann, rechts davon zurückliegend die Villa Therese, das ehemalige Haus Waldesruh auf der anderen Straßenseite und mit dem Giebel gerade an den Tannen herausschauend die Gastwirtschaft zur Linde. Im Hintergrund der Bachhof, die Burg Lohmar mit Vorburg und Haupthaus, die Kath. Kirche sowie der Lohmarberg, der Ziegenberg mit Forstweg zur Kuppe und rechts davon der Scherfeberg. Dazwischen, oberhalb der Talmulde des Witzenbachs, kann man ganz schwach den Kirchturm und den Ort Altenrath erkennen. | |
|
1939
- 1939 Die Fotografie vom Ziegenberg herunter zeigt im Vordergrund des Bildes am rechten Bildrand das mittelalterlichneuzeitliche, zweigeschossige Herrenhaus der Lohmarer Burg (14. Jh.), ein massives Bruchsteinwohnhaus mit einem Teil der dreiflügeligen... Die Fotografie vom Ziegenberg herunter zeigt im Vordergrund des Bildes am rechten Bildrand das mittelalterlichneuzeitliche, zweigeschossige Herrenhaus der Lohmarer Burg (14. Jh.), ein massives Bruchsteinwohnhaus mit einem Teil der dreiflügeligen Vorburg (17. Jh.), die zeitlich wesentlich später entstanden ist als das Haupthaus. Früher war das eigentliche Burghaus von einem Wassergraben umgeben. Nach Osten schließt die Trasse der neuen Bundesautobahn Köln–Frankfurt an, die die direkte axiale Verbindung der Burg zum Kirchdorf zerschneidet. In der Bildmitte erkennt man das alte Pfarrhaus von 1896 und davor die Stallungen, die Pfarrer Düsterwald 1908 angebaut hatte. Rechts die Fachwerkgebäude des Kirchdorfs, vorne der Fachwerkhof Müller, dieser wurde anlässlich des Lärmschutzwalls der A3 abgerissen. Dahinter das Krüppelwalmdach des Pützerhofs mit giebelständiger Scheune, der Neuhof mit Scheune, das Offermannshaus von Organist und Küster Roland Piller, heute gehört das Haus Hans Keuler, der Fronhof mit den beiden Zehntscheunen gegenüber der Pfarrkirche von Lohmar. Die Lohmarer Chaussee in Höhe Kirchstraße auf der Strecke zwischen Lohmar und Siegburg bis etwa Einmündung der Bachstraße mit der davorliegenden Feldflur „Im großen Kirchenfeld“. | |
Kaplan Wilhelm Gabriel Graf (von Juni 1932 bis Frühjahr 1933 Kaplan in Lohmar) war sehr beliebt und in der Jugendarbeit sehr kreativ. Er hatte in seinem kurzen „Gastspiel“ in Lohmar in der Katholischen Jugend eine Puppenspielergruppe gegründet. Die... Kaplan Wilhelm Gabriel Graf (von Juni 1932 bis Frühjahr 1933 Kaplan in Lohmar) war sehr beliebt und in der Jugendarbeit sehr kreativ. Er hatte in seinem kurzen „Gastspiel“ in Lohmar in der Katholischen Jugend eine Puppenspielergruppe gegründet. Die Jugendlichen hatten sich dafür ihre Puppen und das Theater selbst hergestellt. Am 18. Januar 1933 war die erste Vorstellung mit „Kölsch Hennesje“. Wahrscheinlich vor oder nach einer Aufführung im Frühjahr 1933 hatten sich die Akteure für ein Erinnerungsfoto im Pfarrgarten fotografieren lassen: Von links nach rechts: Kurt Mahlberg, Peter Kümmler, Theo Schopp, Josef Schönenborn, Kaplan Wilhelm Gabriel Graf, Willi Kudla, , ... Müller, Fritz Roland und Josef Frembgen. | |
|
1930
- 1939 Am 6.3.1891 hat die Gemeinde Lohmar dem aus Köln stammenden Johann Josef Niessen die Parzelle Flur III, 647/0320 mit dem Wegekreuz und der Dorflinde verkauft, um sich hier eine Villa zu bauen.Das war die erste Villa in Lohmar. Niessen hatte dabei die... Am 6.3.1891 hat die Gemeinde Lohmar dem aus Köln stammenden Johann Josef Niessen die Parzelle Flur III, 647/0320 mit dem Wegekreuz und der Dorflinde verkauft, um sich hier eine Villa zu bauen.Das war die erste Villa in Lohmar. Niessen hatte dabei die Verpflichtung übernommen sowohl die Linde wie auch das darunter stehende Kreuz zu hegen und zu pflegen. Doch leider schon „im Mai 1892 starb Johann Josef Niessen in Rom, wohin er zur Kräftigung seiner Gesundheit gereist war. Ihm hat Lohmar sehr viel zu verdanken. Er starb viel zu früh, denn mit ihm schied der größte Wohltäter Lohmars aus dem Leben. Mit welcher Liebe er an Lohmar hing, ist daraus zu sehen, dass er nur in Lohmar beerdigt sein wollte. Er liegt auch auf dem Kirchenfriedhof begraben“ (Ludwig Polstorff, Chronik der Landbürgermeisterei Lohmar, Seite 23 f). | |
|
1930
- 1939 Die heutige Gaststätte, „Flohberg“, Pützrather Weg 1, ehemals Gasthaus „Agger-Sülz-Terrasse“ in Pützrath bei Donrath. Inhaber waren 1913 Johann und Elisabeth Paffrath. Die Sülztalstraße war noch nicht ausgebaut. Das Foto entstand etwa in den 1930er... Die heutige Gaststätte, „Flohberg“, Pützrather Weg 1, ehemals Gasthaus „Agger-Sülz-Terrasse“ in Pützrath bei Donrath. Inhaber waren 1913 Johann und Elisabeth Paffrath. Die Sülztalstraße war noch nicht ausgebaut. Das Foto entstand etwa in den 1930er Jahren. Nach mehreren unterschiedlichen Verpachtungen verkaufte schließlich deren Tochter Lisbeth, die Karl Marx geheiratet hatte, die Gastwirtschaft an die Familie Tierfeld, die die Gaststätte in „Flohberg“ umbenannten. | |
Am 4. September 1932 erteilte der Kirchenvorstand dem Kirchen- und Kunstmaler Felix Lüttgen aus Kripp bei Remagen den Auftrag zum Ausmalen der Kirche. Wohl auf Anregung von Pfarrer Anton Michels schuf Felix Lüttgen im Rahmen des Auftrages auf der... Am 4. September 1932 erteilte der Kirchenvorstand dem Kirchen- und Kunstmaler Felix Lüttgen aus Kripp bei Remagen den Auftrag zum Ausmalen der Kirche. Wohl auf Anregung von Pfarrer Anton Michels schuf Felix Lüttgen im Rahmen des Auftrages auf der eigens für den Seitenaltar vorbereiteten Kopfwand des Seitenschiffes die Darstellung des Stammbaums Jesu Christi oder der so genannten „Wurzel Jesse“. Das Thema ist am Beginn des Matthäus-Evangeliums beschrieben. Die Arbeit wurde in Ritztechnik auf frischem Putz ausgeführt.: Aus einem stilisierten Baum ragen links und rechts je vier Äste empor. Auf deren Blätter sind, angeführt von Jesse und David, insgesamt acht Könige des Biblischen Juda dargestellt. Über der als Lotosblume ausgebildeten Baumkrone stehen Maria und Jesus hinter der offenen Mondsichel zu ihren Füßen. Die Gloriole oder der Heiligenschein Mariens trägt die Umschrift : Ecce Ancilla Domini – Siehe die Magd des Herrn. Auf dem Saum von Jesu Obergewand steht der Satz: Et Verbum Caro Factum Est – Und das Wort ist Fleisch geworden. Maria und Jesus stehen in einer Strahlenmandorla. Die dunkle Fassung der Altarrückwand ist später der bildlichen Darstellung angepasst und aufgehellt worden. Felix Lüttgen war ein Künstler, der zu seiner Zeit neue Wege in der Gestaltung christlicher Kunst suchte, dies wie mehrere andere, zum Beispiel Dominikus Böhm in der Architektur und Peter Hecker in der Malerei sowie die Beuroner Schule überhaupt. Von ihm sind Arbeiten in Bornheimer Kirchen bekannt, insbesondere das große Christusmosaik an der Altarrückwand in St. Josef in Bornheim-Kardorf. Leider waren die Arbeiten vielfach von Unverständnis, in Birk sogar in der Zeit des Entstehens von antisemitischen Bemerkungen begleitet. Bei der Restaurierung der Kirche im Jahr 1960 wurde das Werk ohne vorherige Ankündigung zerstört. | |
|
28. Februar 1931
Fritz Nußbaum war von 1930 bis 1934 Lehrer an der Volksschule in Lohmar in der Kirchstraße. Am 28. Februar 1931 hat er sich mit dem 7. und 8. Schuljahr vor dem Schulgebäude fotografieren lassen. Dieses Foto ist eins der ganz wenigen, das auf der... Fritz Nußbaum war von 1930 bis 1934 Lehrer an der Volksschule in Lohmar in der Kirchstraße. Am 28. Februar 1931 hat er sich mit dem 7. und 8. Schuljahr vor dem Schulgebäude fotografieren lassen. Dieses Foto ist eins der ganz wenigen, das auf der Rückseite mit Datum und Namen versehen ist. Zu sehen sind jeweils von links nach rechts: | |
Werkstatt der Malerfirma Johann Henseler in Lohmar etwa 1930 Die Malerfirma Johann Henseler wurde etwa 1925 in der Kirchstraße im Hause Piller (heute Keuler, Nr. 27) gegründet und ist 1928 in das neu erbaute Haus Henseler (heute Blum, Nr.1) in die... Werkstatt der Malerfirma Johann Henseler in Lohmar etwa 1930 Die Malerfirma Johann Henseler wurde etwa 1925 in der Kirchstraße im Hause Piller (heute Keuler, Nr. 27) gegründet und ist 1928 in das neu erbaute Haus Henseler (heute Blum, Nr.1) in die Altenrather Straße umgezogen. Dort entstand dann etwa 1930 obiges Foto, auf dem von links nach rechts 1. der Chef, Johann Henseler, 2. Hans Wißborn (de Bombe Hannes), 3. Franz Altenrath und 4. August Walterscheid zu sehen sind. 1956 übernahm Johanns Sohn Erwin die Firma bis dieser sie 1970 aufgab. (Alle Angaben von Erwin Henseler) Beide Henselers – Vater und Sohn – waren nicht nur Anstreicher, sondern auch künstlerisch sehr begabte Maler und Restaurateure. Viele Gemälde auf Holz, Leinwand und Wänden tragen ihren Namen. | |
Johann van der Viven war von 1923 bis 1932 Lehrer an der einklassigen Schule in Ellhausen. Er war mit einer Tochter der Familie Roth aus dem Thelenhof in Halberg verheiratet und in Ellhausen sehr beliebt. 1930 hat er die Sage vom ewigen Jäger in die... Johann van der Viven war von 1923 bis 1932 Lehrer an der einklassigen Schule in Ellhausen. Er war mit einer Tochter der Familie Roth aus dem Thelenhof in Halberg verheiratet und in Ellhausen sehr beliebt. 1930 hat er die Sage vom ewigen Jäger in die Ellhauser Schulchronik eingetragen. Auf dem Foto von 1931 – im Jungensiefen hinter der Schule aufgenommen – sieht man | |
|
1925
- 1930 Teilansicht von Lohmar-Ort aus Südosten in etwa dem gleichen Standpunkt aus der gleichen Perspektive – ein Bild von der Peripherie Lohmars – der alten Lohmarer Straße und Bachstraße von Osten gesehen, im Hintergrund Burg und Kirche, in etwa der... Teilansicht von Lohmar-Ort aus Südosten in etwa dem gleichen Standpunkt aus der gleichen Perspektive – ein Bild von der Peripherie Lohmars – der alten Lohmarer Straße und Bachstraße von Osten gesehen, im Hintergrund Burg und Kirche, in etwa der gleichen Zeit wie vor (1925/1930) wieder. Im Vordergrund der Sandweg war gleichzeitig die neue Rodelbahn, der zum damals unbebauten Hardt- und Kreuelsfeld führte. | |
Auf dem Foto vom Ende der 1920er Jahre hat sich der Gesangverein vor dem Hotel „Zur Linde“ aufgestellt. Einige Mitglieder sind noch mit Ehrenzeichen aus dem Ersten Weltkrieg dekoriert. Zu sehen sind: Auf dem Foto vom Ende der 1920er Jahre hat sich der Gesangverein vor dem Hotel „Zur Linde“ aufgestellt. Einige Mitglieder sind noch mit Ehrenzeichen aus dem Ersten Weltkrieg dekoriert. Zu sehen sind: | |
|
1929
Im Winter 1929 fand in Lohmar mit dem Tanzlehrer Haas aus Seelscheid ein Tanzkursus statt. Am Klavier war Martin Köb aus Lohmar. Auf dem Foto sieht man von links nach rechts und die Reihen von oben nach unten: Obere Reihe: Peter Urbach, Herbert... Im Winter 1929 fand in Lohmar mit dem Tanzlehrer Haas aus Seelscheid ein Tanzkursus statt. Am Klavier war Martin Köb aus Lohmar. Auf dem Foto sieht man von links nach rechts und die Reihen von oben nach unten: Obere Reihe: Peter Urbach, Herbert Endrulat (Fassfabrik), Josef Becker, Heinrich Roland, Bernhard Müller (später Walterscheid-Müller), Willi Bargon, Josef Schönenborn, Fred Allmann und Josef Hagen. 2. Reihe: Martin Köb (am Klavier), unbekannt aus Troisdorf, Josef Rörig, unbekannt aus Troisdorf, Gertrud Bouserath, Tanzlehrer Haas, Änne Ramme, Christine Piller, Maria Bouserath und Bertram Becker. 3. Reihe: Luci Huckenbeck, Maria Keller, verh. Ningelgen, Else Schmitz (von der Stellmacherei Schmitz in der Kirchstraße – später in die DDR verheiratet), Käthe Müller, Lisbeth Köb und Lisbeth Dunkel (später in ein Kloster eingetreten). | |
|
1928
Das Foto aus dem Jahre 1928 zeigt das Gasthaus bzw. das Hotel „Zur Linde“ neben der Waldesruh, Ecke Hauptstraße/Kirchstraße in Lohmar, Besitzer war zu dieser Zeit Wilhelm Heere (1927-33). Die Gastwirtschaft wurde 1881 von Peter Josef Knipp erbaut und... Das Foto aus dem Jahre 1928 zeigt das Gasthaus bzw. das Hotel „Zur Linde“ neben der Waldesruh, Ecke Hauptstraße/Kirchstraße in Lohmar, Besitzer war zu dieser Zeit Wilhelm Heere (1927-33). Die Gastwirtschaft wurde 1881 von Peter Josef Knipp erbaut und war 1909 um einen Bühnenanbau und drei Fremdenschlafzimmer erweitert worden. Die Gebäude sind in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre abgerissen und durch den heute genutzten, wenig schönen Zweckbau ersetzt worden. Der Eingang zum dazugehörigen Saal mit Bühne, zwischen Gaststätte und Haus Waldesruhe, war von der Hauptstraße aus. Als die Hauptstraße noch verkehrsberuhigt war, die Pflasterung der Hauptstraße ist erst 1929 erfolgt, wurde unter den Bäumen eine Außengastronomie betrieben. Das Hotel zur Linde war ein beliebtes Vereinslokal der Lohmarer Vereine und Karnevalsgesellschaften. Ende des Krieges war der Saal, wie auch alle anderen Säle der Umgebung, mit ankommenden Flüchtlingen und Vertriebenen belegt worden. | |
|
1925
- 1926 Peter Roth war vom 1.11.1920 bis 1.3.1927 Lehrer an der Kath. Volksschule in Lohmar. Im Sommer 1925 oder 1926 machte er mit seiner Klasse einen Waldspaziergang, bei dem das obige Foto entstand. Zu sehen sind: Peter Roth war vom 1.11.1920 bis 1.3.1927 Lehrer an der Kath. Volksschule in Lohmar. Im Sommer 1925 oder 1926 machte er mit seiner Klasse einen Waldspaziergang, bei dem das obige Foto entstand. Zu sehen sind: | |
|
1920
- 1929 Haus Sülz, an der Sülztalstraße zwischen Lohmar und Rösrath, ist urkundlich schon früher erwähnt als Lohmar, nämlich 1065 ging es als Geschenk des Pfalzgrafen an die Abtei Siegburg und zählt damit zu den ältesten Adelssitzen des ehemaligen... Haus Sülz, an der Sülztalstraße zwischen Lohmar und Rösrath, ist urkundlich schon früher erwähnt als Lohmar, nämlich 1065 ging es als Geschenk des Pfalzgrafen an die Abtei Siegburg und zählt damit zu den ältesten Adelssitzen des ehemaligen Siegkreises. Um 1400 ist es Eigentum derer von Stael-Holstein, um 1600 derer von Zweiffel, 1766 gehört es Paul von Lavalette St. George und um 1900 der Familie Linden von Haus Venauen in Rösrath. Das Foto aus der Mitte der 1920er Jahre läßt uns in die Küche von Haus Sülz blicken. Links am Tisch sitzt Hedwig Frackenpohl verh. Fischer, am Herd rührt ihre Schwester in einem großen Topf und rechts steht die Mutter der beiden. | |
Dieses Foto – eine Reproduktion einer Postkarte – aus der Zeit um 1920 zeigt Donrath mit Blick nach Sottenbach und Heppenberg. Im Vordergrund links das Sägewerk Paul Braun (heute Overath), der Gasthof „Weißes Haus“, rechts der Jörgeshof und daneben,... Dieses Foto – eine Reproduktion einer Postkarte – aus der Zeit um 1920 zeigt Donrath mit Blick nach Sottenbach und Heppenberg. Im Vordergrund links das Sägewerk Paul Braun (heute Overath), der Gasthof „Weißes Haus“, rechts der Jörgeshof und daneben, ganz rechts der Bahnhof. | |
Früher hatte fast jede Familie ein Stück Vieh (Schaf, Ziege oder eine Kuh), für das Winterfutter und Streu bereitgestellt werden musste. Für die Gewinnung des Strohs – die Körner wurden zu Mehl vermahlen – wurde oftmals Getreide angebaut, das im... Früher hatte fast jede Familie ein Stück Vieh (Schaf, Ziege oder eine Kuh), für das Winterfutter und Streu bereitgestellt werden musste. Für die Gewinnung des Strohs – die Körner wurden zu Mehl vermahlen – wurde oftmals Getreide angebaut, das im Winter mit dem Dreschflegel gedroschen werden musste. Ein Dreschflegel besteht aus dem Stock (auch „Rute“ oder „Ger“ genannt) und dem Klöppel. Der Klöppel wird aus Hainbuche hergestellt, am dünneren Ende ein Loch durchgebohrt und mit einem Lederriemen am Stock, der aus Nußbaum oder Eberesche besteht, befestigt. Die Länge des Stocks sollte vom dicken Zeh des Dreschers bis zu seiner Nasenspitze reichen. Zum Dreschen wurden auf dem Dänn (Tenne) zehn bis zwölf Schobbe (Garben) Getreide so zu einem Dreschbett ausgebreitet, dass die Ähren in der Mitte der Tenne lagen. Nun wurde durch mehrmaliges Umlegen der Garben viermal im Takt gedroschen (sehr ausführlich wird das Dreschen von Johannes Buchholz in den „Heimatblätter des Rhein-Sieg-Kreises“ im Jahrbuch 1977 auf der Seite 109 beschrieben – in der Bibliothek des HGV vorhanden). Auf dem Foto von etwa 1915 stehen die Brüder Pape, links Josef und rechts Wilhelm im Eingang ihrer Scheune „Op de Jass“ (auf der Gasse) heute Humperdinckstraße. Beide sind mit ihrem Dreschflegel „bewaffnet“. | |
Diese Ansichtskarte mit einer Partie der romantischen Flussaue des Aggertals mit einem Blick von Nordosten von Cyriax aus, in etwa vom Broicher Berg, über die Kreisgrenze hinweg gesehen auf das große Fabrikgebäude der Aggerhütte an der Aggertalstraße... Diese Ansichtskarte mit einer Partie der romantischen Flussaue des Aggertals mit einem Blick von Nordosten von Cyriax aus, in etwa vom Broicher Berg, über die Kreisgrenze hinweg gesehen auf das große Fabrikgebäude der Aggerhütte an der Aggertalstraße B 484 zwischen Wahlscheid und Overath. Den Namen „Aggerhütte“ trägt dieses Gebäude aus seiner Entstehungszeit vom Bergbau her, als die Honrather Gewerkschaft an dieser Stelle eine Erzaufbereitungsanlage, Mitte des 19. Jahrhunderts, errichtete. Hier wurden ab 1855 silberhaltige Bleierze und Kupfererze aus den Gruben „Aurora“, „St. Georg“ „Begegnung“ und „Volta“ verarbeitet. In Bildmitte, gegenüber der Hütte zweigt eine Fahrstraße nach Bombach ab, die durch den mittleren Bogen des Eisenbahnviadukt von Bombach nach Dahlhaus führt. Die Ortschaft Bombach liegt in einem Seitental der Agger am Dahlhauser Bach. Hier wird das Tal von dem 1909 erbauten Eisenbahnviadukt der Bahnstrecke Köln–Rösrath– Overath überspannt. Am Bildhorizont kann man ganz schwach die Honrather Kirche erkennen. | |
Auf dem Foto im Maylahn-Hof von etwa 1912 sieht man – von links nach rechts – auf dem Pferd ein Knecht, dann Gustav Maylahn mit Ehefrau Emma geb. Röttgen und Töchterchen Clara, die später die Ehefrau von Max Fischer in Hausdorp wurde. Daneben sind... Auf dem Foto im Maylahn-Hof von etwa 1912 sieht man – von links nach rechts – auf dem Pferd ein Knecht, dann Gustav Maylahn mit Ehefrau Emma geb. Röttgen und Töchterchen Clara, die später die Ehefrau von Max Fischer in Hausdorp wurde. Daneben sind die Eltern Franz Wilhelm Maylahn und Bertha geb. Lohmar. Gustav Maylahn war in den 1930er und 1940er Jahren Ortsvorsteher der Gemeinde Breidt, zu der Deesem gehörte. | |
|
1912
Ein bekannter Name in Deesem war Maylahn. Einige Generationen lang waren sie in diesem Dorf ansässig. Auf dem Bild ist das Ehepaar Franz Wilhelm Maylahn (geb. 1850) mit seiner Ehefrau Bertha geb. Lohmar (geb. 1855) in ihrer Wohnstube in Deesem etwa... Ein bekannter Name in Deesem war Maylahn. Einige Generationen lang waren sie in diesem Dorf ansässig. Auf dem Bild ist das Ehepaar Franz Wilhelm Maylahn (geb. 1850) mit seiner Ehefrau Bertha geb. Lohmar (geb. 1855) in ihrer Wohnstube in Deesem etwa 1895 fotografiert worden. | |
Das Foto ist ein Ausschnitt aus einem Klassenfoto mit Hauptlehrer Jakob Röttgen von etwa 1907. Jakob Röttgen wurde am 1.4.1892 als Lehrer an der Volksschule in Lohmar angestellt, 1911 nachträglich zum Hauptlehrer bestellt und am 1.4.1926 pensioniert. Das Foto ist ein Ausschnitt aus einem Klassenfoto mit Hauptlehrer Jakob Röttgen von etwa 1907. Jakob Röttgen wurde am 1.4.1892 als Lehrer an der Volksschule in Lohmar angestellt, 1911 nachträglich zum Hauptlehrer bestellt und am 1.4.1926 pensioniert. . | |
Nachdem sich die 1862 in Siegburg gegründete „Gesellschaft für wissenschaftliche Unterhaltung“ Ende 1886 aufgelöst hatte, bildete sich gut zwanzig Jahre danach in Lohmar am Freitag, dem 4. Januar 1907 „Die Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft –... Nachdem sich die 1862 in Siegburg gegründete „Gesellschaft für wissenschaftliche Unterhaltung“ Ende 1886 aufgelöst hatte, bildete sich gut zwanzig Jahre danach in Lohmar am Freitag, dem 4. Januar 1907 „Die Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft – Sempre avanti“ (immer voran). Das Aktenstück für die bürgermeisterliche und polizeiliche Genehmigung trägt die Geschäftsbereichs-Nr. 105 und liegt im Stadtarchiv von Lohmar. Des Weiteren befand sich im Stadtarchiv von Siegburg ein handgeschriebenes Büchlein der Gesellschaft, in dem eine Auflistung von zahlreichen Lohmarer Mundartwörter niedergeschrieben war. Leider ist dieses Büchlein heute nicht mehr auffindbar. Laut einer Glückwunschkarte vom 14.8.1903 an Prof. Prill vom Hollenberg hat die Gesellschaft um diese Zeit schon bestanden. Ihr gehörten u.a. Prof. Dr. Wilhelm Felten aus Siegburg und Prof. Joseph Prill an. Der Lohmarer Pfarrer Paul Düsterwald war lange Jahre Vorsitzender der Gesellschaft. Im Mai des Gründungsjahres 1907 entstand im Garten des Hauses Knipp (spätere Gaststätte „Margaretenhof“) das obige Foto mit den honorigen Mitgliedern dieser Gesellschaft: | |
|
1900
Die Familie Höndgesberg ist aus Deesem kommend gesichert ab 1837 in Lohmar ansässig. Die 3. Generation hat sich um 1900 in ihrem Hof auf der Kieselhöhe für dieses Foto aufgestellt. Jeweils von links nach rechts sieht man stehend 1. Peter (geb. 1880),... Die Familie Höndgesberg ist aus Deesem kommend gesichert ab 1837 in Lohmar ansässig. Die 3. Generation hat sich um 1900 in ihrem Hof auf der Kieselhöhe für dieses Foto aufgestellt. Jeweils von links nach rechts sieht man stehend 1. Peter (geb. 1880), 2. Johannes (geb. 1882), 3. Gertrud (geb. 1877), 4. Katharina (geb. 1885) und 5. Christina (geb. 1883); sitzend 1. Balthasar (geb. 1875), 2. Helene geb. Kemmerich (geb. 1845, Mutter) und Johann Peter Höndgesberg (geb. 1845, Vater). | |
|
1900
Das ist die wunderschöne fünfbogige steinerne Brücke zwischen Donrath und Sottenbach auf einem Foto, das um 1900 gemacht wurde. Sie ist von 1871 bis 1873 von dem Bauunternehmer Friedrich Wilhelm Sapp – aus dem Jabachhof in Lohmar – errichtet worden... Das ist die wunderschöne fünfbogige steinerne Brücke zwischen Donrath und Sottenbach auf einem Foto, das um 1900 gemacht wurde. Sie ist von 1871 bis 1873 von dem Bauunternehmer Friedrich Wilhelm Sapp – aus dem Jabachhof in Lohmar – errichtet worden und war infolge eines schadhaft gewordenen Pfeilers bei dem Hochwasser der Agger am 4.11.1940 zum Einsturz gekommen (Wilfriedo Becker, Donrath im Wandel der Zeiten, in: Festschrift zum 25-jährigen Bestehen der Marienkirche in Donrath am 4. Juli 1979). Das Hochwasser ist damals von einem unbekannten Schreiber in einem sogenannten „Lohmarer Brief!“ beschrieben worden. Diese Brücke war etwa 300 m aggeraufwärts der heutigen Brücke über die Agger und verband Donrath mit Sottenbach. Auch die Straßenführung war zu dieser Zeit etwas anders. Wenn man von Lohmar kommend auf die Sülztalstraße wollte, mußte man ein Stück nach Donrath hieinfahren, an der „Krockpaasch“ (Haus Weingarten, Donrather Straße 44) links abbiegen, über die Brücke nach Sottenbach fahren und gelangte in einem Bogen in Pützrath bei der heutigen Gaststätte „Flohberg“ auf die Sülztalstraße. | |
|
1899
Dieses Foto stammt aus dem Jahre 1899. Von rechts Theodor Kellershohn, Helene Panzer geb. Kellershohn, Johann-Theodor Kellershohn mit Kappe und Zigarre. Die Frau mit weißer Schürze ist unbekannt. Der Mann mit dem Fahrrad ist ein guter Gast des... Dieses Foto stammt aus dem Jahre 1899. Von rechts Theodor Kellershohn, Helene Panzer geb. Kellershohn, Johann-Theodor Kellershohn mit Kappe und Zigarre. Die Frau mit weißer Schürze ist unbekannt. Der Mann mit dem Fahrrad ist ein guter Gast des Hauses. Im Hintergrund: Zahlreiche Gäste, zum Teil mit Getränken, stellen sich dem Fotografen. | |
Am 2.12.1889 wurde die Schule in Ellhausen feierlich eingeweiht. Der erste Lehrer war Rudolf Heinrich Kray und blieb es bis er sich am 1.8.1903 an die Schule nach Styrum bei Mühlheim an der Ruhr versetzen ließ. Er heiratete am 14.9.1893 Elisabeth... Am 2.12.1889 wurde die Schule in Ellhausen feierlich eingeweiht. Der erste Lehrer war Rudolf Heinrich Kray und blieb es bis er sich am 1.8.1903 an die Schule nach Styrum bei Mühlheim an der Ruhr versetzen ließ. Er heiratete am 14.9.1893 Elisabeth Becker aus Donrath. 1895 hat er sich vor dem Schulgebäude mit seinen Schülern fotografieren lassen. Aus Patriotismus zu Kaiser und Vaterland hat er einigen Schülern Fahne, Trommel und Stöcke als Ersatz für Gewehre in die Hand gegeben. Jeweils von links nach rechts sieht man in der hinteren Reihe 1. Milla (Ludmilla) Kreuzer, Donrath, 2. Trienchen (Katharina) Eschbach, Ellhausen, 3. unbekannt, 4. Wilhelm Kellershohn, Geber, 5. Engelbert Becker, Broich (heute Donrath), 6. Lena (Helene) Weingarten, Donrath und 7. Lenchen (Helene) Mirbach; in der 2. Reihe 1. Heinrich Küpper, Ellhausen, 2. Willi Küpper, Ellhausen, 3. Fritz Weingarten, Donrath, 4. Hugo Becher, Donrath, 5. Wilhelm Bargon, Donrath, 6. Jean Bargon, Donrath, 7. und 8. unbekannt, 9. Degener?, Kreuzhäuschen und Lehrer Rudolf Kray; in der 3. Reihe 1. Josef Küpper (mit Trommel), 2. Hans Peter Küpper, Ellhausen, 3. Trautchen (Gertrud) Küpper, 4. Triene (Katharina) Scharrenbroich, Halberg, 5. Anna Kreuzer, Donrath, 6. Emma Pütz, 7. Anna Pütz, 8. Wilhelm Pütz und 9. unbekannt; in der vorderen Reihe 1. Wilhelm Zimmermann, Grimberg, 2. Goswin Zimmermann, Grimberg, 3. Hennes Becher, 4. Ursel Kreuzer?, Donrath, 5. Betty Kreuzer, Büchel (heute Donrath), 6. Trienchen (Katharina) Zimmermann, Grimberg, 7. Wilhelm Limbach, Grimberg, 8. Martin Eschbach, Ellhausen und Jopa (Johann Peter) Becker, Broich (heute Donrath). Siehe auch Bernhard Walterscheid-Müller, Die Schule Ellhausen-Donrath, Lohmar 1988, Seiten 24 und 100. | |
Der Haltepunkt Lohmar der Aggertalbahn (im Volksmund „et Lühmere Grietche“ genannt) mit Bahnhofsgebäude und beschranktem Bahnübergang Kirchstraße in den 1930er Jahren. Der Bahnhof Lohmar, nach dem Haltepunkt Driesch (Nordbahnhof), dem zweiten Halt... Der Haltepunkt Lohmar der Aggertalbahn (im Volksmund „et Lühmere Grietche“ genannt) mit Bahnhofsgebäude und beschranktem Bahnübergang Kirchstraße in den 1930er Jahren. Der Bahnhof Lohmar, nach dem Haltepunkt Driesch (Nordbahnhof), dem zweiten Halt der Bahn, war bereits umgebaut, d.h. der Dienstraum mit Stellwerk am Empfangsgebäude (Wartesaal) war als Vorbau erweitert worden. Im Hintergrund ist die Dienstwohnung des Bahnhofsvorstehers zu erkennen. Ersten Rationalisierungsmaßnahmen der DB, die auf drastische Einschränkungen im Streckennetz hinausliefen, fiel auch die Aggertalbahn, Strecke Siegburg – Overath, zum Opfer. Am 23. Mai 1954 fuhr der letzte Personenzug durch den Lohmarer Bahnhof. | |
Der Lebenslauf dieses Jahrhundertpfarrers ist folgender:
Der Lebenslauf dieses Jahrhundertpfarrers ist folgender:
Für Birk und Rommerskirchen liegen aus seiner Feder umfangreiche Pfarrchroniken vor, die das örtliche und gesamtkirchliche Leben, den Alltag und die politischen Entwicklungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausführlich beschreiben. Im Jubiläumsbuch des Männerchors Liederkranz Birk von 2008 wird Christian Heinrich Aumüller so charakterisiert: Dr. Aumüller war alles, ein gerechter und strenger Seelsorger, ein liebevoller Freund der Kinder und der Jugend, durch und durch Arzt, wenn es nötig war, besorgt um den Wohlstand seiner Gemeinde und die Zierde seiner Kirche, aber in Belangen seiner Pfarrgemeinde streitbar gegen Bürgermeister und Gemeinderäte, kurzum gegen alles allzu Preußische. | |
|
1899
- 1990 Die Aufnahme zeigt die erste feste Brücke über die Agger zwischen Lohmar und Altenrath, die 1899/1900 von der preußischen Militärverwaltung errichtet wurde. Die Brücke sollte die Truppenbewegungen zum Truppenübungsund damaligen Schießplatz Wahner... Die Aufnahme zeigt die erste feste Brücke über die Agger zwischen Lohmar und Altenrath, die 1899/1900 von der preußischen Militärverwaltung errichtet wurde. Die Brücke sollte die Truppenbewegungen zum Truppenübungsund damaligen Schießplatz Wahner Heide erleichtern. Die Form der Brücke ist eine Stahlbogenbrücke aus einem Flussbogen und einem Landbogen mit gebogenen kastenförmigen Ober- und geraden Untergurten, senkrechten und diagonalen Stabwerken, mit eingelegter Fahrbahn. Die Brückenkonstruktion ist mittig auf einem gemauerten Landpfeiler aufgelegt. Die Brückenköpfe sind mit Kies aufgefüllte Rampen, deren Fahrspur noch keine feste Oberschicht aufweist. Die Stahlkonstruktion der Brücke wurde von den Mannstaedt-Werken in Troisdorf, FriedrichWilhems-Hütte, gefertigt und durch deutsche Truppen am Ostersonntag, dem 1.4.1945 gesprengt. Mit dem Bau der Brücke war auch die Fähre überflüssig geworden und wurde an dieser Stelle eingestellt. | |
Diese Fotografie um die Jahrhundertwende zum 20. Jh., eine Ansicht vom späteren Breiter Weg aus Südwesten gesehen, der zunächst als Feldweg ins „Mühlenfeld“ angelegt war und dann als „Wiesenpfad“ rechts abbog und in nordwestlicher Richtung weiter... Diese Fotografie um die Jahrhundertwende zum 20. Jh., eine Ansicht vom späteren Breiter Weg aus Südwesten gesehen, der zunächst als Feldweg ins „Mühlenfeld“ angelegt war und dann als „Wiesenpfad“ rechts abbog und in nordwestlicher Richtung weiter lief. Die Verbindung mit der Altenrather Straße zum Kirchdorf gab es noch nicht. Das Dorf und sein Raum waren noch nach den Grundsätzen der alten Ordnung geformt und erhalten. Das Dorf war eine überschaubare Ansiedlung von einigen Fachwerkbauten im Unter-, Ober- und Kirchdorf, die Wohn- und Betriebszwecken dienten und deren Einwohner von der Landwirtschaft sowie in persönlich bewusster Gemeinschaft – geregelt durch das Nachbarrecht – lebten. Kurz vor und nach der Jahrhundertwende änderte sich das, da zog es Kölner Unternehmer, Fabrikanten, Geschäftsleute und höhere Beamte im Ruhestand nach Lohmar, die Besitzverhältnisse und damit auch die Bevölkerungszusammensetzung im Dorf veränderten sich. So baute der reiche Kölner Carl Niessen die Villa Friedlinde (nicht auf dem Bild zu sehen), der Oberpostinspektor i.R. August Wagner um die Jahrhundertwende die Villa „Waldfrieden“, die der Rektor Karl Schmidt später kaufte sowie die benachbarte Villa „Haus Mechthilde“ Hauptstraße 13, die der Lohmarer Fabrikant Johann Fischer später von Major a.D. Alfred vom Rath und seiner Ehefrau erwarb. Der Bruder von Carl Niessen, Arnold Niessen, errichtete das Gasthaus Josef Sapp, jetzige Schwamborn (der massive Baukörper in Bildmitte, rechts daneben ist das Wohnhaus von Carl Knipp). Im Vordergrund sind die Feldfluren „In der Flachshütte“ und „Am Wiesdenpfad“ zu sehen. Die Eisenbahntrasse der Aggertalbahn, die hinter den Häusern der rechten Straßenseite (von Donrath aus gesehen) und dann ab der Jabachsbrücke wieder parallel zur Hauptstraße verlief, kann man nur erahnen. Im Hintergrund ist der Ingerberg als bewaldeter Höhenrücken zu erkennen. Davor, gegenüber den anderen Häusern der Hauptstraße, etwas erhöht die „Villa Maruschka“ des Freiherrn von Linsingen, der später das Anwesen an Karl Maybaum und dieser 1923 an die Fassfabrik Wetter und Endrulat verkaufte. Von denen übernahmen die Schwestern des Ordens vom armen Kinde Jesu die Anlage Lohmarhöhe, deren Gebäudebestand sie erheblich ausbauten. Im Vordergrund sind die Fachwerkgehöfte von rechts nach links Peter Höndgesberg, später Milchgeschäft Barth, das Doppelhaus von Franz Scharrenbroich und Wilhelm Hasberg, heute Wolle- und Handarbeitsgeschäft Niedergesäss. | |
Der Görreshof oder auch Jörgeshof in Donrath, Donrather Straße 13, hat seinen Namen mit größter Wahrscheinlichkeit von Georg (Görres oder Jörres) Lohausen erhalten, der am 16.10.1780 Anna Margaretha Kleins heiratete und mit ihr wahrscheinlich diesen... Der Görreshof oder auch Jörgeshof in Donrath, Donrather Straße 13, hat seinen Namen mit größter Wahrscheinlichkeit von Georg (Görres oder Jörres) Lohausen erhalten, der am 16.10.1780 Anna Margaretha Kleins heiratete und mit ihr wahrscheinlich diesen Hof bewirtschaftete. Er hatte fünf Kinder, von denen das jüngste Anna Katharina (geb. 1795) hieß und am 1.2.1812 Johann Peter Klein (geb. 1789) heiratete. Dadurch wurde der Lohausen-Hof nach dem Tode von Georg Lohausen zu einem Klein-Hof. Johann Peter Kleins Sohn Johann Anton (geb. 1821) führte den Hof weiter. Er heiratete etwa 1858 Elisabeth Lang (geb. 1834) und hatte mit ihr drei Kinder. Die jüngste Tochter Margarethe heiratete am 16.7.1891 Peter Josef Böttner aus Halberg, wodurch der Klein-Hof zum Böttner-Hof wurde. Im Böttnerhof war von 1914 bis Ende 1923 die Postagentur für Donrath. Auf dem Foto, das um 1900 gemacht wurde, steht vor dem Haus die Tochter Elisabeth Böttner, die später Wilhelm Balensiefer heiratete. Im Fenster links ist Margarethe Böttner, geb. Klein und daneben ihre Mutter Elisabeth Klein, geb. Lang zu sehen. Links am Schleifstein arbeiten Bedienstete. Rechts sieht man eine typische Schlagkarre, wie man sie noch bis in die 1950er Jahre benutzte. | |
|
1900
Das Foto des Gasthofs und Pension „Altes Haus“ zeigt den ältesten Gasthof in Donrath um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts. Das gastronomische Gewerbe, erweitert um eine Kolonialwarenhandlung und einen Verkauf von „Zigarren en gros“ wurde... Das Foto des Gasthofs und Pension „Altes Haus“ zeigt den ältesten Gasthof in Donrath um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts. Das gastronomische Gewerbe, erweitert um eine Kolonialwarenhandlung und einen Verkauf von „Zigarren en gros“ wurde von Heinrich Kreuzer geführt. Dieser hatte die Konzession, eine Gast- und Schankwirtschaft im Hause Nr. 11 in Donrath zu führen am 6.11.1886 erhalten. Der Vater von Fritz und Heinrich Kreuzer, Ackerer und Wirt, ist bereits 1851 im „Alten Haus“ urkundlich genannt. Er war lange Jahre bis 1874 Ortsvorsteher von Donrath. In diesen Gasthöfen kehrten nicht nur die Fuhrleute ein, sondern auch zechende Gäste und Sommerfrischler. Hier vollzog sich das gesellige und kulturelle Leben, wurde Theater gespielt, gekegelt, getanzt und auf der Agger in der Waldpartie in der Dornhecke, „der Donrather Schweiz“, Kahn gefahren und gebadet. | |
Oberschönrath liegt im Nordwesten von Lohmar an der gemeinsamen Gemeindegrenze mit Rösrath. Umliegende Ortschaften und Weiler sind Fußheide im Norden, Großenhecken und Kleinhecken im Nordosten, Knipscherhof im Osten, Burg Schönrath im Südosten,... Oberschönrath liegt im Nordwesten von Lohmar an der gemeinsamen Gemeindegrenze mit Rösrath. Umliegende Ortschaften und Weiler sind Fußheide im Norden, Großenhecken und Kleinhecken im Nordosten, Knipscherhof im Osten, Burg Schönrath im Südosten, Rodderhof im Süden sowie Georgshof im Nordwesten bis Westen. Die ehemalige Gastwirtschaft „Zum Häuschen“ und der Ort Oberschönrath liegen an der Schönrather Straße, der heutigen Kreisstraße K 39. Die Ansichtskarte von der „Gastwirtschaft zum Häuschen“ Anfang des 20. Jahrhunderts aufgenommen, zeigt die Sonnenterrasse der Südwestseite des Fachwerkbaus. Ob man die geschätzten fast 300 Jahre Baudatum auch auf das Wohnhaus übertragen darf, ist fraglich. Dachform und die Entwicklung des Stockwerkbaus gehen in Lohmar eher auf Anfang des 19. bzw. Ende des 18. Jahrhunderts zurück. Links vom Wohnhaus sieht man einen pferdebespannten Wagen. Das Gebäude war früher zeitweise Poststation. Heinrich Lohmar hat 1896 die Erlaubnis ausgestellt bekommen, in Oberschönrath eine Gast- und Schankwirtschaft zu betreiben. Noch in jüngerer Zeit war es ein beliebtes Ausflugs- und Speiselokal mit Tennisplätzen, nicht nur für Lohmarer oder Rösrather, sondern auch für manche Kölner Gäste. Dann war das Hotel und Restaurant „Zum Häuschen“ eine Zeit lang geschlossen und als Hotel und Restaurant „Zum Hähnchen Häuschen“ wieder eröffnet worden und wird jetzt (2020) als Landgasthof "Zum Häuschen " geführt. | |
Auf dem Foto um 1900 erntet Peter Josef Böttner Getreide auf seinem Feld im Donrather Dreieck. Die Familie Böttner in Donrath war eine sehr wohlhabende Familie, was man auch daran erkennen kann, dass Peter Josef um diese Zeit schon mit einer... Auf dem Foto um 1900 erntet Peter Josef Böttner Getreide auf seinem Feld im Donrather Dreieck. Die Familie Böttner in Donrath war eine sehr wohlhabende Familie, was man auch daran erkennen kann, dass Peter Josef um diese Zeit schon mit einer Mähmaschine arbeitet – noch bis in die Mitte der 1930er Jahre hinein war es üblich, von Hand mit der Sense zu mähen. Er geht hinter den Pferden her und lenkt die Mähmaschine, während sein Knecht die Pferde führt. Die hinteren drei Frauen sind Mägde, die das Mähgut zusammenbinden und – hier nicht sichtbar – zu „Koenhuster“ (Kornhäuser) zusammenstellen. Im Vordergrund von links nach rechts sitzen: unbekannt, Elisabeth Böttner, später verh. Balensiefer, Katharina Böttner (ehelos geblieben) und drei Kinder, wahrscheinlich von den Mägden. Die beiden Böttnerkinder in den weißen Kleidchen haben Strohhüte auf, um die Blässe im Gesicht der Wohlhabenden zu erhalten. Sie brauchten auch sicherlich nicht den Mägden beim Aufsammeln der Ähren zu helfen. | |
|
1900
Auf dieser Mehrbildkarte im Lithographieverfahren um 1900 ist im Medaillon links das Forsthaus Telegraf zu sehen, wobei die ehemalige Bedeutung des Hauses durch die Bezeichnung „Forsthaus Telegraf“ unterstrichen wird. Auf dieser Mehrbildkarte im Lithographieverfahren um 1900 ist im Medaillon links das Forsthaus Telegraf zu sehen, wobei die ehemalige Bedeutung des Hauses durch die Bezeichnung „Forsthaus Telegraf“ unterstrichen wird. | |
Auf dem Foto ist die Familie Böttner aus dem Görreshof, auch Jörgeshof – heute Böttnerhof – in Donrath vor 1897 zu sehen. Auf dem Foto ist die Familie Böttner aus dem Görreshof, auch Jörgeshof – heute Böttnerhof – in Donrath vor 1897 zu sehen. | |
Etwa 1904 hat sich Johann Josef Hagen aus Lohmar mit seiner Familie gegenüber seinem Grundstück in der Gartenstraße fotografieren lassen. Von links nach rechts sieht man: Etwa 1904 hat sich Johann Josef Hagen aus Lohmar mit seiner Familie gegenüber seinem Grundstück in der Gartenstraße fotografieren lassen. Von links nach rechts sieht man: Die Familie Hagen ist eine alte Lohmarer Familie und mit anderen bekannten Lohmarer Familien verwandt. Der Name taucht schon ab 1700 in den Lohmarer Kirchenbüchern auf. | |
Heinrich Heidhues, geboren am 11. April 1865 in Köln, war von 1907 bis zu seinem Tod am 5. April 1913 Pfarrer in Birk. Hier ist er auf einer Grußansicht in der offenen Tür der ehemaligen Vikarie am Pfaffendriesch abgebildet. Neben ihm liegt sein... Heinrich Heidhues, geboren am 11. April 1865 in Köln, war von 1907 bis zu seinem Tod am 5. April 1913 Pfarrer in Birk. Hier ist er auf einer Grußansicht in der offenen Tür der ehemaligen Vikarie am Pfaffendriesch abgebildet. Neben ihm liegt sein Bernhardinerhund, dessen Name den Eltern noch geläufig war und dessen Heulen durch ganz Birk zu hören gewesen sei. Neben dieser Karte ließ Heinrich Heidhues zwei weitere Ansichtskarten vom Siegburger Fotografen Eduard Dickopf fertigen, nämlich vom Inneren der Pfarrkirche (siehe Lohmar in alten Zeiten Bd. I, S. 42) und vom Gnadenbild der Schmerzhaften Muttergottes. Pfarrer Heinrich Heidhues, der nur knapp 48 Jahre alt wurde, war ein vielseitig interessierter und impulsiver Seelsorger, der zudem sehr auf die Hebung der Wirtschaftskraft seiner Gemeinde bedacht war. Er setzte sich nämlich engagiert für das damalige Projekt einer Zeithstraßen-Bahn ein. Als Kunstkenner und -sammler war er unter Fachleuten geschätzt. Einige wenige mittelalterliche Gemälde seiner Sammlung befinden sich im Kolumba-Museum des Erzbistums Köln.
| |
Die Erlaubnis, eine Gast und Schankwirtschaft im Hause Nr. 5 in Geber zu betreiben, wurde dem Betreiberunternehmer Thedor Kellershohn vom Landrat am 2. August 1907 erteilt. Am 18.11.1920 übernimmt Wilhelm Pütz die Gastwirtschaft in Geber. Er ist im... Die Erlaubnis, eine Gast und Schankwirtschaft im Hause Nr. 5 in Geber zu betreiben, wurde dem Betreiberunternehmer Thedor Kellershohn vom Landrat am 2. August 1907 erteilt. Am 18.11.1920 übernimmt Wilhelm Pütz die Gastwirtschaft in Geber. Er ist im Verzeichnis der Gastwirtschaften, Schankwirtschaften und Kleinhandlungen mit Branntwein und Spiritus des Bürgermeisters von Lohmar unter AZ. 4905 vermerkt. | |
|
1910
Im linken Bildausschnitt auf dieser Mehrbildkarte ist oben die Gastwirtschaft „Zur Linde“, Ecke Kirch- und Hauptstraße, die in den 80er Jahren des neunzehnten Jahrhunderts von Peter Josef Knipp (genannt „Pettejösep“ oder auch „Petternösel“) gebaut... Im linken Bildausschnitt auf dieser Mehrbildkarte ist oben die Gastwirtschaft „Zur Linde“, Ecke Kirch- und Hauptstraße, die in den 80er Jahren des neunzehnten Jahrhunderts von Peter Josef Knipp (genannt „Pettejösep“ oder auch „Petternösel“) gebaut wurde. Peter Josef Knipp bekam am 27.6.1881 die Erlaubnis erteilt, in seinem Hause Nr. 154 in Lohmar (das Dorf war durchlaufend nummeriert) eine Gast- und Schankwirtschaft zu betreiben. Ludwig Knipp hat ab 12.8.1914 die Konzession übertragen bekommen, im Haus 142 nach der neuen HausnummerListe (alte Nr. 154) die Gast- und Schankwirtschaft zu betreiben. | |
|
1912
Johann Josef Dunkel und seine Ehefrau Anna Maria, geb. Kemmerich hatten sieben Söhne und vier Töchter. Etwa 1912 haben sich die Eltern mit ihren Söhnen, die alle beim Militär waren, fotografi eren lassen. Damals war man sehr patriotisch eingestellt,... Johann Josef Dunkel und seine Ehefrau Anna Maria, geb. Kemmerich hatten sieben Söhne und vier Töchter. Etwa 1912 haben sich die Eltern mit ihren Söhnen, die alle beim Militär waren, fotografi eren lassen. Damals war man sehr patriotisch eingestellt, aber sieben Soldaten aus einer Familie war auch zu dieser Zeit eine Seltenheit. Eine Schar Söhne, die natürlich dem Kaiser zu dienen hatte, war der ganze Stolz einer Familie. Die Barttracht Kaiser Wilhelms II. war, wie auch auf dem Foto, Vorbild für viele jungen Leute. Der damalige Bürgermeister Ludwig Polstorff hat in seiner „Chronik der Landbürgermeisterei Lohmar“ auf Seite 111 vermerkt, dass der „Kameradschaftlicher Verein Lohmar“ seiner Majestät dem Kaiser einen Abzug von diesem Foto geschickt habe und daraufhin dem Johann Josef Dunkel im August 1912 das Allgemeine Ehrenzeichen in Silber verliehen wurde. Damals wurden die jungen Männer in der Regel mit zwanzig Jahren für zwei Jahre eingezogen. Danach erfolgten Reserveübungen von vier Wochen und ab dem 30. Lebensjahr Landwehrübungen von vierzehn Tagen. (Quelle: Wolfgang Schafhaus, Lohmar in alten Ansichten, Zaltbommel/Niederlande 1977, Bild 24.) | |
Das Foto zeigt als zweites Haus der alten Scheiderstraße von links das giebel- und traufeständige Haus Nr. 4 des Gasthofes Heinrich Weeg mit Saal (später Faßbender) vor rund 100 Jahren. Rechts das queraufgeschlossene Haus ist das alte Schul- und... Das Foto zeigt als zweites Haus der alten Scheiderstraße von links das giebel- und traufeständige Haus Nr. 4 des Gasthofes Heinrich Weeg mit Saal (später Faßbender) vor rund 100 Jahren. Rechts das queraufgeschlossene Haus ist das alte Schul- und Küsterhaus. Darüber hinaus schaut die Laterne des Glockenturms der Pfarrkapelle „Heilig Kreuz“ hervor. Die neue, weit ins bergische Land, in die Aggerebene schauende Pfarrkirche von 1913, war noch nicht erbaut. Auf dem freien Feld vor dem Schulbau ist die Firma ABS-Pumpen errichtet worden. | |
|
7. Juli 1913
Am 7.7.1913 hat sich Maria Eimermacher, geb. Brungs, die Großmutter unseres Autors Hans Heinz Eimermacher, mit ihren Kindern auf der Hardt in Lohmar fotografieren lassen. Von links nach rechts sind zu sehen: Am 7.7.1913 hat sich Maria Eimermacher, geb. Brungs, die Großmutter unseres Autors Hans Heinz Eimermacher, mit ihren Kindern auf der Hardt in Lohmar fotografieren lassen. Von links nach rechts sind zu sehen: | |
|
1913
Rechts der Agger, auf dem Bergrücken oberhalb von Windlöck, sehen wir die evangelische Pfarrkirche von Honrath, früher auch Alt Honrath genannt. Die Kirche, die früher katholisch und der Hl. Margaretha geweiht war, gegen Ende des 17. Jahrhunderts... Rechts der Agger, auf dem Bergrücken oberhalb von Windlöck, sehen wir die evangelische Pfarrkirche von Honrath, früher auch Alt Honrath genannt. Die Kirche, die früher katholisch und der Hl. Margaretha geweiht war, gegen Ende des 17. Jahrhunderts aber evangelisch wurde, wird urkundlich erstmals 1209 genannt, als Graf Arnold von Hückeswagen dem Frauenkloster Gräfrath bei Solingen die Honrather Kirche samt dem Patronat, d.h. die Unterhaltung der Kirche, übergab. Ausgenommen davon war die Burg Honrath, die unmittelbar im Westen an den Turm der Kirche anschloss. Diese ging 1259 an die Grafen von Sayn zu Blankenberg über. In den 1960er Jahren wurde das Bruchsteinmauerwerk saniert und durch einen weißen Putz und Anstrich gesichert. Heute bietet die Evangelische Kirchengemeinde in der Honrather Kirche, mit ihrer herausragenden Akustik – außer ihrer vornehmlichsten Aufgabe der Seelsorge – im Laufe des Jahres hervorragende Kirchenkonzerte der unterschiedlichsten Art in sehr guter Qualität an. Auf der Ansichtskarte von Alt Honrath ist die Kirche von Norden – die Burg ist von der Baumgruppe verdeckt – und die „Restauration zur schönen Aussicht“ von Robert Otto zu sehen, in dem Zustand um 1913 als Putzbau. Spätere Ansichten zeigen im 1. OG der Gaststätte aufgeblendetes Fachwerk. Heute sind hier Künstler-Wohnungen angelegt. Im Vordergrund sieht man eine Personengruppe beim Rübenhacken, die dabei sind, die Knollen (Zuckerrüben) von Unkraut zu befreien, natürlich von Hand, das war eine mühselige Arbeit. | |
|
Rund 500 Jahre steht nun schon das einst adelige Haus Dorp auf dem Höhenrücken zwischen Naafbach- und Aggertal. Durch die Heirat der Tochter Heinrichs von Markelsbach, Sibylla, geboren 1550, mit Wilhelm von Gülich zu Berg (Mechernich) vor Floisdorf,... Rund 500 Jahre steht nun schon das einst adelige Haus Dorp auf dem Höhenrücken zwischen Naafbach- und Aggertal. Durch die Heirat der Tochter Heinrichs von Markelsbach, Sibylla, geboren 1550, mit Wilhelm von Gülich zu Berg (Mechernich) vor Floisdorf, um 1566, wurde das Haus Dorp mit den reformatorischen Grundgedanken der lutherischen Lehre konfrontiert. Von Gülich war dem Kalvinismus zugetan. Erhalten ist heute das zweigeschossige Herrenhaus (16.-17. Jahrhundert) mit mächtigem, noch gotisch anklingendem Dachgeschoss. Die baugeschichtliche Datierung des Herrenhauses geht in das 16. Jahrhundert zurück, wobei die urkundliche Ersterwähnung des Freiguts Haus Dorp bereits wesentlich weiter, in das 14. bis 15. Jahrhundert, zurückreicht. Die umgebenden Wirtschaftsgebäude stammen aus neuerer Zeit. Das oben angeführte zweigeschossige Herrenhaus Dorp, in seiner typischen Mischbauweise (Bruchstein-Fachwerkbau), ist als Baudenkmal Nr. 12 in die Denkmalliste der Stadt Lohmar eingetragen. | |
|
1914
Die Bachermühle, die schon früh im Eigentum des Rittergutes Schloss Auel stand, wurde Mitte des 17. Jahrhunderts erstmals urkundlich erwähnt. Die heute erhaltene Bausubstanz, das zweigeschossige Mühlengebäude, ist jedoch wesentlich jünger (um 1800).... Die Bachermühle, die schon früh im Eigentum des Rittergutes Schloss Auel stand, wurde Mitte des 17. Jahrhunderts erstmals urkundlich erwähnt. Die heute erhaltene Bausubstanz, das zweigeschossige Mühlengebäude, ist jedoch wesentlich jünger (um 1800). Die Wasser-Kornmühle, unterhalb des Kammerbergs am rechten Aggerufer, erhielt das Wasser für den Betrieb der Mühle mittels eines Obergrabens als Abzweig der angeströmten Fläche des Honsbacher Wehres (sog. Oberwasser) aus der Agger. | |
Im zweigeteilten Panoramabild ist oben die Gaststätte mit der Ev. Kirche Honrath und unten der Blick von Honrath in das Aggertal aufgenommen. Die Aufnahme entstand ca. 1915. Man erkennt zwischen Provinzialstraße und Agger die Aggerhütte. Im zweigeteilten Panoramabild ist oben die Gaststätte mit der Ev. Kirche Honrath und unten der Blick von Honrath in das Aggertal aufgenommen. Die Aufnahme entstand ca. 1915. Man erkennt zwischen Provinzialstraße und Agger die Aggerhütte. | |
|
1915
Das Gut Zimmermann ist der bekannteste und sicherlich auch der größte Hof in Grimberg. Dieses Anwesen war wahrscheinlich ursprünglich ein Mybach-Hof gewesen, in den Johann Theodor Zimmermann 1774 hineingeheiratet hatte. Auf dem Foto von etwa 1915... Das Gut Zimmermann ist der bekannteste und sicherlich auch der größte Hof in Grimberg. Dieses Anwesen war wahrscheinlich ursprünglich ein Mybach-Hof gewesen, in den Johann Theodor Zimmermann 1774 hineingeheiratet hatte. Auf dem Foto von etwa 1915 sind vor dem Haus (dort wo heute in Grimberg der Kreisel ist) von links nach rechts Anna Maria Lückeroth, geb. Zimmermann; Katharina Pohl, geb. Zimmermann; Johann Zimmermann; russischer Zwangsarbeiter; Christina Zimmermann, geb. Hoscheid; Goswin Zimmermann; am Pferd Josef Zimmermann und Wilhelm Zimmermann zu sehen. | |
|
1915
- 1920 Ein Blick in die Vergangenheit – auf dem Foto um 1915/20 ist der Weiler Pützrath, ein Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Scheiderhöhe zu sehen. Auf dem Bild ist der Hof der Familie Josef Herkenrath sowie ganz rechts die Gast- und Schankwirtschaft von... Ein Blick in die Vergangenheit – auf dem Foto um 1915/20 ist der Weiler Pützrath, ein Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Scheiderhöhe zu sehen. Auf dem Bild ist der Hof der Familie Josef Herkenrath sowie ganz rechts die Gast- und Schankwirtschaft von Johann und Elisabeth Paffrath, der spätere „Flohberg“ zu erkennen. Direkt hinter dem Hof und dem neueren Stallgebäude, ganz links, befand sich ein Obstbungert mit einer sogenannten Kälberwiese. Im Vordergrund sieht man Anna Gertrud Herkenrath, geb. Hoeck, mit einer grasenden Kuh, dahinter ihr Mann, Josef Herkenrath, dann versetzt ihre jüngste Tochter Gertrud, 1903 geboren, zwei Brüder und die ältere Tochter. Der Vater von Josef Herkenrath, 1858 geb., hatte bereits vorher den Hof bewirtschaftet. Heute ist dort die Sülztalsauna, Pützrather Weg 2, angesiedelt.
| |
Zeltlager der englischen Besatzungssoldaten um 1919 an der Donrather Agger bei Pützrath. Einer der Soldaten schrieb seine Adresse auf die Rückseite der Karte: Charles Alfred Hill, 3 Dany Sorrace, Bells Hill, High Baret, London, England; ein anderer... Zeltlager der englischen Besatzungssoldaten um 1919 an der Donrather Agger bei Pützrath. Einer der Soldaten schrieb seine Adresse auf die Rückseite der Karte: Charles Alfred Hill, 3 Dany Sorrace, Bells Hill, High Baret, London, England; ein anderer seine: George Albert Hall, 31 Church Rd, Lower Murston, Sittingbourne, Kent, England. Abgeschickt wurde die Karte allerdings nie, da Grüße oder ein sonstiger Text in Gänze fehlen. | |
|
1919
Sieben Jahre lang hielten die alliierten Besatzungssoldaten nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg Lohmar z.T. im Waldlager Lohmar, aber auch in Privatquartieren oder Zeltlagern in den umliegenden Orten, u.a. in Altenrath, besetzt. Zunächst kamen... Sieben Jahre lang hielten die alliierten Besatzungssoldaten nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg Lohmar z.T. im Waldlager Lohmar, aber auch in Privatquartieren oder Zeltlagern in den umliegenden Orten, u.a. in Altenrath, besetzt. Zunächst kamen Inder, danach Kanadier und dann zogen Briten, wie hier auf dem Bild der heutigen Flughafenstraße im Kirchdorf Altenrath um 1919 zu sehen, ein. Durch die Einquartierung englischer Besatzungssoldaten in den Schulsälen musste der Unterricht vom 16. April bis 6. Mai 1919 unterbrochen werden. Am 6. August 1921 belegten französische Truppen sowie Marokkaner Lohmar, Scheiderhöhe und Altenrath für ihre Manöver in der Wahner Heide. Am 20. Januar 1926 verließen die letzten Besatzungstruppen das Gemeindegebiet von Lohmar und Altenrath. | |
Um 1920 stehen auf der „Alte Lohmarer Straße“ in Höhe des Hauses Henseler (Alte Lohmarer Str. 46) drei alte Frauen in ihrer typischen Alltagskleidung. Von links nach rechts sind das Anna Maria Haas (geb. 1863), Anna Maria Lohr (geb. 1857) und Anna... Um 1920 stehen auf der „Alte Lohmarer Straße“ in Höhe des Hauses Henseler (Alte Lohmarer Str. 46) drei alte Frauen in ihrer typischen Alltagskleidung. Von links nach rechts sind das Anna Maria Haas (geb. 1863), Anna Maria Lohr (geb. 1857) und Anna Margarethe Hagen (geb. 1853, Oma von Hubert Hagen in der Gartenstraße). Alle drei haben ein Tuch über dem linken Arm hängen. Mit solchen Tüchern gingen zur damaligen Zeit die Frauen in den Wald, um darin „Streu“ (Laub, verdorrtes Farn, Gras usw.) für das Vieh zu sammeln. Das wurde dann zusammengebunden und auf dem Kopf nach Hause getragen. | |
Auf dem Bild Anfang der 1920er Jahre sind mehrere Fischweiher im ehemaligen Lohmarer Markenwald abgebildet. Auf dem Bild Anfang der 1920er Jahre sind mehrere Fischweiher im ehemaligen Lohmarer Markenwald abgebildet. | |
|
1920
- 1929 Die Fotografie, von dem noch nicht befestigten Weg zur Aggerbrücke herunter, aus den 1920er Jahren zeigt die Südostansicht des zweigeschossigen Burghauses, um 1350 gebaut und grundlegend in den Jahren 1573-1583 umgebaut, mit einem seitlichen... Die Fotografie, von dem noch nicht befestigten Weg zur Aggerbrücke herunter, aus den 1920er Jahren zeigt die Südostansicht des zweigeschossigen Burghauses, um 1350 gebaut und grundlegend in den Jahren 1573-1583 umgebaut, mit einem seitlichen Anschnitt der Vorburg (1717) und dem trockengefallenen Wassergraben. Der Graben rechts von der Zufahrt zur Burg ist zugeschüttet. Über die abwechslungsreiche Geschichte der Burg Lohmar ist schon viel berichtet worden, zuletzt von Heinrich Hennekeuser in den Lohmarer Heimatblättern, Heft 22, Nov. 2008, Seiten 19-36. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts ist das Burghaus, im Wege der Erbauseinandersetzung geteilt worden. Johann Altenhofen übernahm den Burgbesitz als alleiniger Besitzer. 1875 wurde der Besitz geteilt. Die linke Hälfte der Burg blieb bei den Altenhofens und der rechte Burgteil wurde von der Familie Biesenbach erworben. Von diesen beiden Familien bzw. deren Nachkommen ging die Burg an die heutigen Besitzer über, die Landwirte Schultes und Wasser. Heinrich Wassers Tochter heiratete den Landwirt Joseph Braschoß, die Eheleute bewohnten den rechten Teil und bewirtschafteten diesen als landwirtschaftlichen Betrieb. Die älteste Tochter Pauline Altenhofen heiratete Wilhelm Schultes, die später den linken Teil an ihren Sohn Karl vermachten und dieser den Betrieb landwirtschaftlich nutzte.
| |
|
1920
Das „Kreuelsfeld“, in den Urflurkarten von 1823 noch „Greilsfeld“ oder „Greuelsfeld“ genannt, lag zwischen den heutigen Straßenzügen „Im Korresgarten“, „Christianstraße“ und „Auf der Hardt“, direkt am Waldrand. Das Bestimmungswort des Flur- oder... Das „Kreuelsfeld“, in den Urflurkarten von 1823 noch „Greilsfeld“ oder „Greuelsfeld“ genannt, lag zwischen den heutigen Straßenzügen „Im Korresgarten“, „Christianstraße“ und „Auf der Hardt“, direkt am Waldrand. Das Bestimmungswort des Flur- oder Gewannennamens: „Kreuel“, „Greuel“ (auch Grel und Greil) mag von einem abgelegenen, einsamen Ort, dort wo man Grauen empfindet, an dem es nicht geheuer ist, abgeleitet sein. Damals wie heute gab es Stellen, vor allem im Wald, die gefürchtet und gemieden wurden. Oberhalb der Hardt gab es noch die Gewannenbezeichnungen „Greilsbusch“, „Greilsberg“ und „Auf dem Greil“. Sie alle liegen vor der zum Teil heute bereits gefällten Waldkulisse oberhalb der Waldschule, auf einem der schönsten Hänge der Walderbenmark mit einem Ausblick auf die Kirche und das Dorf. Rechts auf dem Foto, ab dem Stacheldrahtzaun, ist die Miebachs Wiese zu erkennen. | |
|
1920
- 1929 Das Bild aus den 1920er Jahren zeigt die Kirchstraße mit Kirchdorf von der Burg aus gesehen, rechts Haus Müller, dann Nebengebäude des Pützerhofes, links der Pfarrgarten mit Obstwiese. Wie das Foto noch zeigt, kann man besonders gut die einst... Das Bild aus den 1920er Jahren zeigt die Kirchstraße mit Kirchdorf von der Burg aus gesehen, rechts Haus Müller, dann Nebengebäude des Pützerhofes, links der Pfarrgarten mit Obstwiese. Wie das Foto noch zeigt, kann man besonders gut die einst direkte, axiale Verbindung der Burg mit dem Kirchdorf Lohmar erkennen, die seit dem Bau der Reichsautobahn Köln – Frankfurt Mitte der 1930er Jahre brutal zerschnitten ist. Neben dem Kirchdorf nannte das Nachbarrecht von 1767 zwei weitere Ortsteile für das Dorf Lohmar, das Ober- und das Unterdorf mit rund 160 Seelen in etwa 50 Häusern. Im Kirchdorf befanden sich um 1700 neben der Pfarrkirche und dem Pastorat (Wiedenhof), das Küster- und Schulhaus, das Fährhaus (wurde später, etwa 1850 erbaut), die Burg, der Bachhof, der Pützerhof, der Neuhof und der Fronhof. Im Verlauf des 18. Jahrhunderts fand dort eine rege Bautätigkeit statt. Das Küsterhaus mit der Schule wie auch andere Pastoratsgebäude wurden 1744, da der bauliche Zustand sehr zu Wünschen übrig ließ, vor allem zugunsten der Errichtung eines neuen Pfarrhauses, das wir links im Bild sehen, geschliffen. An der Finanzierung beteiligten sich alle Bewohner des Kirchspiels und auch die freien Höfe.
| |
Die Post, gelegen an der Zeithstraße, hatte über einige Jahrzehnte eine große Bedeutung. Sie war Post, Haltestelle für die Busse in Richtung Siegburg, Neunkirchen und Seelscheid/Much und letztlich auch Gaststätte. Uns Kindern war in den 40er und 50er... Die Post, gelegen an der Zeithstraße, hatte über einige Jahrzehnte eine große Bedeutung. Sie war Post, Haltestelle für die Busse in Richtung Siegburg, Neunkirchen und Seelscheid/Much und letztlich auch Gaststätte. Uns Kindern war in den 40er und 50er Jahren Peter Weber bekannt in erster Linie als gutgelaunter Postbeamter. Wir bewunderten ihn, mit welchem Geschick er mit nur einem Arm, die Briefe und Karten stempelte oder Monatskarten ausstellte. In den späteren Jahren, als wir Gäste in seiner Gaststätte waren, zapfte er gut gelaunt mit spaßigen Sprüchen das Bier. | |
Das Haus des Tapetengeschäfts Zimmermann wurde vor 1895 von Ferdinand Esser aus Köln gebaut. Heute ist diese feingliederige Eingangspartie mit Erker und Spitzgiebel, wie er auf dem Foto zu sehen ist, durch im Laufe der Zeit erfolgte... Das Haus des Tapetengeschäfts Zimmermann wurde vor 1895 von Ferdinand Esser aus Köln gebaut. Heute ist diese feingliederige Eingangspartie mit Erker und Spitzgiebel, wie er auf dem Foto zu sehen ist, durch im Laufe der Zeit erfolgte Modernisierungsarbeiten so nicht mehr vorhanden. | |
|
1925
Auf dem Foto von etwa 1925 ist die Gebermühle – eine Wasserkornmühle – noch an ihrer alten Stelle in der Bachaue zwischen Jabachtalstraße und Jabach zu sehen. Auf dem Foto von etwa 1925 ist die Gebermühle – eine Wasserkornmühle – noch an ihrer alten Stelle in der Bachaue zwischen Jabachtalstraße und Jabach zu sehen. | |
|
1920
- 1929 Wie viele Lohmarer verdienten die auf der Fotografie abgebildeten „Waldarbeiter“ (Kleinstunternehmer) beim Abtransport von Stammholz ihr Geld. Die Bäume wurden seinerzeit von Hand mit Trummsägen gefällt, mit Äxten entastet und die Wurzelstöcke mit... Wie viele Lohmarer verdienten die auf der Fotografie abgebildeten „Waldarbeiter“ (Kleinstunternehmer) beim Abtransport von Stammholz ihr Geld. Die Bäume wurden seinerzeit von Hand mit Trummsägen gefällt, mit Äxten entastet und die Wurzelstöcke mit Platthacken gerodet und danach verbrannt. Mit Rückpferden – so bezeichnet man Pferde, die zum Holzrücken, also zum Transport im Wald gefällter und entasteter Baumstämme zum nächsten befahrbaren Weg verwendet werden – wurden die gefällten Stämme mittels Stahlketten über eine „schiefe Ebene“ aus Holz und unter Zuhilfenahme von Winden auf den Pferdewagen gezogen. Auf dem Bild sieht man die Wolfseiche, die im Mündungsbereich der Sülz stand. Noch heute gibt es im RSB-Gebiet einen Flur- und Straßennamen der „In den Wolfseichen“ heißt. | |
|
1925
- 1930 Das Foto um 1925/30 zeigt eine Teilansicht des alten Lohmars von Südosten, dem späteren Straßenzug der Hardt aus gesehen, der noch weitgehendst unbebaut ist. Links Haus Krauthäuser, rechts davon mit dem Krüppelwalmdach das Haus Katterfeld. Davor das... Das Foto um 1925/30 zeigt eine Teilansicht des alten Lohmars von Südosten, dem späteren Straßenzug der Hardt aus gesehen, der noch weitgehendst unbebaut ist. Links Haus Krauthäuser, rechts davon mit dem Krüppelwalmdach das Haus Katterfeld. Davor das Fachwerkhaus Dunkel/Palm. Rechts im Vordergrund die Werkstatt von Josef Dunkel, im Hintergrund die Villa Therese und in Bildmitte Haus Klette (später Fam. Brode, Im Korresgarten). Zwischen diesem und dem hohen Haus rechts davon die Waldesruh auf der Hauptstraße, weiter rechts davon im Baumbestand die Villa Baumann (Villa Friedlinde, Bachstraße 12), dahinter die katholische Pfarrkirche mit dem Ziegenberg und links davon die Burg mit dem Lohmarberg im Hintergrund. | |
|
1930
Die Fotografie der Einmündung Kirchstraße/Hauptstraße – die Provinzialstraße ist 1929 bereits gepflastert – zeigt im rechten Bildausschnitt das um 1896 von Johann Hermanns errichtete „Hotel Restaurant zum Aggertal“ – später Gaststätte Johann... Die Fotografie der Einmündung Kirchstraße/Hauptstraße – die Provinzialstraße ist 1929 bereits gepflastert – zeigt im rechten Bildausschnitt das um 1896 von Johann Hermanns errichtete „Hotel Restaurant zum Aggertal“ – später Gaststätte Johann Schnitzler – und links im Vordergrund gegenüber die Gastwirtschaft bzw. das Hotel zur Linde von Peter Josef Knipp. Zu sehen ist links hinter dem späteren Saal der Linde die Dachfläche des Bahnhofsvorstehergebäudes und der anschließende Bahnhof und Schule um 1930. | |
|
1920
- 1939 Das vor dem Bau der Autobahn Köln – Frankfurt entstandene Foto der Burg und des Kirchdorfs von Lohmar ,vom Ziegenberg herunter fotografiert, zeigt die Burg mit Vorburg in den 1920/1930er Jahren. Im Vordergrund und in der Bildmitte rechts das... Das vor dem Bau der Autobahn Köln – Frankfurt entstandene Foto der Burg und des Kirchdorfs von Lohmar ,vom Ziegenberg herunter fotografiert, zeigt die Burg mit Vorburg in den 1920/1930er Jahren. Im Vordergrund und in der Bildmitte rechts das Kirchdorf mit dem Fachwerkhaus des Troisdorfer Fabrikanten Müller, das Krüppelwalmdach des Pützerhofes mit giebelständiger Scheune, von Lehrer Grunenberg bewohnt. Parallel zur Straße durchs Kirchdorf die traufeständige Fachwerkscheune und Haupthaus des Neuhofs, Kirchstraße 33, links die Pfarrkirche mit Pfarrhaus. Es musste leider Ende der 70er Jahre dem Bau des neuen Pfarrhauses weichen. | |
|
1930
- 1939 Die Fotografie Mitte der 1930er Jahre zeigt eins der vielen Wegekreuze im Ort Lohmar. Bei dem Wegekreuz handelt es sich um ein Sandsteinkreuz mit floralen Ornamenten auch an den Seiten. Es steht auf einem Sockel mit einem Abschlussprofil und einem... Die Fotografie Mitte der 1930er Jahre zeigt eins der vielen Wegekreuze im Ort Lohmar. Bei dem Wegekreuz handelt es sich um ein Sandsteinkreuz mit floralen Ornamenten auch an den Seiten. Es steht auf einem Sockel mit einem Abschlussprofil und einem Inschriftblock, mit aufgesetzter Abschlusshaube, integrierter Konsole und aufgesetztem Kreuzfuß. Die Kreuzbalken sind verhältnismäßig schlank und zum Zeitpunkt der Aufnahme ohne Corpus Christi verziert. Der Korpus ist Mitte der 1980er Jahre erneuert worden. Das Kreuz steht inmitten einer Lindenbaumgruppe (Dreiergruppe) und ist im Mai 1866 errichtet worden. Als einziges Kreuz der Lohmarer Wegekreuze ist die Werkstatt festgehalten in der es hergestellt wurde, nämlich J. Olzem aus Bonn. Weit weniger im Bewusstsein der Bevölkerung und kommunalpolitischer Kräfte ist aus dem Bereich der Baudenkmalpflege die Bedeutung jener zahlreichen über das Land verstreuten Zeugen von Geschichte, Religion, Volksglaube und Erinnerungen verankert, wie Wegekreuze, Grenzsteine, Feldmarken, Fußfälle, Votivbilder, Mahnmale und Grabsteine. Und doch sind gerade die „kleinen“ Denkmäler und die Notwendigkeit ihres Schutzes außerordentlich wichtig, sie zu erhalten und zu pflegen. Da Wegekreuze meistens im Privateigentum stehen und nach mehrfachem Generations- oder Eigentumswechsel leicht in Vergessenheit geraten, ist es von Seiten der Denkmalpflege wichtig, durch fachliche Beratung, die Eigentümer zum Schutz des Denkmals anzuhalten und das unmittelbare Interesse an der Erhaltung zu wecken. Deutlich ist der Stacheldrahtzaun als Begrenzung der Autobahntrasse zu erkennen. Im Hintergrund die Pfarrkirche mit dem Pfarrhaus (erbaut 1896) und rechts ein Teil des Kirchdorfs. | |
Gendameriemeister Hacker, Bürgermeister Friedrich Seywald, Gemeinderentmeister Erich Schöpe, Verw.-Ang. Dora Weber, Wegewärter Wilhelm Schwamborn Verw.-Ang. Emil Weber, Verw.-Ang. Martin Bayartz, Verw.-Lehrling Ernst Nasemann, Verw.-Lehrling Elfriede... Gendameriemeister Hacker, Bürgermeister Friedrich Seywald, Gemeinderentmeister Erich Schöpe, Verw.-Ang. Dora Weber, Wegewärter Wilhelm Schwamborn Verw.-Ang. Emil Weber, Verw.-Ang. Martin Bayartz, Verw.-Lehrling Ernst Nasemann, Verw.-Lehrling Elfriede Böhmer, Verw.-Lehrling Alfred Zinn, Verwal.-Ang. Jenny Bender. | |
Lehrer Heinrich Kurscheidt aus Lohmar unterrichtete von 1948 bis 1954 in Birk. Im Anschluss daran war er Hauptlehrer in Scheiderhöhe. Das bisher noch nicht veröffentliche Foto der Klassen 5 und 6 stammt von August 1949. Es wurde aufgenommen nach dem... Lehrer Heinrich Kurscheidt aus Lohmar unterrichtete von 1948 bis 1954 in Birk. Im Anschluss daran war er Hauptlehrer in Scheiderhöhe. Das bisher noch nicht veröffentliche Foto der Klassen 5 und 6 stammt von August 1949. Es wurde aufgenommen nach dem Religionsunterricht mit einem Pater der Steyler aus Sankt Augustin. Lehrer Kurscheidt war sehr streng, aber gerecht und hat uns Kindern viel beigebracht. Mit besonders viel Freude nahm man am Musikunterricht teil. Das Singen begleitete er oft mit seiner Geige. Die häufigen Spaziergänge mit Kräutersuche waren für mich immer ein besonderes Erlebnis. Lindenblüte, Spitzwegerich, Schafgarbe, Löwenzahn, Kamille und vieles mehr wurde gesammelt, getrocknet und zu Tee verarbeitet. | |
Das Bild zeigt die Trauung des Brautpaares Horst Niehusen und Elisabeth Hennekeuser am 8. September 1951 vor Pfarrer Anton Michels und umgeben von den Verwandten. Abgesehen von der persönlichen Erinnerung, die mit diesem Bild verbunden ist, soll... Das Bild zeigt die Trauung des Brautpaares Horst Niehusen und Elisabeth Hennekeuser am 8. September 1951 vor Pfarrer Anton Michels und umgeben von den Verwandten. Abgesehen von der persönlichen Erinnerung, die mit diesem Bild verbunden ist, soll hier der damalige Zustand des Altarraumes mit dem Hochaltar geschildert werden. An der Stelle des von Dr. Aumüller 1854 beschafften neugotischen Hochaltars aus Holz, dessen Aufsatz um 1930 erheblich reduziert wurde, errichtete man nach Zeichnung und Kostenanschlag des Regierungs- und späteren Diözesanbaurats Karl Band aus Köln und nach Beschluss des Kirchenvorstands vom 14. Januar 1940 den nur 20 Jahre lang bestehenden Hochaltar aus Naturund Kunststein. Die geringen schriftlichen Unterlagen und mageren Protokolle jener Zeit lassen keinen Aufschluss über Material, Bildhauer und Kosten zu. Es ist lediglich bekannt, dass der Maurermeister Josef Sinzig aus Schreck die Angleichung des Chorbodens und die Verlegung der Stufen vornahm. Der Altaraufsatz war reliefartig mit einem Netz von Rauten und darin eingefügten Lilien überzogen. Auf ihm standen die Holzfiguren aus dem früheren Hauptaltar, oben die Gruppe der Marienkrönung mit der Dreifaltigkeit, darunter in zwei seitlichen Stufen die Heiligen Vincenz von Paul, Matthias, Nikolaus von Tolentino und Philippus Neri. Von den bunten Chorfenstern sind nur noch vier Scheiben in der Friedhofskapelle vorhanden. Leider ist von der neugotischen Kanzel mit den vier Kirchenlehrern Ambrosius, Augustinus, Hieronymus und Gregorius nichts mehr erhalten oder Teile sind unbekannt verschwunden. Vorhanden sind noch die an den Chorwänden stehenden Figuren der Eltern Mariens, St. Joachim und St. Anna. | |
Das Haus Pütz in der Gartenstraße in den 1950er Jahren gehörte früher zu einer Hofanlage, die bis zur Hauptstraße reichte. Solche alten Fachwerkhäuser mit schiefem Giebel oder schiefen Wänden konnte man um diese Zeit in Lohmar noch einige finden.... Das Haus Pütz in der Gartenstraße in den 1950er Jahren gehörte früher zu einer Hofanlage, die bis zur Hauptstraße reichte. Solche alten Fachwerkhäuser mit schiefem Giebel oder schiefen Wänden konnte man um diese Zeit in Lohmar noch einige finden. Heute sind diese Häuser alle verschwunden.
| |
Vor jedem größeren Ausflug eines Vereins machen ausgesuchte Repräsentanten eine Vortour, um vor Ort alles bis ins Kleinste zu organisieren. Vor jedem größeren Ausflug eines Vereins machen ausgesuchte Repräsentanten eine Vortour, um vor Ort alles bis ins Kleinste zu organisieren. | |
Dieses alte Fachwerkhaus, inschriftlicht 1690 erbaut, liegt an der Kreisstraße von Kreuznaaf, nach Hausen, Hausdorp, Höffen, Oberstehöhe und weiter nach Marialinden, auf dem Höhenrücken zwischen Agger- und Naafbachtal. Hier in Weeg zweigt die... Dieses alte Fachwerkhaus, inschriftlicht 1690 erbaut, liegt an der Kreisstraße von Kreuznaaf, nach Hausen, Hausdorp, Höffen, Oberstehöhe und weiter nach Marialinden, auf dem Höhenrücken zwischen Agger- und Naafbachtal. Hier in Weeg zweigt die Verbindungsstraße nach Mackenbach hinunter ins Aggertal zur B 484 ab. Das Bild dürfte kurz nach dem 2. Weltkrieg entstanden sein, als die Eheleute Wilhelmine und Alfred Koch dort neben einem Kolonialwarengeschäft und einer Poststelle („Weeg/Siegburg-Land“) die Gastwirtschaft „Zur Sonne“ betrieben. Die Kegelbahn am linken Bildrand wurde um 1900 vom Vater von Alfred, Albrecht Koch, errichtet, sie war bis etwa 1930 seitlich offen, d.h. nur das Dach war gedeckt und das Balkengerüst aus senkrechten Ständern, Eckpfosten, Riegel und Schwellen war nicht mit Lehm ausgefacht, sondern offen. Neben der Gastwirtschaft war der Vater nebenberuflich als Sattler (auch „Ham[m]acher oder mundartlich „Hamächer“ genannt) und Polsterer tätig. Bis 2006 waren Ulla und Markus Fitzek die Wirtsleute „Zur Sonne“. Nach einem Umbau beherbergte das Haus das Restaurant „Olive bis es am 23. Januar 2012 seine Türen schließen und den Betrieb einstellen musste. Nach gut einem Jahr wurde das Restaurant ab Sonntag, 2. Dezember 2012 durch Annette Klein und Bert Berens als "Vier Jahreszeiten" neu eröffnet. Nach einem weiteren Pächterwechsel hieß das Restaurant "Fachwerk 1690". 2019 wurde der Gastronomiebetrieb eingestellt. | |
|
1950
- 1954 Zwischen den Ortschaften Kreuznaaf und Wahlscheid, in einem der schönsten und wechselvollsten Täler des Bergischen Landes, das Aggertal, wurde der Hof Stolzenbach in den Jahren 1839-1843 von Heinrich Wilhelm Otto erbaut. Der auf dem Bild sichtbare... Zwischen den Ortschaften Kreuznaaf und Wahlscheid, in einem der schönsten und wechselvollsten Täler des Bergischen Landes, das Aggertal, wurde der Hof Stolzenbach in den Jahren 1839-1843 von Heinrich Wilhelm Otto erbaut. Der auf dem Bild sichtbare hintere Teil des Hofs ist ein auf einem massiven Kellergewölbe errichtetes Fachwerkgebäude. Der Hof wurde bis in die 1950er/60er Jahre intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen sind die letzten 30 Jahre extensiv bewirtschaftet worden. Der in Richtung Straße liegende Teil des Gutshofes, ein Teil des heutigen Restaurants und Cafés „Haus Stolzenbach“ besteht aus Bruchsteinen und war, ab dem die Aggertal-Chaussee als kommunale Fernstraße im Jahr 1845 fertiggestellt war bis zur Neueröffnung des ersten fertiggestellten Teilstücks Siegburg-Overath-Ründeroth der Aggertalbahn am 15.10.1884, eine Post und Telegrafenstelle. Hier hielten früher täglich die zwischen Bonn und Engelskirchen fahrenden Postkutschen, unter anderem um die Pferde zu wechseln. Der Sohn des v.g. Gutsbesitzers Wilhelm Otto war viele Jahre 1. Beigeordneter der Bürgermeisterei Wahlscheid, aber auch Kreis- und Landesdelegierter des Düsseldorfer Landtags. Nach dem Zweiten Weltkrieg, Anfang der 1950er Jahre wurde im vorderen Gebäude, des Gutshofs, die Gaststätte „Haus Stolzenbach“ eröffnet, die sich heute durch einige An- Um- und Erweiterungsbauten mit einer ansprechenden Außengestaltung zu einem renommierten Restaurant, einem bekannten Speiselokal mit gediegenen Gesellschaftsräumen, entwickelt hat. Anhand des Oldtimers, ein Mercedes der 170er Baureihe, kann man erkennen, dass das Bild Anfang der 1950 Jahre fotografiert worden sein muss. | |
Die Aufnahme aus den 1950er bis 60er Jahren hält die wesentlichen baulichen Merkmale der Kirche von Neuhonrath aus der Zeit der Restaurierung 1898/97 fest. Die Umfassungsmauern sind noch unverputzt. Die acht gradlinig geschlossenen bisherigen Fenster... Die Aufnahme aus den 1950er bis 60er Jahren hält die wesentlichen baulichen Merkmale der Kirche von Neuhonrath aus der Zeit der Restaurierung 1898/97 fest. Die Umfassungsmauern sind noch unverputzt. Die acht gradlinig geschlossenen bisherigen Fenster wurden in Rundbogenfenster geändert. (Anmerkung: heute, nach der Restaurierung nach 1969 ist die Kirche verputzt und die Fenster wieder im Sturz gradlinig ausgeführt worden). Neben der kath. Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt, kann man vor dem Kirchhof die ehemalige Scheune der Vikarie, das im Jahr 1968 zur Lehrerwohnung umgebaute ehemalige Fachwerkschulhaus und rechts davon das aus Grauwacke errichtete Schulgebäude für den Unterricht der Kinder erkennen. Ansonsten ist der Hügel rund um die Kirche noch nicht bebaut. 1953 wird das zweiklassige neue Schulgebäude mit Unter- und Oberklasse am rechten Bildrand feierlich eingeweiht. | |
|
1975
- 1979 Die Fotografie, Ende der 1970er Jahre, zeigt die Rückfront der Volksschule Lohmar Kirchstraße vor der Umbauphase im April 1961 zur evangelischen Volksschule Lohmar. Nach den Osterferien war alles fertig. Im gleichen Jahr wurden vom Lohmarer Schul-... Die Fotografie, Ende der 1970er Jahre, zeigt die Rückfront der Volksschule Lohmar Kirchstraße vor der Umbauphase im April 1961 zur evangelischen Volksschule Lohmar. Nach den Osterferien war alles fertig. Im gleichen Jahr wurden vom Lohmarer Schul- und Kulturausschuss die Einzelheiten eines Neubaus der evangelischen Schule neben der katholischen Volksschule – Waldschule – beschlossen. Bevor es zur neuen Nutzung „rotes Kreuz“ oder Polizeistation Lohmar kam, vergingen noch einige Jahre, bis schließlich im Jahre 2003 die Abbruchbirne kam. | |
Die Dreiflügelanlage der Vorburg aus Fachwerkgefüge öffnet sich zum Osten hin durch ein rundbogiges Hausteintor in Richtung Kirchdorf. Früher war die Burg durch diese Hofausfahrt mit dem Kirchdorf und dem Unter- und Oberdorf verbunden, wurde dann... Die Dreiflügelanlage der Vorburg aus Fachwerkgefüge öffnet sich zum Osten hin durch ein rundbogiges Hausteintor in Richtung Kirchdorf. Früher war die Burg durch diese Hofausfahrt mit dem Kirchdorf und dem Unter- und Oberdorf verbunden, wurde dann 1937 durch den Bau der Bundesautobahn Köln Frankfurt brutal vom restlichen Dorf abgeschnitten. Der Schlussstein des Bogens ist inschriftlich mit 1717 datiert und mit dem Ehewappen der Familie von Groote und zum Bach versehen. Diese Datierung der Um- bzw. Anbauphase der Burg Lohmar lässt sich mit dem Fällungsdatum eines Sparrens und eines Ständers aus dem Innengiebel des Stalltraktes dendrochronologisch nachweisen (Universität zu Köln 1991/92). Seitlich eingemauert, auf dem Bild nicht sichtbar, sind zwei ältere Renaissancewappen aus der Zeit um 1600, diejenigen des Caspar von der Reven zu Lohmar und seiner Gattin Maria von Blankart. (Lohmarer Heimatblätter, H. Hennekeuser, 2008, S.19ff.) | |
Dieses ist ein Foto von der linken Seite der Kirchstraße ab der Einmündung Raiffeisenstraße im Februar 2003, bevor der Lidl-Markt gebaut wurde. Als erstes ist das Mietshaus Knipp zu erkennen. In ihm waren zuletzt Parterre die Versicherungsagentur... Dieses ist ein Foto von der linken Seite der Kirchstraße ab der Einmündung Raiffeisenstraße im Februar 2003, bevor der Lidl-Markt gebaut wurde. Als erstes ist das Mietshaus Knipp zu erkennen. In ihm waren zuletzt Parterre die Versicherungsagentur Katterfeld und der Quelle-Shop. Auf der ersten Etage wohnten die Familien Gries jun. und Müller und unter dem Dach Frau Jörke mit Tochter Lydia. Daneben in dem schmalen, etwas hervorkragenden Mietshaus, das zum Schulkomplex gehörte, wohnte die Familie Mende. Dann das ehemalige Schulgebäude von 1857, in dem das „Rote Kreuz“ und die „Malteser“ untergebracht waren und das weiß verputzte Schulgebäude von 1908, in dem das Jugendzentrum war. Der gesamte Komplex wurde 2003 abgerissen und darauf der LIDL-Markt gebaut | |
In der Zeit um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert weitete sich der Ort Donrath, in der Gemeinde Halberg erheblich aus. Donrath war lange Zeit Verwaltungsmittelpunkt der Bürgermeisterei Lohmar, nämlich ab 1851bis 1892 mit Bürgermeister Wilhelm... In der Zeit um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert weitete sich der Ort Donrath, in der Gemeinde Halberg erheblich aus. Donrath war lange Zeit Verwaltungsmittelpunkt der Bürgermeisterei Lohmar, nämlich ab 1851bis 1892 mit Bürgermeister Wilhelm Orth im Haus Siebertz und 1892 verlegte der Bürgermeister Peter Karl von Francken (1892-1906) seine Amtsstube in zwei Räume des an das „Weisse Haus“ angebauten Nebengebäudes, dort wo auf dem Bild der Saaltrakt links neben dem Hauptgebäude später errichtet wurde. Die Gast- und Schankwirtschaft gehörte zu diesem Zeitpunkt Fritz Kreuzer, der am 22.4.1892 die Konzession erhielt im Hause Nr. 5 in Donrath einen Gasthof zu betreiben. Darüber hinaus hatte er eine Handlung in Holz und Baumaterialien, Kohlen, Futter- und Düngemitteln. Am 9.12.1909 erweiterte er seine Gasträume um einen Tanzsaal und eine Kegelbahn. Die jungen Turner des heute bereits 100 Jahre bestehenden Turnvereins Donrath e.V. konnten hier ihre Leibesübungen aufnehmen. Eine spätere Wirtin des „Weissen Hauses“ war wie auf dem Foto der 1920er Jahre ersichtlich Erna Paffrath. | |
Die Evangelische St. Bartholomäuskirche Wahlscheid, erstmalig 1166 urkundlich erwähnt, als die Gräfin Hildegunde von Meer die restaurierte Kirche zu „Walescheidt“ mit Billigung des Kölner Erzbischofs Arnold dem neu errichteten Frauenkloster Meer bei... Die Evangelische St. Bartholomäuskirche Wahlscheid, erstmalig 1166 urkundlich erwähnt, als die Gräfin Hildegunde von Meer die restaurierte Kirche zu „Walescheidt“ mit Billigung des Kölner Erzbischofs Arnold dem neu errichteten Frauenkloster Meer bei Neuß schenkte. Die Kirche liegt auf dem Berg inmitten eines räumlich kleinen Siedlungskerns von Fachwerkhäusern u.a. die alte Küsterei und Schule, unweit von dem in östlicher Richtung liegenden Ortsteil Münchhof mit dem Haupthof Münch(Mönch)hof, der bis zum Besitzwechsel 1718 wie auch das Frauenstift in Händen des Propstes von Kloster Steinfeld in der Eifel lag, das die Patronats- und Zehntrechte für das Frauenkloster Meer wahrnahm. 1557 zog die Reformation in Wahlscheid ein. Zu dieser Zeit wurden auch die Nachbargemeinden in Seelscheid, Honrath und Hoffnungsthal evangelisch und bildeten fortan die vier lutherischen Kirchengemeinden auf den Bergen. In den Wirren des Dreißigjährigen Krieges kehrte das Kirchspiel Wahlscheid für kurze Zeit (von 1624 bis 44) wieder zurück zum Katholizismus. Gegen den massiven Willen des Volkes musste der damalige Schultheiß Johann Ley den katholischen Pastor Herpertz in den Dienst einsetzen. Spätestens mit dem Religionsvergleich des Großen Kurfürsten, Friedrich Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg-Preußen, wurde zugrundegelegt, dass die unter evangelischer Herrschaft regierten Länder Kleve, Mark und Ravensberg lebenden Katholiken und die unter katholischer Herrschaft regierten Länder Jülich und Berg lebenden Protestanten frei und ungehindert ihre Religion ausüben durften. In der Gemeinde Wahlscheid wurde dieses Recht der freien Religionsausübung den Lutherischen zuerkannt und dabei blieb es bis auf den heutigen Tag. 1817 wurde das Langhaus der Kirche verlängert, 1870 wurde der altromanische Turm erneuert und 1883 eine Sakristei angebaut. 1981 bekam die Kirche eine Neufassung des Innenanstrichs und die verputzte Farbfassung und den Außenanstrich der Fassade wie wir ihn kennen. | |
Wegekreuz an der Flughafenstraße (früher Kirchstraße) /Ecke Schengbüchel, in Altenrath um 1938. Das Kreuz wurde nach Zerstörung durch einen Unfall durch die Stadt Troisdorf wiederhergestellt und etwas weiter zurückversetzt, mit dem Korpus jetzt zum... Wegekreuz an der Flughafenstraße (früher Kirchstraße) /Ecke Schengbüchel, in Altenrath um 1938. Das Kreuz wurde nach Zerstörung durch einen Unfall durch die Stadt Troisdorf wiederhergestellt und etwas weiter zurückversetzt, mit dem Korpus jetzt zum Schengbüchel gewandt. Eingeweiht wurde es am 10.6.1976, dem Tag der Europawahl. Ursprünglich hieß die Gastwirtschaft am heutigen Rondell Heidegraben/Flughafenstraße „Zur Eiche“ und wurde von Leopold Paffrath geführt (die Namensgebung der Kneipe war wahrscheinlich von der Flurbezeichnung „Unter den Eichen“ abgeleitet). Ab dem 19.9.1907 war Gerhard Scharrenbroich der Wirt dieser Gast- und Schankwirtschaft im Hause Nr.38 in Altenrath, diese hieß später „Heidekranz“, zwischenzeitlich mal „Op der jood Eck“ und nun wieder „Heideklause“. Im August 1936 wird vom Reichskriegsminister angeordnet, dass die komplette Ortschaft Altenrath bis zur neu gebauten Autobahn A3 zu räumen sei und dem Truppenübungsplatz zugeschlagen wird. Am 1. Juli 1938 ist Altenrath geräumt, die Familien wurden größtenteils nach Lohmar (in die Altenrather Straße) und nach Troisdorf ins Unterdorf umgesiedelt. Nach der bedingungslosen Kapitulation am 8. Mai 1945 wird zur Linderung der Wohnungsnot Altenrath wiederbesiedelt. Bis zur kommunalen Neuordnung des Rhein-Sieg-Kreises 1969 gehörte Altenrath zum Amt Lohmar und wurde dann ein Teil der Stadt Troisdorf. | |
|
1940
Mit diesem Foto soll einmal gezeigt werden, wie groß die Volksfrömmigkeit in „Lohmar in alten Zeiten“ war natürlich nicht nur in Lohmar, sondern allgemein und welch ein immenser Aufwand bei Prozessionen für die Herrichtung der Sakramentsaltäre... Mit diesem Foto soll einmal gezeigt werden, wie groß die Volksfrömmigkeit in „Lohmar in alten Zeiten“ war natürlich nicht nur in Lohmar, sondern allgemein und welch ein immenser Aufwand bei Prozessionen für die Herrichtung der Sakramentsaltäre betrieben wurde – für ein Segensritual, das höchstens 20 Minuten dauerte. | |
|
1940
Auf dem Foto sind die „Engelchen“, zu sehen die vorher am Sakramentsaltar verteilt knieten. Rechts und links am Altar sind zwei Meßdiener zu sehen: links Fritz Kurtsiefer und rechts unbekannt. Die stehenden „Engelchen“ sind von links nach rechts 1.... Auf dem Foto sind die „Engelchen“, zu sehen die vorher am Sakramentsaltar verteilt knieten. Rechts und links am Altar sind zwei Meßdiener zu sehen: links Fritz Kurtsiefer und rechts unbekannt. Die stehenden „Engelchen“ sind von links nach rechts 1. Resi Kirschbaum, 2. Resi Küpper, 3. Marlene Weingarten, 4. Maria Becker verh. Krauthäuser, 5. Marlies Rottländer und 6. Evelin Gschwind. Vorne sitzen links Karola Küpper und rechts Josefine Küpper. | |
Auf dem Luftbild, das 1958 gemacht wurde, ist ein kleiner Teil der Armaturenfabrik Johann Fischer zu sehen, das Sägewerk Sauer und das ganze noch kaum bebaute Areal zwischen Waldweg und Hardt. Vorne links an der Hermann-Löns-Straße ist das... Auf dem Luftbild, das 1958 gemacht wurde, ist ein kleiner Teil der Armaturenfabrik Johann Fischer zu sehen, das Sägewerk Sauer und das ganze noch kaum bebaute Areal zwischen Waldweg und Hardt. Vorne links an der Hermann-Löns-Straße ist das Pförtnerhäuschen der Fabrik Fischer. In dem Firmengebäude auf der anderen Straßenseite war nach dem Krieg das erste Lohmarer Kino untergebracht. Daneben ist das Sägewerk Willi Sauer mit dem Wohngebäude an der Straße, das auch das Geburtshaus des Fabrikanten und Heimatforschers Bernhard Walterscheid-Müller ist, der am 21.7.1991 verstarb. Das Haus am rechten Bildrand gehörte damals der Familie Werner und später Rolf Sieben, der es weiterverkaufte. Bei dem Neubau, der gerade errichtet wurde, handelt es sich um das Haus Rettke. Das dahinter liegende Grundstück mit dem niedrigen Gebäude, in dem sich eine Werkstatt befand gehörte Josef Dunkel. Er wohnte damals noch nicht im Korresgarten und hat später das Haus Nr. 26 (auf dem Bild nicht mehr zu sehen) gekauft und mit seiner Frau bezogen. Das Haus hatten die Eheleute Ravenstein errichtet. Sie dind nach Australien ausgewandert. Gegenüber liegen die Baracken, die bald abgerissen und durch die Villa Fischer ersetzt wurden. Heute befindet sich hier ein moderner Wohnpark. Rechts daneben die beiden Häuser Jüngling (Nr. 25 und Nr. 27). Hinter dem Kino am linken Bildrand erkennt man Im Korresgarten das Haus Klette, bei dem ein kleiner Tierpark war. Zur Zeit der Aufnahme war schon die Familie Oleschkowitz Eigentümer dieses Hauses, die einen kleinen Holzhandel führten (siehe daneben die Baracke mit dem Vorplatz. Später hat August Oleschkowitz in Donrath das Sägewerk von Peter Jakobs übernommen, das sein Sohn Walter ausgebaut hat. Neben der Baracke erkennt man das Haus von Peter Buchholz, der 1971 bei der Firma Dr. Dieter Goerrig GmbH tödlich verunglückte. Schräg darüber ist das Haus Schwertner, heute Bungart und darüber das Haus (Nr. 10) der Schwestern Gertrud und Änne Orth. Oberhalb, auf der anderen Seite des Weges „Auf der Hardt“ ist das Haus des Peter Scheidt. Das große Doppelhaus wurde in den 1930er Jahren gebaut. Links lebte die Familie Heinrich Eimermacher und rechts Heinrich Knipp mit seiner Ehefrau, „et Knepps Bäreb”. Heute wohnt hier die Familie Peter Schneider. Oben am Waldrand ist das Anwesen der Familie Goerrig (heute Deisenroth). Die Dr. Dieter Goerrig GmbH stellte dort Chemikalien für die Textilindustrie her. In den Baracken auf dem Platz waren in der Nazi-Zeit etwa 80-100 russische Zwangsarbeiterinnen und ungefähr 20 französische Kriegsgefangene untergebracht. Die Frauen gingen jeden Morgen in Vierer-Reihen, bewacht von Lohmarer SA-Leuten, zur Fabrik Fischer und abends wieder zurück. Meist gingen sie singend mit herrlichen russischen Gesängen auf den Lippen oder eine Sängerin sang vor, und die anderen sangen im Chor nach (der Erzähler meinte, es liefe ihm jetzt noch eine Schauer den Rücken herunter, wenn er sich an diese schönen Stimmen und Gesänge erinnere). Dort stand später bis 2018 die Villa des Stephan Fischer, der, als sein Vater am 1.9.1957 mit 70 Jahren verstarb, die Leitung der Firma übernahm. Die Firma Fischer wurde 1924 mit einer kleinen Werkstatt im Keller des Wohnhauses des Graveurmeisters Johann Fischer in der Hermann-Löns-Straße gegründet. Nach anfänglichen Schwierigkeiten nahm man Armaturen für die Ausrüstung von Maschinenanlagen und Poststecker ins Programm auf und damit ging es ab 1929 steil aufwärts, so dass bei entsprechender Erweiterung des Werkes 1942 schon 800 und 1945 sogar 1000 Mitarbeiter in der Armaturenfabrik beschäftigt waren (Quelle: W. Pape, LHBL Nr. 20, 2006). | |
Das Foto wurde im Mai 1965 von der Kirche aus auf das Küsterhaus und die Kaplanei gemacht. Vorne rechts, traufseitig zur Straße, ist das Wohnhaus der Familie Peter Kümpel und dahinter der Bauhof der Baustofffirma Josef Knipp. Vorne mit dem Giebel zur... Das Foto wurde im Mai 1965 von der Kirche aus auf das Küsterhaus und die Kaplanei gemacht. Vorne rechts, traufseitig zur Straße, ist das Wohnhaus der Familie Peter Kümpel und dahinter der Bauhof der Baustofffirma Josef Knipp. Vorne mit dem Giebel zur Straße hin ist das Küsterhaus (Kirchstraße 21), das Anfang der 1950er Jahre gebaut wurde. In ihm wohnte der Küster Thomas Kappes mit seiner Familie. Dahinter sieht man die Kaplanei mit dem Anbau des Pfarrheims. Die Kaplanei ist mit einer Spende von Ludmilla Böttner („et Aggerburchs Milla“) 1935/36 gebaut worden. Ab Anfang der 1980er Jahre war dort das Wasserwerk untergebracht. Hinter der Kaplanei kann man noch die Dächer der alten Volksschule erkennen. Außer dem Küsterhaus und dem Haus Kümpel ist der ganze Komplex, einschließlich dem Bauhof und der Häuser Knipp, Ende 2003 abgerissen worden, um dort den Lidl-Markt zu errichten. | |
Der Innenraum der Kirche wird beherrscht vom mächtigen neugotischen Hochaltar aus Holz, den die Gebrüder Peter und Heinrich Klein aus Köln im Jahre 1854 herstellten. Von ihnen stammt auch die Kommunionbank mit der Darstellung des Abendmahles nach... Der Innenraum der Kirche wird beherrscht vom mächtigen neugotischen Hochaltar aus Holz, den die Gebrüder Peter und Heinrich Klein aus Köln im Jahre 1854 herstellten. Von ihnen stammt auch die Kommunionbank mit der Darstellung des Abendmahles nach Leonardo da Vinci. Die übrigen Gegenstände, wie Kanzel und Baldachine über den Figuren sowie die Glasmalereien im Chor, entsprechen ganz dem damaligen Empfinden. | |
Nach wiederholten Umgestaltungen des Inneren ist nunmehr die Architektur, insbesondere auch die des wertvollen gotischen Chores aus dem 13. Jahrhundert, deutlich in den Vordergrund gerückt. Die Ausmalung des Gliederungssystems im Chor entspricht dem... Nach wiederholten Umgestaltungen des Inneren ist nunmehr die Architektur, insbesondere auch die des wertvollen gotischen Chores aus dem 13. Jahrhundert, deutlich in den Vordergrund gerückt. Die Ausmalung des Gliederungssystems im Chor entspricht dem mittelalterlichen Befund. | |
|
1800
Die Ideenskizze von Heinrich Hennekeuser beruht auf alten Baubeschreibungen und einer Rekonstruktionszeichnung von Jörg Schulze. Im Jahre 1800 wurde zwischen dem gotischen Chor und dem ursprünglichen romanischen Turm ein schlichter Saalbau errichtet.... Die Ideenskizze von Heinrich Hennekeuser beruht auf alten Baubeschreibungen und einer Rekonstruktionszeichnung von Jörg Schulze. Im Jahre 1800 wurde zwischen dem gotischen Chor und dem ursprünglichen romanischen Turm ein schlichter Saalbau errichtet. Vor der Kirche stand bis 1827 die mächtige alte Dorflinde. Sie war möglicherweise einmal die Gerichtslinde des Dingstuhls Birk. Das Fachwerkhaus wurde 1818 von Lehrer Scharrenbroich errichtet. | |
|
1913
Das Foto, das nach 1913 entstanden sein muss, zeigt die Kirche Scheiderhöhe kurz nach der Einweihung der Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“. 1911 wurde der Grundstein zum Bau der heutigen einschiffigen, neuromanischen Pfarrkirche gelegt. Trotz des am... Das Foto, das nach 1913 entstanden sein muss, zeigt die Kirche Scheiderhöhe kurz nach der Einweihung der Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“. 1911 wurde der Grundstein zum Bau der heutigen einschiffigen, neuromanischen Pfarrkirche gelegt. Trotz des am 24.2.1912 wegen fehlerhafter Mauerarbeiten erfolgten Einsturzes des bereits 19 Meter hoch aufgemauerten Kirchturmes wurde die Pfarrkirche zügig fertiggestellt. Die Einweihungsfeier konnte am 29.1.1913 stattfinden. Die neue, weit ins Bergische Land, in die Aggerebene schauende Pfarrkirche, von der nördlichen Seite aus gesehen, war unmittelbar neben der inzwischen bis auf das Chor und Teile der Sakristei abgerissen Kapelle „Heilig Kreuz“ errichtet worden. Der teilweise Abbruch, der inzwischen 113 Jahre alten Kapelle, fand 1926 statt. Auf dem freien Feld ist heute das Pfarrheim errichtet worden. | |
|
1919
Eine der jüngeren Mühlen des Kirchspiels Wahlscheid ist die Dorper Mühle, eine Wasser-Kornmühle, die am heutigen Fahrweg zwischen dem Aggertal, der B 484, unweit von Mackenbach und Hausdorp liegt. Sie wurde am 3.11.1842 bewilligt und wahrscheinlich... Eine der jüngeren Mühlen des Kirchspiels Wahlscheid ist die Dorper Mühle, eine Wasser-Kornmühle, die am heutigen Fahrweg zwischen dem Aggertal, der B 484, unweit von Mackenbach und Hausdorp liegt. Sie wurde am 3.11.1842 bewilligt und wahrscheinlich im gleichen Jahr spätestens Anfang 1843 von Johann Wilhelm Steeger erbaut.
| |
So sah es Anfang der 1950er Jahre an den Wochenenden an der Agger aus, wo überwiegend Kölner zum Baden in die Aggerauen schwärmten. Weite Flächen der Uferregion wurden von Campingfreunden für viele Freizeitaktivitäten genutzt. In der Hauptsache waren... So sah es Anfang der 1950er Jahre an den Wochenenden an der Agger aus, wo überwiegend Kölner zum Baden in die Aggerauen schwärmten. Weite Flächen der Uferregion wurden von Campingfreunden für viele Freizeitaktivitäten genutzt. In der Hauptsache waren es Kölner, die ihre Zelte rechts und links entlang des Uferbereichs von der Lohmarer Brücke bis nach Siegburg aufstellten und dort ihre Wochenenden verbrachten. Karl Berbuer persifliert 1948 die Campingerlebnisse in seinem Karnevals-Lied (Do laachs do dich kapott, dat nennt m‘r Camping – „Beim Sülztal op ´ner Wiss ...“).
| |
|
1990
Seinerzeit, als der Dorfbach (Auelsbach) noch offen entlang der Bachstraße verlief, war die Straße ein mehr oder weniger unbefestigter, besserer Feldweg nur durch einen schmalen Grasstreifen vom Bach abgetrennt Das Grundstück mit dem Fachwerkhaus... Seinerzeit, als der Dorfbach (Auelsbach) noch offen entlang der Bachstraße verlief, war die Straße ein mehr oder weniger unbefestigter, besserer Feldweg nur durch einen schmalen Grasstreifen vom Bach abgetrennt Das Grundstück mit dem Fachwerkhaus war gegenüber dem Gemeindeweg etwas abgesenkt. Man erreichte es über einen kleinen Verbindungsweg mit einem Fußsteg über den Auelsbach. Überflutungen der Grundstücke waren seinerzeit keine Seltenheit, dabei lief das Wasser auch in die, nur durch eine Schwelle erhöhte Wohngebäude. Erst 1928 entschloss man sich die Bachstraße auszubauen und rund 3 Dekaden später den fast kompletten Bachlaufinnerhalb des Dorfes zu verrohren. Zur Zeit der Ur-Flurkarte von 1823 sind für das auf dem Bild ersichtliche Doppelhaus, Parzelle 70 einer namens Peter Altwickler und für die andere Hälfte, Parzelle 71 Peter Wiedenhöfer, als Eigentümer verzeichnet. Die Namen der Personen auf dem Bild sind leider nicht mehr auszumachen. | |
Zu sehen ist der Bahnhof von Lohmar etwa Ende der 1930er Jahre. Links im Vordergrund das Dach des Güterschuppens und dahinter das Haus Rassmes. Die Eröffnung des ersten fertiggestellten Teilstücks Siegburg –Overath – Ründeroth der Aggertalbahn (im... Zu sehen ist der Bahnhof von Lohmar etwa Ende der 1930er Jahre. Links im Vordergrund das Dach des Güterschuppens und dahinter das Haus Rassmes. Die Eröffnung des ersten fertiggestellten Teilstücks Siegburg –Overath – Ründeroth der Aggertalbahn (im Volksmund „et Lühmere Jrietsche“ genannt), fand am 15.10.1884 statt. Mit der Inbetriebnahme des zweiten Teilstücks Ründeroth – Dieringhausen – Derschlag am 1.5.1887 sowie des dritten Streckenabschnitts Derbschlag – Bergneustadt und des vierten und letzten Teilstücks Bergneustadt – Olpe hatte die Aggertalstrecke ihre volle Länge erreicht. 1903 verkehrten 7 Personenzüge sowie durchgehende Güterverkehrszüge bis ins Oberbergische. 1954 wird bereits der planmäßige Personenverkehr zwischen Siegburg und Overath wieder eingestellt. Im Herbst 1971 wird auch der Güterverkehr von Siegburg nach Lohmar gestrichen. Lediglich die 1910 eröffnete neue Verbindungsstrecke Overath – Rösrath nach Köln blieb fürs mittlere Aggertal erhalten. | |
Dieses zweigeschossige, traufeständige Fachwerkdoppelhaus in Lohmar Bachstraße stand auf dem Gelände der Gewanne „Auf der Gasse“, angrenzend an die Flurbezeichnung „In Sieben Hausen“, dort wo die Bachstraße eine scharfe Rechtsbiegung zur Hauptstraße... Dieses zweigeschossige, traufeständige Fachwerkdoppelhaus in Lohmar Bachstraße stand auf dem Gelände der Gewanne „Auf der Gasse“, angrenzend an die Flurbezeichnung „In Sieben Hausen“, dort wo die Bachstraße eine scharfe Rechtsbiegung zur Hauptstraße macht und die Alte Lohmarer Straße links abzweigt. Allmanns Haus („op de Höff“), um dieses handelt es sich auf dem Foto von 1900, stand etwas tiefer- und zurückliegend gegenüber dem Straßenverlauf der Bachstraße, noch hinter Kirschbaums und Müllers Haus, in etwa dort wo der Auelsbach die heutige Verrohrung verlässt und in offener Vorflut weiter fließt und nach links Richtung Hauptstraße abbiegt. Müllers Haus brannte 1982 bis auf die Grundmauern nieder, das Grundstück selber blieb noch ungefähr 15 Jahre brach liegen, dann wurde die Ecke Bachstraße in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre durch Rainer Hagen neu bebaut. Seinerzeit, als der Dorfbach (Auelsbach) noch offen entlang der Bachstraße verlief, war die Straße ein mehr oder weniger unbefestigter, besserer Feldweg nur durch einen schmalen Grasstreifen vom Bach abgetrennt Das Grundstück mit dem Fachwerkhaus war gegenüber dem Gemeindeweg etwas abgesenkt. Man erreichte es über einen kleinen Verbindungsweg mit einem Fußsteg über den Auelsbach. Überflutungen der Grundstücke waren seinerzeit keine Seltenheit, dabei lief das Wasser auch in die, nur durch eine Schwelle erhöhte Wohngebäude. Erst 1928 entschloss man sich die Bachstraße auszubauen und rund 3 Dekaden später den fast kompletten Bachlaufinnerhalb des Dorfes zu verrohren. Zur Zeit der Ur-Flurkarte von 1823 sind für das auf dem Bild ersichtliche Doppelhaus, Parzelle 70 einer namens Peter Altwickler und für die andere Hälfte, Parzelle 71 Peter Wiedenhöfer, als Eigentümer verzeichnet. Die Namen der Personen auf dem Bild sind leider nicht mehr auszumachen.
| |
|
1920
- 1929 Das Foto der Ostseite des Kirchdorfs, mit dem Kriegerehrenmal des Krieges 1914-18 und den noch kleinen Ulmen, muss Mitte der 1920er Jahre aufgenommen sein. Der Friedhof ist mit einer steinernen Mauer eingefasst. Die Brückenstraße, als Umgehung des... Das Foto der Ostseite des Kirchdorfs, mit dem Kriegerehrenmal des Krieges 1914-18 und den noch kleinen Ulmen, muss Mitte der 1920er Jahre aufgenommen sein. Der Friedhof ist mit einer steinernen Mauer eingefasst. Die Brückenstraße, als Umgehung des Kirchdorfs und der Burg, gab es noch nicht. Zu sehen sind links auf dem Foto Nebengebäude mit angebautem Backes des Fronhofes. | |
Dieses seltene, sehr alte Bild zeigt Inger um 1910. Selten, weil es mal den normalen Alltag zeigt. Hier wurde niemand herausgeputzt, hier wurde nichts geschönt. Die Kinder verharren zwar im Moment der Aufnahme wie Statuen, man gewinnt aber dennoch... Dieses seltene, sehr alte Bild zeigt Inger um 1910. Selten, weil es mal den normalen Alltag zeigt. Hier wurde niemand herausgeputzt, hier wurde nichts geschönt. Die Kinder verharren zwar im Moment der Aufnahme wie Statuen, man gewinnt aber dennoch den Eindruck vom dörflichen Leben dieser Zeit. Das Foto wurde im „Unterdorf“ gemacht, mit Blick von der Kreuzung in Richtung Algert. | |
|
1930
- 1939 Der Pfarrchor „St. Cäcilia Lohmar“ nach seiner Wiedergründung bzw. seinem Wiederaufleben am 16.11.1930, etwa 50 Jahre seit Bestehen der Chorgemeinschaft. Bereits am 31.8.1933 beschloss man einen gemischten Chor mit Damen zu gründen. Das... Der Pfarrchor „St. Cäcilia Lohmar“ nach seiner Wiedergründung bzw. seinem Wiederaufleben am 16.11.1930, etwa 50 Jahre seit Bestehen der Chorgemeinschaft. Bereits am 31.8.1933 beschloss man einen gemischten Chor mit Damen zu gründen. Das nebenstehende Bild muss Mitte der 1930er Jahre aufgenommen worden sein. Untere Reihe von links nach rechts: Wilhelm Rassmes, Wilhelm Rörig, Peter Kemmerich, Pfarrer Bernhard Busch, Chorleiter Thomas Kappes, 2. Vorsitzender Baptist Broicher, Josef Lohmar – mittlere Reihe: Lorenz Piller, Josef Roland, Josef Rörig (I), Stellmacher Wilhelm Schmitz (= „de Äesser“ von Achsmacher abgeleitet), Fred Allmann, Toni Piller oder Willi Krieger?, Martin Köb, Wilhelm Rottland, Peter Lüdenbach, Bernhard Kurscheid (auf Lücke), Willi Krumm, – obere Reihe: Wilhelm Schmitz, Heinrich Köb, Hubert Pohl, Willi Kümmler, Josef Rörig (II), Jean Müller („de Fucka“) | |
|
1930
- 1939 Diese Aufnahme aus den 1930er Jahren zeigt die Lohmarer Mühle der Familie Pilgram in der Buchbitze am Fuß des alten Griesberges (Kieselhöhe) im Oberdorf von Lohmar. Die Mühle wird 1493 erstmals im Rent- und Lagerbuch von Blankenberg als Zwangmühle... Diese Aufnahme aus den 1930er Jahren zeigt die Lohmarer Mühle der Familie Pilgram in der Buchbitze am Fuß des alten Griesberges (Kieselhöhe) im Oberdorf von Lohmar. Die Mühle wird 1493 erstmals im Rent- und Lagerbuch von Blankenberg als Zwangmühle der Burgherren von Reven genannt. 1974/75 musste das Mühlengebäude einem kleinen Gewerbebetrieb des Fischzuchtsbetriebes der Familie Pilgram Platz machen. Das letzte Wasserrad der Mühle wurde – wenn auch stark restauriert – in der Gutmühle (Restaurant „Auszeit“) im Wahnbachtal wieder eingebaut. Der Mühlbach (Auelsbach) links des Weges ist nur ansatzweise zu erkennen. | |
Die meisten Wanderer, die auf dem Talweg unterhalb Albach den Wald betreten, werden wohl beim Anblick des „Hexenhäuschens“ an das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm denken. Aber wer mag wirklich hier wohnen und wer hat es gebaut? Dr. Heinrich... Die meisten Wanderer, die auf dem Talweg unterhalb Albach den Wald betreten, werden wohl beim Anblick des „Hexenhäuschens“ an das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm denken. Aber wer mag wirklich hier wohnen und wer hat es gebaut? Dr. Heinrich Schwamborn aus Inger, Oberstudienrat am Siegburger Gymnasium und Hauptbegründer des Heimatvereins Birk, hat das Fischerhäuschen in den Jahren 1929 -1931 bauen lassen. Und das kam so: In Schreck in der Gaststätte „Zum Turm“ traf er Zimmerleute an, die nichts zu tun hatten. Er fragte sie, ob sie Lust hätten, ein Badehäuschen für ihn zu bauen. Sie willigten ein. Herr Schwamborn skizzierte ihnen auf einem Blatt seine Idee. So entstand ein romantischer Fachwerkbau mitten im Wald. Im Krieg erlaubte Heinrich Schwamborn dem damaligen Jagdpächter, hier mit seiner Familie zu wohnen. Ihr Zuhause in Köln war durch Bomben zerstört. Nach dem Krieg wohnte hier eine Famlie aus Schlesien mit 4 Kindern bis 1963. Bis zum Besitzerwechsel im Jahr 2010 nutzten verschiedene Jagdpächter das idyllische Häuschen. Der jetzige Besitzer nutzt das Fischerhäuschen rein privat. Seinen Namen hat das Fischerhäuschen aus der Zeit, als in den angrenzenden Teichen Fischzucht betrieben wurde. | |
Die Karte zeigt den Auelerhof in den 30er Jahren. Gastwirt und Konditor Hermann Schiffbauer hatte Anfang des Jahrhunderts den Betrieb von seinem Vater Karl übernommen und zu einer über Wahlscheid hinaus bekannten Sommerfrische bekannt gemacht. Die... Die Karte zeigt den Auelerhof in den 30er Jahren. Gastwirt und Konditor Hermann Schiffbauer hatte Anfang des Jahrhunderts den Betrieb von seinem Vater Karl übernommen und zu einer über Wahlscheid hinaus bekannten Sommerfrische bekannt gemacht. Die „Villa Rapps“ neben der Gaststätte und den Kurgarten erwarb er von seinem Bruder Otto, dessen Ehefrau den Kurgarten angelegt hatte. Er nutzte die Villa als Dependance seines Hotels als „Haus Emmi“, benannt nach seiner jüngsten Tochter. „Haus Olga“, nach der ältesten Tochter benannt, baute er 1924 an der Wahlscheider Str. 30 neben dem neuen Bürgermeisteramt Wahlscheid. Auch dieses Gebäude wurde als Hotel genutzt, so konnte man 50-60 Gäste unterbringen. Auf der Rückseite der Karte warb Hermann Schiffbauer u.a. mit folgendem Text für sein Haus: „In schönster Lage direkt an der Agger liegt die altbekannte Gaststätte „Auelerhof“. Gut bürgerlich und sorgfältig geführt, bietet sie ihren Gästen das Beste aus Küche und Keller, besonders den weit und breit bekannten Kaffee mit Blatz und Kuchen. Täglich lebend frische Gebirgsforellen und im Sommer junge Hähnchen. Große Veranden, 3 Säle bis 400 Personen fassend, schöner Kurgarten, 400 Personen fassend, Bundeskegelbahn, Schießstand, Spielwiesen, Strandbad mit 4 Morgen großem Sportplatz, Parkplatz für 150 Wagen, Garagen und 30 Betten für Wochenendler und Pensionäre.“ Nach dem Krieg erbte Tochter Emmi Schöpe „Haus Olga“ und wohnte hier bis zu ihrem Tode im Jahr 2007. Im Erdgeschoss richtete die Kreissparkasse Siegburg Anfang der 40er Jahre eine Zweigstelle ein. Sie blieb hier bis 1960 ein neues Kreissparkassengebäude gegenüber gebaut wurde. Neben der Kreissparkasse gab es im Erdgeschoss noch ein Friseurgeschäft. Der Friseurmeister Josef Urban, verheiratet mit einer Engländerin, wurde nach Kriegsende von der britischen Militärregierung als kommissarischer Bürgermeister 1945-1946 für die Gemeinde Wahlscheid eingesetzt. | |
|
30. Juli 1899
Im rechten Bildausschnitt auf dieser Mehrbildkarte wirbt das um 1896 von Johann Hermanns errichtete „Hotel Restaurant zum Aggertal“ – später Gaststätte Johann Schnitzler – um Sommergäste. Auf dem Grußfeld unter einer der ältesten Totalansichten von... Im rechten Bildausschnitt auf dieser Mehrbildkarte wirbt das um 1896 von Johann Hermanns errichtete „Hotel Restaurant zum Aggertal“ – später Gaststätte Johann Schnitzler – um Sommergäste. Auf dem Grußfeld unter einer der ältesten Totalansichten von Lohmar, aus östlicher Richtung gesehen, „sendete am 30.7.1899, auf baldiges Wiedersehen, die Mutter, der Bruder Karl sowie der Vater Urlaubsgrüße aus der Sommerfrische an ihre Tochter bzw. an die Schwester Maria Kämmerer z.Zt. im Urselinenkloster Venlo, postlagernd Kaldenkirchen“. Von rechts nach links ist das Hotel mit Fahne auf dem Dach, die Villa Friedlinde, die Waldesruh, im Hintergrund Kirche und Burg, das feste Haus des Eisenmarkts Nr. 20, und einige kleinere Fachwerkgehöfte der Bachstraße, halbverdeckt von Obstbäumen, zu erkennen. | |
Auf diesem Schulfoto von 1934 sind das 7. und 8. Schuljahr mit Lehrer Karl Schmidt auf dem Schulhof vor dem Schulgebäude fotografiert worden. Jeweils von links nach rechts und die Reihen von oben nach unten sieht man in der 1. Reihe: Käthe Reas,... Auf diesem Schulfoto von 1934 sind das 7. und 8. Schuljahr mit Lehrer Karl Schmidt auf dem Schulhof vor dem Schulgebäude fotografiert worden. Jeweils von links nach rechts und die Reihen von oben nach unten sieht man in der 1. Reihe: Käthe Reas, Margarethe Brodesser, Maria Wacker verh. Schüller, Liesel Broicher, Liesel Kümmler, Maria Bouserath, Erna Wagner, Elisabeth Schopp verh. Scheiderich, Gertrud Piller verh. Kiel, Hilde Schwillens und Josef Weier. 2. Reihe: Heinz Müller, Ludwig Halberg, Christine Höndgesberg verh. Barth, Marry Eschbach, Christine Roland, Liesel Rottländer verh. Pauli, Luise Kümmler, Elisabeth Specht, Käthi Scheiderich verh. Altenrath, Leni Haas, Katharina Harnisch, Liesel Schneider verh. Semm und Lehrer Karl Schmidt. 3. Reihe: unbekannt, Willi Klug, Herbert Appold, Käthi Müller, Margarethe Rörig verh. Streichardt, Änni Becker verh. Posten, Käthi Scharrenbroich verh. Frank, Änne Pohl, Gertrud Höndgesberg verh. Weber und Alfred Pape (gefallen). 4. Reihe: Martin Pütz, Hans Roland, Peter Distelrath (gefallen), Josef Becker, Stephan Fischer, Heinz Keller, Erich Klein, Peter Arenz (gefallen), und Peter Dunkel (bei Luftkrieg vermisst). | |
|
1930
- 1935 In dieser aus dem 18. Jahrhundert stammenden Fachwerkhofanlage Lohmar-Heppenberg, Sottenbacher Straße 12, im ehemaligen Rottland, residierte von 1826-1839 der Bürgermeister der ehemaligen Samtgemeinde (auch Gesamtgemeinde genannt) Lohmar, Paul... In dieser aus dem 18. Jahrhundert stammenden Fachwerkhofanlage Lohmar-Heppenberg, Sottenbacher Straße 12, im ehemaligen Rottland, residierte von 1826-1839 der Bürgermeister der ehemaligen Samtgemeinde (auch Gesamtgemeinde genannt) Lohmar, Paul Grames. Das Haupthaus wurde 1728 erbaut und ist in der bauhistorischen Gegenüberstellung mit dem Vogtshof in Lohmar, Bachstraße 7, hinsichtlich des äußeren Erscheinungsbilds zu vergleichen. Das Foto entstand etwa Anfang bis Mitte der 1930er Jahre. | |
Diese Fotografie aus den 30er Jahren zeigt im Vordergrund einen Teil der Buchbitze, vom Abzweig Mühlenweg aus gesehen. Links das Fachwerkhaus gegenüber der Pilgrams Mühle in der Gewanne „im Mühlengarten“ und rechts ist das Mühlenrad der Pilgrams... Diese Fotografie aus den 30er Jahren zeigt im Vordergrund einen Teil der Buchbitze, vom Abzweig Mühlenweg aus gesehen. Links das Fachwerkhaus gegenüber der Pilgrams Mühle in der Gewanne „im Mühlengarten“ und rechts ist das Mühlenrad der Pilgrams Mühle zu sehen. Im Jahre 1493 erhielten die Besitzer der Burg, die Familie von der Reven, vom Landesherrn, dem Grafen von Berg, das Recht, auf ihrem Grund eine Mühle zu errichten. Von besonderer Bedeutung waren die Zwang- und Bannrechte des Grundherrn, der z.B. seine Hintersassen (die von einem Herrn dinglich abhängig waren) zwang, nur in seiner Mühle mahlen zu lassen, wofür eine Abgabe zu entrichten war. | |
|
1930
- 1935 Eine der bemerkenswerten Postkarten aus der Sammlung Hans-Günter Pick dokumentiert die Neubauphase des Bürgermeisteramtes von Lohmar, Hauptstraße 25, um 1908. Die Karte mit einem Poststempel vom 10.8.1910 zeigt das älteste bekannte Foto des neuen... Eine der bemerkenswerten Postkarten aus der Sammlung Hans-Günter Pick dokumentiert die Neubauphase des Bürgermeisteramtes von Lohmar, Hauptstraße 25, um 1908. Die Karte mit einem Poststempel vom 10.8.1910 zeigt das älteste bekannte Foto des neuen Amtsgebäudes, das gleichzeitig zunächst das Wohnhaus des Bürgermeisters Polstorff war. Der Bau dieses Gebäudes wurde, nach langen Grundsatzdiskussionen unter den Gemeindevertretern, 1906 in Lohmar Ort bewilligt und 1908 fertiggestellt. Zunächst bestanden die Vertreter der Gemeinden Scheiderhöhe, Halberg, Breidt und Inger darauf, den Dienstsitz erneut in Donrath zu errichten. Sie besaßen in der Amtsvertretung eine Mehrheit von einer Stimme. Bürgermeister Polstorff und die Lohmarer Vertreter, konnten jedoch einen Scheiderhöher Vertreter überreden, sich für die fragliche Sitzung krank zumelden. Bei der Patt-Situation (8 : 8) konnte dann Bürgermeister Polstorff mit seiner Stimme als Vorsitzender des Rates den Ausschlag geben, für Lohmarr zu entscheiden. Die ersten Planungen sahen vor, das Amtsgebäude auf dem Grundstück zu errichten, wo das heutige Rathaus steht. Dieses Grundstück lag aber in der 5 km Zone von Siegburg, in der keine Reisespesen anfielen. Der Rat folgte dem Antrag des Bürgermeisters Polstorff, außerhalb der 5 km Zone zu bauen. Hieran wurde noch Jahre nach der Fertigstellung heftige Kritik geübt. Den Rohbau erstellte der Maurermeister Adam van der Viven aus Sottenbach. Da der Baukörper noch unverputzt ist, kann man daraus schließen, dass der Bau gerade fertiggestellt worden ist bzw. die Ausbauarbeiten noch nicht ganz abgeschlossen sind (am Balkon des 1. Obergeschosses fehlt noch das Geländer, wie auch das Treppengeländer des Diensteingangs und der Stabgitterzaun der Grundstücksumwehrung). Im Erdgeschoss waren lediglich zwei Räume für Amtsgeschäfte hergerichtet, ein Dienstzimmer des Bürgermeisters und ein größeres, wahrscheinlich der Anbau im Norden für Angestellte. Die Hauptstraße, mit Blickrichtung Süden bis zur Straßenkrümmung Ecke Kirchstraße, zeigt bereits die noch jungen Lindenbäume, die die Obstbäume zu Anfang des 20. Jahrhunderts ersetzten. Rechts und links der Straße erkennt man noch offene Gräben für das Regenwasser. Die Chaussee hatte noch die zeitgenössische Schotterdecke und eine festgewalzte Sand- oder Feinkiesschicht als Verschleißschicht. Das nächste Haus auf der linken Seite ist der Backsteinbau von Josef Rörig. Hier hat bis zum Abbruch 1997 zum Bau des neuen Stadthauses der ehemalige Kämmerer der Stadt Josef Rörig (II) gewohnt. Ansonsten säumten noch überwiegend Fachwerkbauten die Hauptstraße. Kraftfahrzeuge verkehrten auf der Provinzialstraße noch so gut wie gar nicht, die Straße ist wie leer gefegt. Auf einem Foto aus der Mitte der 1930er Jahre haben sich fast alle Bediensteten der Gemeindeverwaltung auf der Treppe zum Eingang des Bürgermeisteramtes aufgestellt. Der spätere Eingang zum Bürgermeisteramt war um diese Zeit die Haustür zur Privatwohnung von Bürgermeister Polstorff und zur Gemeindekasse. Links durch das Törchen ging es zu einem kleinen Gefängnis, zu dem man über eine Treppe auf der Rückseite des Gebäudes gelangte, die in den Keller führte. In diesem Gefängnis musste einmal in seiner Kinderzeit Raimund Schüller mit seinem Freund Wilfried Priel für ein paar Stunden einsitzen. Hinter dem Amtsgebäude war ein für Kinder beliebter Obstbungert des Landwirts aus der Burg, Heinrich Wasser; dort hatte Polizeimeister Penquitt die beiden beim Äpfelklauen erwischt. | |
Auf dem Foto von etwa 1935 ist die Hauptstraße im Winter zu sehen. Die Blickrichtung ist etwa von der Einmündung der Gartenstraße in Richtung Einmündung der Kirchstraße. Links ist das Kolonialwarengeschäft Urbach (Nr. 82) und daneben das Fachwerkhaus... Auf dem Foto von etwa 1935 ist die Hauptstraße im Winter zu sehen. Die Blickrichtung ist etwa von der Einmündung der Gartenstraße in Richtung Einmündung der Kirchstraße. Links ist das Kolonialwarengeschäft Urbach (Nr. 82) und daneben das Fachwerkhaus Kemmerich (Nr. 80), in dem um diese Zeit die Familie Frembgen wohnte. Dann das Haus des Schusters Matthias Küpper, von dem es auf die Tochter Fine verh. Wimmeroth überging. Daneben ist die Bäckerei Knipp, die von Johann Knipp („de Knepps Hännes“) betrieben wurde. Um 1950 hatte Josef Wingen von Feienberg bei Scheiderhöhe die Bäckerei von der Witwe Maria Knipp gepachtet und Mitte der 1960er Jahre auf der anderen Seite der Hauptstraße 99 eine neue Bäckerei mit Café gebaut. Die Bäckerei Knipp hatte einen sogenannten „Königswinterer Ofen“, etwas ganz Besonderes unter den Backöfen. Dahinter ist das Haus des Theo Schopp und traufseitig an der Hauptstraße das Gemischtwarengeschäft Christine Müller („et Möllesch Stinsche“) zu erkennen. | |
Dieses Foto aus der Zeit des Autobahnbaus 1936, die endgültige Fertigstellung erfolgte 1937 vermittelt einen Eindruck der Anfänge der Bebauung Altenrather Straße, mit Blick von der Aggerschleife unterhalb des Scharfe- und Ziegenbergs auf das... Dieses Foto aus der Zeit des Autobahnbaus 1936, die endgültige Fertigstellung erfolgte 1937 vermittelt einen Eindruck der Anfänge der Bebauung Altenrather Straße, mit Blick von der Aggerschleife unterhalb des Scharfe- und Ziegenbergs auf das Oberdorf. Zu sehen ist im Vordergrund von rechts nach links: Haus Eschbach, Bürvenich, Ennebach, alle Baujahr 1937/38. Etwas zurückliegend am Breidter Weg standen die Häuser der Familien van der Viefen und Krieger („et Aapehus“; Herr Krieger verfügte über ein Varieté-Programm aus verschiedenen Darbietungen mit Affen. Leider sind ihm die Affen, anlässlich einer auswärtigen Veranstaltung alle verbrannt). Es folgen die Häuser Ningelgen, Wasserfuhr, Sauer/Schönenborn und Grützenbach, ebenfalls 1937-38 gebaut und mit den Häusern Thron und Zimmermann (etwa 1930 gebaut) endete zunächst die Altenrather Straße. Ab da verlief einer der vielen Verbindungswege, die sogenannten Pädchen, zum heutigen Wiesenpfad und den Häusern Hauptmann, Ossendorf und Lohmar. Im Hintergrund ist die Chaussee zur Donrather Kreuzung mit dem Jabachshof und noch weiter östlich der Hauptstraße rechts das Kreuelsfeld mit den Häusern „auf die Hardt“ und der „Greilsberg“ zu sehen. | |
Die nationalsozialistische Propaganda stellte den Autobahnbau als eine wichtige Maßnahme zur versprochenen Beseitigung der Arbeitslosigkeit dar. Nach heutigen Erkenntnissen wirkte sich das Bauprogramm auf die Arbeitslosigkeit jedoch nur unbedeutend... Die nationalsozialistische Propaganda stellte den Autobahnbau als eine wichtige Maßnahme zur versprochenen Beseitigung der Arbeitslosigkeit dar. Nach heutigen Erkenntnissen wirkte sich das Bauprogramm auf die Arbeitslosigkeit jedoch nur unbedeutend aus. Wie dieses Bild zeigt, zerschnitt die Trasse des dritten Bauabschnitts Köln-Siegburg der Reichsautobahn die axiale Verbindung der Burg mit dem Kirchdorf Lohmar brutal in zwei Teile. Das Foto entstand 1936/37 kurz vor Eröffnung dieser Teilstrecke oder kurz danach. Rechts ist das einzelstehende Haus des Rechtsanwalts Diethelm Schmitz „Haus Aggerhof“ zu sehen, links die Burg und der Bachhof. Nach Übergabe der Reichsautobahn Köln – Frankfurt wurde die Verbindungsstraße Lohmar – Altenrath weiter südlich über eine neue Brücke der Autobahn verlegt. Die Flur I „Rörigsiefen“ und Flur II genannt „Im Auelsfeld“ sind noch vollkommen unbebaut. In Bildmitte erkennt man die Chaussee zwischen Siegburg und Donrath und die Häuser des Unterdorfs. Rechts des Auelsbachs die Fassfabrik Paul Pfennig. Rechts im Bild am Horizont sind der Michaelsberg und die St. Annokirche in Siegburg und dahinter im Dunst das Siebengebirge schwach zu erkennen. | |
Auf dem Foto aus dem Jahr 1937 sieht man einige Karnevalszug-Teilnehmer, die nach dem Umzug auf dem Heimweg über die Bachstraße von einer Schar Kinder begleitet werden. Der ältere Mann mit Hut und Fahrradkarre ist Willi Höndgesberg. Im Hintergrund... Auf dem Foto aus dem Jahr 1937 sieht man einige Karnevalszug-Teilnehmer, die nach dem Umzug auf dem Heimweg über die Bachstraße von einer Schar Kinder begleitet werden. Der ältere Mann mit Hut und Fahrradkarre ist Willi Höndgesberg. Im Hintergrund der erste Steg über den noch offenen Lauf des Auelsbaches ist der Zugang zum Haus Lehr (heute Heinrich, Ecke Bachstraße 22/Steinhöferweg), links im Bild mit Scheune. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Haus Lehr um den ehemaligen Steinhof handelt, da dieses das einzige Haus weit und breit im Bereich der Urflurkarte von 1823 "Bürgermeisterei und Gemeinde Lohmar" in der Gewanne "Steinhöfers Garten" ist. Nach dem Verzeichnis der Gebäude und ihres Reinertrags (von 1821) Flur III, Name der Gewanne: "Steinhöfer Garten", Flurstück 255 ist der Name des Eigentümers oder Nutznießers: Müller, Peter zu Lohmar. Wie der Eigentumsübergang zu den späteren Nutzern Lehr erfolgte ist nicht bekannt. Der Steinhöferweg hat seinen Namen von dem ehemaligen Anwesen Steinhof. Über die schmale Brücke in den Steinhöfer Weg gibt es folgende Geschichte zu erzählen: Josef Wingen führte nach dem Krieg die ehemalige Bäckerei von Johann Knipp (nahe der evangelischen Kirche, dort wo heute die Videothek ist, Hauptstraße 76). Bertram Hagen war 1956 bei ihm als Geselle angestellt. Zu der Zeit war es noch üblich, dass morgens die Brötchen den Kunden zugestellt wurden. Bertram Hagen fuhr mit dem Geschäftsfahrrad die Brötchen aus, hatte es eilig und deshalb die Kurve von dem Brückchen in die Bachstraße nicht richtig eingeschätzt und landete mit dem Fahrrad halb am Bachufer und halb im Bach, so dass die wertvolle Fracht in den Auelsbach fiel. „Am Achnitz“ (Ecke Bachstraße/Hauptstraße) war die Bushaltestelle der Linie Siegburg – Overath, wo viele Leute am Morgen auf den Bus warteten. Diese waren erstaunt und amüsierten sich, als viele aufgeweichte dicke Brötchen auf dem Wasser schwammen. Der zweite Steg auf dem Foto von 1937 ist die damals ungefähr einen Meter breite Brücke zum Anwesen Schmitz und in den Steinhöfer Weg. Die Familie Schmitz führte später das Lebensmittelgeschäft an der Hauptstraße 38, später „Edeka-Markt“ Heinen und ab 1995 „Schreib-Lese-Spiel-Centrum Mitschinski“ - heute sind in den Gebäuden andere Nutzungen. | |
Das Foto von 1937 zeigt Kinder am Bachrand des leider heute verrohrten Dorfbaches (Auelsbach) auf der Bachstraße in Höhe des Hauses Lehr. Der Bachlauf ist noch offen und das Gelände bis zur Gartenstraße (bei den Einheimischen auch... Das Foto von 1937 zeigt Kinder am Bachrand des leider heute verrohrten Dorfbaches (Auelsbach) auf der Bachstraße in Höhe des Hauses Lehr. Der Bachlauf ist noch offen und das Gelände bis zur Gartenstraße (bei den Einheimischen auch „Kammesöhlschesjass“ genannt) war freies Feld. Von links nach rechts sind Marlies Rottländer, Loni Keuler, Johannes Keuler, Hans Josef Rottländer, Fritz Kurtsiefer, Josef Steimel, Anneliese Keuler und Reiner Sieben mit Puppenwagen zu sehen. | |
|
1937
- 1938 Früher hatten viele noch ein eigenes Stück Acker, das bewirtschaftetet wurde, um die Familie ernähren zu können. Meist wurden dort Kartoffeln angebaut. Auf dem Foto von 1937 oder 1938 macht die Familie Becker eine Pause bei der Kartoffelernte und... Früher hatten viele noch ein eigenes Stück Acker, das bewirtschaftetet wurde, um die Familie ernähren zu können. Meist wurden dort Kartoffeln angebaut. Auf dem Foto von 1937 oder 1938 macht die Familie Becker eine Pause bei der Kartoffelernte und verzehrt die mitgenommenen Butterbrote. Zum Schluss wurde meist das trockene Kartoffellaub zusammengeharkt und damit das sogenannte „Kartoffelfeuer“ angezündet und in der Glut Kartoffeln gebacken. Darauf freuten sich die Kinder am meisten. | |
Auf dieser Vierbildkarte aus dem Jahre 1938 ist links oben der Dorfkern des eigenständigen Heidedorfs, rund um die Kirche zu sehen, rechts die Kirchstraße, die heutige Flughafenstraße, die als Verbindungsstraße von Osten nach Westen, also vom Sülztal... Auf dieser Vierbildkarte aus dem Jahre 1938 ist links oben der Dorfkern des eigenständigen Heidedorfs, rund um die Kirche zu sehen, rechts die Kirchstraße, die heutige Flughafenstraße, die als Verbindungsstraße von Osten nach Westen, also vom Sülztal Richtung Troisdorf verlief, links unten die Rambuscher Straße, die Ausfallstraße nach Lohmar und rechts unten das Gräberfeld der Wahner Heide mit ungefähr 700 Grabhügeln und etwa 1000 Bestattungen zwischen Hohe Schanze und Boxhohn mit einer Urne aus der Keltenzeit zu sehen (Hinweis auf eine Zeit um 400 v. Chr.). Wer konnte schon ahnen, dass im gleichen Jahr, das auch der Poststempel aufweist, das Dorf gänzlich, teilweise sogar auch gewaltsam geräumt und ausgesiedelt werden würde? Heute sind viele Alteingesessene, vermischt mit Neubürgern, zurückgekehrt und haben neu gebaut. Allerdings gehört Altenrath seit 1969 durch eine kommunale Neuordnung zu Troisdorf. | |
Im Jahre des 200-jährigen Kirchenjubiläums wurde diese Aufnahme gemacht. Es hält die wesentlichen baulichen Merkmale der im Jahre 1738 erbauten Kirche fest. Die umfassende Renovierung fand in den 50er und 60er des letzten Jahrhunderts statt. Im Jahre des 200-jährigen Kirchenjubiläums wurde diese Aufnahme gemacht. Es hält die wesentlichen baulichen Merkmale der im Jahre 1738 erbauten Kirche fest. Die umfassende Renovierung fand in den 50er und 60er des letzten Jahrhunderts statt. | |
|
1935
- 1939 Die Lohmarer Messdiener Ende der 1930er Jahre vor dem Haupteingang zur Pfarrkiche St. Johannes Enthauptung: Von links nach rechts, obere Reihe: Hans Liesenfeld, Hans Braschoß, Richard Krauthäuser, Felix Schönenborn und ? Faßbender (wohnte im heutigen... Die Lohmarer Messdiener Ende der 1930er Jahre vor dem Haupteingang zur Pfarrkiche St. Johannes Enthauptung: Von links nach rechts, obere Reihe: Hans Liesenfeld, Hans Braschoß, Richard Krauthäuser, Felix Schönenborn und ? Faßbender (wohnte im heutigen HGV-Haus im Park Friedlinde). Mittlere Reihe: Peter Schneider, Willi Urbach, Rudi Kappes (mit Glatze) und Erwin Henseler. Vordere Reihe: Theo Dunkel, Hubert Hagen, Friedrich Ramme, Richard Ramme und Karl Thron. | |
|
1935
- 1939 Die Scheiderhöher Straße, der Ortskern von Scheiderhöhe etwa Ende der 1930er Jahre. Die lange Zeit sogenannte „Freiheit Scheiderhöhe“ unterstand dem Amt Porz (Freiheit bedeutet Immunität = Schutz, deutet auf die Art der Gerichtsbarkeit hin) und... Die Scheiderhöher Straße, der Ortskern von Scheiderhöhe etwa Ende der 1930er Jahre. Die lange Zeit sogenannte „Freiheit Scheiderhöhe“ unterstand dem Amt Porz (Freiheit bedeutet Immunität = Schutz, deutet auf die Art der Gerichtsbarkeit hin) und gehörte lange Zeit zum Kirchspiel Altenrath sowie mit dem südöstlichen Teil der Gemeinde zum Kirchspiel Lohmar. Die Ansiedlung in der Form des Straßendorfs war ursprünglich ländlich orientiert. | |
Das Haus Nr. 4, der „Gasthof Weeg“ mit Saal, Inhaber Hugo Weeg (später Faßbender), ist heute das renommierte Speiselokal „Gasthaus Scheiderhöhe“, Scheiderhöher Straße 49, Inhaber Rolf Schütte. Die Aufnahme zeigt das traufständige Fachwerkhaus mit... Das Haus Nr. 4, der „Gasthof Weeg“ mit Saal, Inhaber Hugo Weeg (später Faßbender), ist heute das renommierte Speiselokal „Gasthaus Scheiderhöhe“, Scheiderhöher Straße 49, Inhaber Rolf Schütte. Die Aufnahme zeigt das traufständige Fachwerkhaus mit riesiger Rosskastanie und Außengastronomie etwa um 1940. | |
Der 1900 gebildete Kyffhäuserbund (auch Kriegerverein genannt, hieß ab 1938 NS-Reichskriegsbund „Kyffhäuser“ e.V.) war ein Verein ehemaliger Soldaten, der militärische Tradition und Kameradschaft pflegte, sowie ihren verstorbenen Mitgliedern und... Der 1900 gebildete Kyffhäuserbund (auch Kriegerverein genannt, hieß ab 1938 NS-Reichskriegsbund „Kyffhäuser“ e.V.) war ein Verein ehemaliger Soldaten, der militärische Tradition und Kameradschaft pflegte, sowie ihren verstorbenen Mitgliedern und ehemaligen Soldaten ein ehrenvolles Grabgeleit gab. Er ist benannt nach dem Kyffhäusergebirge südlich des Unterharzes. Auf ihm wurde um 1895 das Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal errichtet. Nach der Sage lebt in dem Gebirge Kaiser Friedrich Barbarossa (geb. um 1125, gest. am 10.6.1190). Peter Kemmerich schreibt darüber: „In Lohmar wurden die Veranstaltungen des Kriegervereins immer groß aufgezogen. Fackelzug mit Böllerschüssen am Vorabend, gemeinsamer Kirchgang mit Musik am Festtage und nachmittags großer Festzug durch den mit Fahnen und Triumphbögen geschmückten Ort mit einer anschließenden großen Tanzveranstaltung. Lange Reden auf Vaterland, Kaiser und Reich waren selbstverständlich. Nach dem Ersten Weltkrieg flackerte der Kriegerverein noch einmal auf und verlosch nach dem Zweiten Weltkrieg“ (Meine Heimatgemeinde, S. 48). | |
Die 1941 aus der Volksschule Lohmar entlassenen Jungen haben sich für ein Foto vor der Friedhofsmauer in der Kirchstraße aufgestellt. Von links nach rechts und die Reihen von oben nach unten sieht man: 1. Reihe: Richard Ramme (Blumengeschäft in der... Die 1941 aus der Volksschule Lohmar entlassenen Jungen haben sich für ein Foto vor der Friedhofsmauer in der Kirchstraße aufgestellt. Von links nach rechts und die Reihen von oben nach unten sieht man: 1. Reihe: Richard Ramme (Blumengeschäft in der Kirchstraße) und Paul Klein. 2. Reihe: Hans Eich, Hubert Hagen, Heinz Kirschbaum und Rudi Specht. 3. Reihe: Hans Köb, Friedrich Ramme, ? Hosp (aus Donrath) und Hans Funken. 4. Reihe: ? Leven (aus Geber). | |
Das Foto zeigt die gepflasterte Hauptstraße mit Bäumen bestanden. Nach der Größe der Linden muss es im Jahr 1945 gewesen sein, im Bereich der Gaststätte „Zur Linde“ mit Außengastronomie. Dieser Chausseecharakter bestimmte das Bild des Ortes bis 1960.... Das Foto zeigt die gepflasterte Hauptstraße mit Bäumen bestanden. Nach der Größe der Linden muss es im Jahr 1945 gewesen sein, im Bereich der Gaststätte „Zur Linde“ mit Außengastronomie. Dieser Chausseecharakter bestimmte das Bild des Ortes bis 1960. Die Asphalt- bzw. Schwarzdecke erhielt die Hauptstraße erst zwischen 1962 bis 1964. Mit der gleichzeitigen Verbreiterung der Straße ging auch die Beseitigung der Baumreihen einher | |
Wehe wenn die sonst so friedliche Agger beim Hochwasser tobte! Überschwemmung Donraths Anfang der 1940er Jahre, mit Blick auf den Heppenberg mit Sottenbach. Im Vordergrund sind von links nach rechts zu erkennen: die Krautfabrik von Johann Weingarten,... Wehe wenn die sonst so friedliche Agger beim Hochwasser tobte! Überschwemmung Donraths Anfang der 1940er Jahre, mit Blick auf den Heppenberg mit Sottenbach. Im Vordergrund sind von links nach rechts zu erkennen: die Krautfabrik von Johann Weingarten, die 1873 erbaute, 1942 noch intakte, gemauerte Aggerbrücke – sie wurde vom Hochwasser zum Einsturz gebracht – Haus Sieberts, der Gasthof „Zur Aggerburg“, und die Gaststätte „Weißes Haus“. Am linken Bildrand zeigt das Foto auf der rechten Aggerseite, im Hintergrund den „Flohberg“, Haus Rottland, an der Straße zum Heppenberg Herchenbachs Haus, die Villa Eugsfeld und Haus Schmitz, bereits im Wasser stehend in Bildmitte, Kleins und Fitlers Fachwerkhäuser, der Kreuzerhof, dahinter Marx, Schwamborn, später Busch und Kleins Häuschen. | |
Die Familie Hagen später Steimel hatte in der Gartenstraße 6 ein kleines Gemischtwarengeschäft, das – später als Rewe – bis Mitte der 1960er Jahre betrieben wurde. Auf dem Foto aus der Mitte der 1940er Jahre ist die Familie Steimel vor ihrem Haus zu... Die Familie Hagen später Steimel hatte in der Gartenstraße 6 ein kleines Gemischtwarengeschäft, das – später als Rewe – bis Mitte der 1960er Jahre betrieben wurde. Auf dem Foto aus der Mitte der 1940er Jahre ist die Familie Steimel vor ihrem Haus zu sehen. Diese kleinen Läden gehörten zum Ortsbild. Ein weiters Foto ist um 1913 aufgenommen. | |
Der Hauptaltar der Lohmarer Pfarrkirche – hier eine Aufnahme von 1947 – ist erst nach der Erweiterung um 1900 angeschafft worden. Vorher war dort ein schlichter Barockaltar mit Säulenaufbau und ein Ölgemälde der Enthauptung Johannes des Täufers vom... Der Hauptaltar der Lohmarer Pfarrkirche – hier eine Aufnahme von 1947 – ist erst nach der Erweiterung um 1900 angeschafft worden. Vorher war dort ein schlichter Barockaltar mit Säulenaufbau und ein Ölgemälde der Enthauptung Johannes des Täufers vom Anfang des 18. Jahrhunderts, das verschollen ist. Ebenfalls verschollen ist eine 118 Zentimeter große Holzfi gur einer weiblichen Heiligen aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die im Turm stand. Der Altartisch war ein Steinaufbau, dem rechts und links zwei Säulen vorgesetzt sind. In der Mitte war ein Relief des apokalyptischen „Lamm Gottes“, das die darunter hängenden sieben Siegel der Apokalypse löste. Rechts und links daneben sind zwei Marmorplatten eingelassen. Auf dem Altar steht der Tabernakel, in dem das Allerheiligste aufbewahrt wird. Dieser deutlich kunstvollere Altar als der heutige ist bei den Renovierungsarbeiten 1965 entsorgt worden. | |
Der Männergesangverein „Frohsinn“ Lohmar hatte schon früh nach dem Krieg seine Tätigkeit wieder aufgenommen, so dass schon im August 1946 unter der Leitung von Martin Kelz ein Konzert veranstaltet werden konnte. Das Foto ist anlässlich des... Der Männergesangverein „Frohsinn“ Lohmar hatte schon früh nach dem Krieg seine Tätigkeit wieder aufgenommen, so dass schon im August 1946 unter der Leitung von Martin Kelz ein Konzert veranstaltet werden konnte. Das Foto ist anlässlich des 50-jährigen Bestehens am 26./27.7.1947 entstanden. Es sind jeweils von links nach rechts und die Reihen von oben nach unten zu sehen: Obere Reihe: Robert Linden, Bernhard Kurscheid, Heinrich Schwellenbach, Martin Schmitz, Werner Hauptmann, Hans Faßbender, Hubert Hoffstadt, Hermann Pelzer und Leo Reich. 2. Reihe: Willi Schüchen, Martin Köb, Karl Schallenberg („de Kahni“), Hubert Schüller, Josef Dreck, Hans Richter, Peter Kurscheid, Josef Pollerhoff, Theo Frey, Heinz Kirschbaum, Hans Köb, Gerhard Schmitz, Bertram Mailänder, Hermann Gierlach, Willi Schneider und Peter Mahlberg. 3. Reihe: Willi Niethen, Heinrich Kurscheid, Albert Piller, Karl Hallberg, Fritz Plinke, Egon Pletsch, Adolf Büvenich, Willi Schmitz, Fritz Brehm, Josef Schmitz, Peter Schneider, Karl Zimmermann, Josef Stöcker („de Wassem“), Bernhard Palm, Heinrich Boddenberg, Jean Müller, Josef Müller, Bernhard Schmidt, Willi Langshausen und Heinrich Hauptmann. Untere Reihe: Peter Klein, Martin Kelz (Chordirektor), Hans Fischer (1. Vorsitzender), Ludwig Polstorff (Bürgermeister i. R., Ehrenvorsitzender), Heinrich Kraus, Johann Klein, Peter Pape und Heinrich Köb. | |
Dieses Foto, aufgenommen im Pfarrgarten, sind die Kommunionkinder-Mädchen von 1947. Von links nach rechts und die Reihen von oben nach unten: 1. Reihe: Hedi Zimmermann verh. Rämisch, Waltraud Scheiderich verh. Ennenbach, Renate Frost verh. Rosenau... Dieses Foto, aufgenommen im Pfarrgarten, sind die Kommunionkinder-Mädchen von 1947. Von links nach rechts und die Reihen von oben nach unten: 1. Reihe: Hedi Zimmermann verh. Rämisch, Waltraud Scheiderich verh. Ennenbach, Renate Frost verh. Rosenau und Magdalene Schülke verh. Hackert. 2. Reihe: unbekannt, unbekannt, Christel Piller verh. Doktor und Liesel Becher. 3. Reihe: Erika Frey verh. Adrian, Hannelore Auweiler verh. Köhler, Sophi Schultes, Hilde Funken verh. Söntgerath, Maria Stöcker, Viktoria Eberle verh. Kaiser, Marianne Hagen verh. Kaiser und Hilde Höndgesberg verh. Kappes. 4. Reihe: Marlies Burger verh. Bauer, Ingrid Schmitz verh. Kribben, Margret Lohmar verh. Eschbach, Käthe Kürten, Ida Witsch, Edeltraud Groß verh. Schäfer und Christel Braschoß verh. Böhmer. | |
|
1950
Die Foto zeigt den Turm und das Langhaus der Kirche St. Georg aus Altenrath. Auf dem Foto um 1950 ist der Eingang, ein schlichtes Stichbogenportal, zu sehen. Der Zugang zur Kirche verläuft über einen alleeartigen Fußweg von der heutigen... Die Foto zeigt den Turm und das Langhaus der Kirche St. Georg aus Altenrath. Auf dem Foto um 1950 ist der Eingang, ein schlichtes Stichbogenportal, zu sehen. Der Zugang zur Kirche verläuft über einen alleeartigen Fußweg von der heutigen Flughafenstraße im Kirchdorf über den Friedhof. Die ältesten Grabsteine des die Kirche von Altenrath umgebenden Kirchhofs, stammen aus dem 17. Jahrhundert. Die gänzliche Aussiedlung des Heidedorfs im Rahmen der Schießplatzerweiterung Wahner Heide, mit einer militärischen Sonderregelung zum Besuch der Kirche oder des Friedhofs mehrmals im Jahr, vollzog sich 1938. | |
Die Villa Therese wurde 1896 von dem Kölner Gabriel Erven gebaut. Die Nutzung des Gebäudes wechselte häufig. Inhaber war von 1910 bis in die 1920er Jahre Joseph Pult, der am 8.4.1910 die Konzession erhielt, im Hause Nr. 149 (Hauptstraße) in Lohmar... Die Villa Therese wurde 1896 von dem Kölner Gabriel Erven gebaut. Die Nutzung des Gebäudes wechselte häufig. Inhaber war von 1910 bis in die 1920er Jahre Joseph Pult, der am 8.4.1910 die Konzession erhielt, im Hause Nr. 149 (Hauptstraße) in Lohmar eine Schank- und Gastwirtschaft ohne Erweiterung und Einschränkung zu betreiben. Ab 1926 war die Villa in der Nachnutzung des Hotelbetriebes, Eisenbahner-Erholungsheim der ReichsbahnBetriebskrankenkasse Elberfeld. Anfang der 1930er Jahre weilten dort während der Sommermonate erholungsbedürftige Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren für jeweils vier Wochen zur Kur. Danach wohnte dort von Mai 1945 bis Ende 1946 die Familie Klug, die im Bahnhofsgebäude 1945 ausgebombt wurde. Später war es ein sogenanntes Leichtkrankenhaus, in dem sich heimgekehrte Eisenbahner wieder erholen konnten, eine Art REHA-Anstalt für Kriegsheimkehrer und andere. Anschließend wurde das Haus als Bergmann-Erholungsheim genutzt und vor der Übernahme durch die Stadt Lohmar im Jahre 1985 war hier die Poltische Akademie Lohmar als Bildungsstätte des „Kuratoriums Unteilbares Deutschland“ untergebracht. Die Stadt Lohmar baute die Villa Therese um, um dort die Stadtbücherie unterzubringen. | |
Blick von Osten auf Schloss Auel, im Hintergrund Windlöck, Anfang der 50er Jahre. Seit der Heirat von Philippe de la Valette mit Franziska von Broe im Jahre 1818 befi ndet sich Schloss Auel im Besitz der Familie von la Valette St. George. Ein... Blick von Osten auf Schloss Auel, im Hintergrund Windlöck, Anfang der 50er Jahre. Seit der Heirat von Philippe de la Valette mit Franziska von Broe im Jahre 1818 befi ndet sich Schloss Auel im Besitz der Familie von la Valette St. George. Ein berühmter Urahn war der Großmeister des Johanniter- und Malteser Ordens Jean de la Valette, der die Insel Malta 1565 erfolgreich gegen die Osmanen verteidigte. Ihm zu Ehren wurde die Hauptstadt der Insel Malta „Valetta“ genannt. | |
Auf dem Foto ganz rechts ist die Post im Hause Henkel (Poststraße 2) zu sehen, das etwa 1928 erbaut wurde. In ihm hat Josef Henkel bis um 1950 einen kleinen Postschalter betrieben, der von Werner Trautmann und Heinz Otto weitergeführt wurde. Da die... Auf dem Foto ganz rechts ist die Post im Hause Henkel (Poststraße 2) zu sehen, das etwa 1928 erbaut wurde. In ihm hat Josef Henkel bis um 1950 einen kleinen Postschalter betrieben, der von Werner Trautmann und Heinz Otto weitergeführt wurde. Da die Räumlichkeiten zu klein wurden, ist die Post etwa 1956/57 in das neu gebaute Haus Schultes an der Hauptstraße – links neben der Bäckerei Liesenfeld – umgezogen. Dort sind heute die „Lohmarer Höfe“.
| |
Das „Haus Hasselssiefen“ in der Kuttenkaule Anfang der 1950er Jahre. Das ganze Gelände zwischen Kuttenkauler Weg und In der Falmerswiese (nicht sichtbar im Vordergrund) ist noch unbebaut. Neben „Haus Hasselssiefen“ im Hintergrund ist das Haus Limbach... Das „Haus Hasselssiefen“ in der Kuttenkaule Anfang der 1950er Jahre. Das ganze Gelände zwischen Kuttenkauler Weg und In der Falmerswiese (nicht sichtbar im Vordergrund) ist noch unbebaut. Neben „Haus Hasselssiefen“ im Hintergrund ist das Haus Limbach zu erkennen. | |
Das Foto zeigt „Haus Aggerhof“ mit den landwirtschaftlichen Nebengebäuden in den 1950er Jahren aus der Vogelperspektive. Wilhelm Schmitz, Sohn des Johann Schmitz, stammt aus dem Schmitz-Hof Ecke Bachstraße/Steinhöfer Weg (heute Bachstraße 20). Er... Das Foto zeigt „Haus Aggerhof“ mit den landwirtschaftlichen Nebengebäuden in den 1950er Jahren aus der Vogelperspektive. Wilhelm Schmitz, Sohn des Johann Schmitz, stammt aus dem Schmitz-Hof Ecke Bachstraße/Steinhöfer Weg (heute Bachstraße 20). Er lernte auf dem Amt in Lohmar das Verwaltungswesen und ging dann ins Westfälische. Es zog ihn jedoch wieder zurück nach Lohmar und er baute 1934 nahe der Mündung des Auelsbaches in die Agger das „Haus Aggerhof“. Dort betrieb er von 1937 bis etwa 1959/60 mit seiner Ehefrau Elly geb. Beckhoff und später mit Hilfe seines Sohnes Diethelm Schmitz einen Bauernhof. Die Nebengebäude wurden nach Aufgabe der Landwirtschaft niedergelegt. Bis zu seinem Tod 2013 wohnte Diethelm Schmitz und seine Familie in dem Haupthaus. Er führte in Siegburg eine Rechtsanwakltskanzlei und war vor der kommunalen Neuordnung 1969 Mitglied des Rates der Gemeinde Lohmar. | |
Um der größten Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg gerecht zu werden, gründete Pfarrer Wilhelm Müller 1950 die Siedlergemeinschaft Neuhonrath. Erzbischof Kardinal Dr. Joseph Frings übernahm die Grundsteinlegung für 23 Siedlungshäuser. Die... Um der größten Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg gerecht zu werden, gründete Pfarrer Wilhelm Müller 1950 die Siedlergemeinschaft Neuhonrath. Erzbischof Kardinal Dr. Joseph Frings übernahm die Grundsteinlegung für 23 Siedlungshäuser. Die Grundstücke wurden von der katholischen Kirchengemeinde Neuhonrath in Erbpacht an katholische Familien vergeben. Die ersten Häuser konnten schon im März 1951 bezogen werden. Weitere Bauabschnitte folgten. Die Rohbauten an der heutigen Pfarrer-Tholen-Str. kann man am rechten Bildrand erkennen | |
1803 errichtete man in Scheiderhöhe eine Kapelle zum „Heilig Kreuz“, die 1805 geweiht wurde und 1866 nach der Pfarrerhebung als Pfarrkirche diente. 1911 wurde der Grundstein zum Bau der heutigen einschiffigen, neuromanischen Pfarrkirche... 1803 errichtete man in Scheiderhöhe eine Kapelle zum „Heilig Kreuz“, die 1805 geweiht wurde und 1866 nach der Pfarrerhebung als Pfarrkirche diente. 1911 wurde der Grundstein zum Bau der heutigen einschiffigen, neuromanischen Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“ gelegt, deren Einweihungsfeier 1913 stattfand. Die alte Kapelle wurde 1926 bis auf den Chor und Teile der Sakristei niedergelegt. Diese sind zu dem auf dem Foto der 1950er Jahre ersichtlichen Kriegerdenkmal für die Toten beider Weltkriege ausgebaut worden. Das Ehrenmal fand seine Einweihung am 13.10.1929. | |
Das Hotel-Restaurant-Café wurde Anfang der 50er Jahre gebaut. Es gehörte bis in die 90er Jahre zu den ersten Adressen in der Stadt Lohmar. Das Gebäude steht am östlichen Rand von Honrath. Von hier hat man einen herrlichen Blick ins Aggertal. Seit... Das Hotel-Restaurant-Café wurde Anfang der 50er Jahre gebaut. Es gehörte bis in die 90er Jahre zu den ersten Adressen in der Stadt Lohmar. Das Gebäude steht am östlichen Rand von Honrath. Von hier hat man einen herrlichen Blick ins Aggertal. Seit einigen Jahren wird auch dieses Haus als Wohnhaus genutzt. Damit gibt es in Honrath, mit heute 1528 Einwohnern, einem der größten Orte unserer Stadt, keine Gaststätte mehr. | |
|
1953
Auf diesem Foto kehrt 1953 oder 1954 die Fronleichnamsprozession zur Kirche zurück. Die Aufnahme ist vor der Einmündung der Altenrather Straße in die Kirchstraße mit Blick in Richtung Hauptstraße gemacht worden. Rechts ist das neuere Gebäude der... Auf diesem Foto kehrt 1953 oder 1954 die Fronleichnamsprozession zur Kirche zurück. Die Aufnahme ist vor der Einmündung der Altenrather Straße in die Kirchstraße mit Blick in Richtung Hauptstraße gemacht worden. Rechts ist das neuere Gebäude der alten Volksschule zu sehen, in dem Lehrer Josef Schmitz mit seiner Familie wohnte, links die Gärtnerei Heinrich Ramme, dahinter das neue Haus Schmitz noch im Rohbau und dahinter die Dachgauben der Häuser Pape und Raßmes. Der „Himmel“ wird von Mitgliedern des Junggesellenvereins getragen: links vorne Fritz Kurtsiefer und links hinten Johannes Pohl. Hinter dem linken Geistlichen ist als Messdiener Josef Faßbender zu erkennen. Der rechte Geistliche ist Dr. Peter Bernhard Kallen und links daneben Dechant Dr. Johannes Becker. Im Vordergrund im schwarzen Anzug sieht man Johannes Hagen. Die Messdiener von links nach rechts sind mit Banner Hans Dieter Heimig, davor mit einer kleinen Schelle Norbert Bois, dann ebenfalls mit Schelle Karli Wagner, dann Klaus Borchert und ganz rechts Horst Roland. | |
|
1954
Toni Ley war vom 15.3.1950 bis Mai 1960 Kaplan in Lohmar. Er hatte Anfang der 1950er Jahre in Lohmar das Eiersammeln der Messdiener mit einer Klapper oder Klepper eingeführt. Die Holzklapper dient in der Kirche als Ersatz für die Schellen, die, wie... Toni Ley war vom 15.3.1950 bis Mai 1960 Kaplan in Lohmar. Er hatte Anfang der 1950er Jahre in Lohmar das Eiersammeln der Messdiener mit einer Klapper oder Klepper eingeführt. Die Holzklapper dient in der Kirche als Ersatz für die Schellen, die, wie auch die Glocken, von Gründonnerstag bis zur Osternacht wegen der Trauer um den Tod Christi verstummen (im Volksmund „Die Glocken sind nach Rom geflogen“). Mit solchen Holzklappern zogen die Messdiener dann durch Lohmar, wünschten den Pfarrangehörigen ein frohes Osterfest und baten um ein paar Hühnereier. Die Gabe sollte ein kleines Dankeschön sein für den Dienst der Messdiener in der Kirche. Auf dem Bild von 1954 vor dem Fotogeschäft von Willy Küpper in der Kirchstraße 4 sind zu sehen, jeweils von links nach rechts: hinten Horst Roland, Bernd Schmidt und Heinz Wering; in der Mitte Karl Heinz Raßmes, Karl Josef Kappes, Hans Dieter Heimig, Karl Heinz Höndgesberg, Franz Peter Halberg, Michael Theus und Horst Zanker; vorne Dieter Knipp, Hans Josef Höndgesberg, Hans Willi Müller, Manfred Wacker und Hans Gert Kraheck. | |
|
1950
Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde das Hotel Hauptstraße 60 von Sohn Peter Schnitzler aus den alten Ziegelsteinen wieder aufgebaut. Die Fotografie von 1950 zeigt den unverputzten Baukörper. Im Rahmen der Stadtkernsanierung „Lohmarer Höfe“... Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde das Hotel Hauptstraße 60 von Sohn Peter Schnitzler aus den alten Ziegelsteinen wieder aufgebaut. Die Fotografie von 1950 zeigt den unverputzten Baukörper. Im Rahmen der Stadtkernsanierung „Lohmarer Höfe“ wurde diese Gebäude abgerissen. Ebenso erging es dem Haus Hauptstraße 58a-b, dem alten „Schultes´ Haus“ und einigen anderen Häusern in diesem Bereich. Vorher im Jahr 2000 erwarb die Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Lohmar mbH (WFEG) von der Erbengemeinschaft Schultes die angrenzenden Grundstücke. Deren Planung schloss auch das Privatgrundstück der Familie Schnitzler an der Kirchstraße mit ein. | |
Diese Fotografie zeigt das Lohmarer Kirchdorf in den 1950-60er Jahren, eine Perle für den Denkmalschutz, als Ensemble aus südwestlicher Sicht. Immer wieder berichten Geschichtsquellen von diesen einzelnen Fachwerkhöfen, deren Altersbestimmung und... Diese Fotografie zeigt das Lohmarer Kirchdorf in den 1950-60er Jahren, eine Perle für den Denkmalschutz, als Ensemble aus südwestlicher Sicht. Immer wieder berichten Geschichtsquellen von diesen einzelnen Fachwerkhöfen, deren Altersbestimmung und baulichen Besonderheiten, über den Verlauf und die Veränderung der Straßenführung zur Burg, oder von Kuriositäten aller Jahrhunderte dieses Dorfteils. Im Vordergrund von links nach rechts: Haus Müller, der Pützerhof mit Nebengebäude, der Neuhof und im Hintergrund die katholische Kirche unverputzt. | |
Aufgenommen wurde diese Fotografie in südlicher Richtung auf der Brücke Lohmar/Altenrath. Das Bild zeigt die Bundesautobahn A3 (Köln – Frankfurt), die 1937 als Reichsautobahn gebaut wurde. Das Fahrzeug aufkommen war noch überschaubar. Die Begriffe... Aufgenommen wurde diese Fotografie in südlicher Richtung auf der Brücke Lohmar/Altenrath. Das Bild zeigt die Bundesautobahn A3 (Köln – Frankfurt), die 1937 als Reichsautobahn gebaut wurde. Das Fahrzeug aufkommen war noch überschaubar. Die Begriffe „Umweltverschmutzung und Verkehrsinfarkt“ der Gegenwart gab es noch nicht. Im März 1936 erfolgte der erste Spatenstich für den Bau des dritten Bauabschnitts Köln – Siegburg. Am 17.12.1937 war die Eröffnung der Teilstrecke, die zweispurig geplant und ausgeführt wurde. | |
Am Sonntag, dem 4.7.1954, wurde die Marienkirche in Donrath durch den Hochwürdigen Herrn Weihbischof Cleven unter der Bezeichnung der „Heimsuchung Mariens“ konsekriert (geweiht). Nach dem Festgottesdienst hatten sich die beteiligten Messdiener am... Am Sonntag, dem 4.7.1954, wurde die Marienkirche in Donrath durch den Hochwürdigen Herrn Weihbischof Cleven unter der Bezeichnung der „Heimsuchung Mariens“ konsekriert (geweiht). Nach dem Festgottesdienst hatten sich die beteiligten Messdiener am Eingang der Marienkirche für ein Foto aufgestellt. Von links nach rechts; vordere Reihe: Karl Heinz Raßmes, Bernd Schmidt, Karl Josef Kappes, Manfred Wacker, Hans Dieter Heimig; hintere Reihe: Walter Burger, Helmut Busch, Ewald Tolksdorf, Josef Eschbach und Franz Josef Burger. | |
Das Foto von 1955 zeigt die Kirchstraße von den Bahngleisen in Richtung Einmündung Altenrather Straße. Ganz rechts ist der Eingang zum Grundstück Schnitzler und hinter den Bahngleisen das Haus Raßmes (Kirchstraße 4), das 1913 errichtet wurde. Dort... Das Foto von 1955 zeigt die Kirchstraße von den Bahngleisen in Richtung Einmündung Altenrather Straße. Ganz rechts ist der Eingang zum Grundstück Schnitzler und hinter den Bahngleisen das Haus Raßmes (Kirchstraße 4), das 1913 errichtet wurde. Dort führt Hans Dieter Heimig seine kleine Schwester Marlene an der Hand spazieren. Auf der linken Seite ist das Mietshaus der Baustoffhandlung Knipp, in dem lange Jahre der Friseur Josef Spürk arbeitete und daneben das Schreibwarengeschäft Gogol. Vor Gogol war dort das Hitlerjugendheim und davor die Lebensmittelgenossenschaft „Eintracht“. Die „Eintracht“ ist dann umgezogen in das Haus Henkel, Hauptstraße 65, (Ecke Hauptstraße/Poststraße), und nannte sich später „Konsum“. Hinter dem Haus Knipp sieht man die beiden Gebäude der Volksschule Lohmar. Zwischen dem Haus Knipp und dem Volksschulgebäude – ein schmaler Gebäudeteil, der etwas vorkragt – war die Wohnung von Lehrer Hermann Bollmann. | |
Hier sind die Kirchenchorfrauen bei einer Prozession 1955 oder 1956 auf der Hauptstraße zu sehen; von links nach rechts: Irene Keymer verh. Henseler, Maria Ulrich, Else Ramme, Hanni Meisenbach verh. Overath, Marianne Netzer, Käthe Meiger verh. Hagen,... Hier sind die Kirchenchorfrauen bei einer Prozession 1955 oder 1956 auf der Hauptstraße zu sehen; von links nach rechts: Irene Keymer verh. Henseler, Maria Ulrich, Else Ramme, Hanni Meisenbach verh. Overath, Marianne Netzer, Käthe Meiger verh. Hagen, Margret Lohmar verh. Eschbach, Christel Breidt, Ellen Postertz verh. Trompetter und Elisabeth Scheiderich geb. Schopp. | |
Hier haben sich die Jungen des Jahrgangs 1941/42 bei der Schulentlassungsfeier am 21.3.1956 vor dem Gasthaus „Zur alten Fähre“ für ein Erinnerungsfoto aufgestellt. Um diese Zeit fanden die Einschulungen und Entlassungen noch zu Ostern statt. Auf dem... Hier haben sich die Jungen des Jahrgangs 1941/42 bei der Schulentlassungsfeier am 21.3.1956 vor dem Gasthaus „Zur alten Fähre“ für ein Erinnerungsfoto aufgestellt. Um diese Zeit fanden die Einschulungen und Entlassungen noch zu Ostern statt. Auf dem Foto sind als Lehrpersonen Rektor Karl Schmidt, Konrektor Josef Grunenberg und Lehrer Josef Schmitz zu sehen. Dieser Jahrgang war der zweite, der aus der neuen Waldschule entlassen wurde, in der das vierte und achte Schuljahr unterrichtet wurde. Die anderen Schuljahre blieben noch in der alten Schule in der Kirchstraße. 1 Rektor Karl Schmidt, 2 Hans Josef Höndgesberg, 3 Dieter Lempe, 4 ?, 5 Willi Koser, 6 Hans Gustav Ruhrmann, 7 Hans Kurt Witte, 8 Hans Horst Söntgerath, 9 Erwin Schuller, 10 Lutz Moldenhauer, 11 Roland Fischer, 12 Hans Georg Schlösser, 13 Hans Werner Dreilich, 14 Hans Gert Kraheck, 15 ?, 16 Heinemann?, 17 Theo Strunk, 18 Hans Willi Müller, 19 ?, 20 Karl Witgen (Schmidt) 21 ?, 22 Franz Moldenhauer, 23 Norbert Kowalski, 24 Johannes Ketteler, 25 Lehrer Josef Schmitz, 26 Karl Heinz Gries, 27 Werner Pape, 28 Norbert Ewen, 29 Helmut Netzer, 30 Dieter Knipp, 31 Günter Engelhardt, 32 Schuler, 33 Ernst Just, 34 Walter Ferner, 35 Hans Dieter Heimig, 36 Konrektor J. Grunenberg, 37 Karl Heinz Bührling. | |
|
1958
Auf dem Foto von etwa 1958 ist rechts die Bäckerei Wingen zu sehen. Daneben ist das Haus Küpper (heute Wimmeroth), in dem Matthias Küpper eine Schumacherwerkstatt hatte, dahinter das „kleine“ Fachwerkhaus Kemmerich, dem das Haus Urbach folgt. Der... Auf dem Foto von etwa 1958 ist rechts die Bäckerei Wingen zu sehen. Daneben ist das Haus Küpper (heute Wimmeroth), in dem Matthias Küpper eine Schumacherwerkstatt hatte, dahinter das „kleine“ Fachwerkhaus Kemmerich, dem das Haus Urbach folgt. Der Bierkastenträger vorne links ist Hans Josef Höndgesberg. | |
Die Luftaufnahme aus dem Jahr 1958 von Richtung Bachstraße aus gesehen zeigt im Vordergrund den Vogtshof der Familie Siegfried Aust und das Wohngebäude von Dr. Goerig später Frau Dr. Degand und nachfolgende Arztpraxen (Ecke Bachstraße /... Die Luftaufnahme aus dem Jahr 1958 von Richtung Bachstraße aus gesehen zeigt im Vordergrund den Vogtshof der Familie Siegfried Aust und das Wohngebäude von Dr. Goerig später Frau Dr. Degand und nachfolgende Arztpraxen (Ecke Bachstraße / Hermann-Löns-Straße). Rechts davon entlang der Bachstraße zwischen Hermann-Löns-Straße und Grüner Weg Gartenanlagen, die spätere städtische Grünfläche und jetziger Standort des Altenheims. Zu sehen sind weiterhin in der Bildmitte die Werkseinrichtung der Firma Johann Fischer und sein Nachfolger Stephan Fischer, an der HerrmannLöns-Straße, rechts neben dem Verwaltungsgebäude, übrigens auch das erste Kino von Lohmar, das Geburtshaus des Fabrikanten und Heimatforschers Bernhard Walterscheid-Müller, am Waldweg (die heutige Humperdinckstraße), später war hier das Sägewerk von Willi Sauer („de Suersch Weckes“) und im Hintergrund der erste und zweite Bauabschnitt der neuen sechsklassigen Waldschule, die zum Schulanfang 1954 den Unterricht aufnahm. Links am Bildrand ist die Schmiedgasse mit der Gabelung des Birkenwegs zu sehen. | |
Auf dem Foto ist die Aufstellung des Karnevalszugs 1959 auf dem Marktplatz an der Mittelstraße (heute Rathausstraße) festgehalten. In diesem Jahr waren Alwine und Willi Ennenbach (Metzgerei im Hause Dunkel auf der Hauptstraße 60) das Prinzenpaar. Auf dem Foto ist die Aufstellung des Karnevalszugs 1959 auf dem Marktplatz an der Mittelstraße (heute Rathausstraße) festgehalten. In diesem Jahr waren Alwine und Willi Ennenbach (Metzgerei im Hause Dunkel auf der Hauptstraße 60) das Prinzenpaar. | |
Auf dieser Luftbildaufnahme, die Ende der 1950er Jahre gemacht wurde, ist Lohmar etwa von der Firma Salgert aus in südöstlicher Richtung zu sehen. Die Hochhäuser waren noch nicht vorhanden, die Lindenbäume an der Hauptstraße sind zum größten Teil... Auf dieser Luftbildaufnahme, die Ende der 1950er Jahre gemacht wurde, ist Lohmar etwa von der Firma Salgert aus in südöstlicher Richtung zu sehen. Die Hochhäuser waren noch nicht vorhanden, die Lindenbäume an der Hauptstraße sind zum größten Teil schon gefällt, ganz links im Bild (Mitte) ist der Güterschuppen noch zu sehen und die evangelische Kirche war noch nicht gebaut. Rechts und links der Altenrather Straße – die man ganz links sehen kann – ist noch freies Feld, wie auch rechts und links der Lindenallee nach Donrath noch keine Bebauung vorhanden ist. Hinter der Lindenallee kann man Pützrath und Donrath erkennen, rechts davon die noch baumgesäumte Jabachtalstraße. Oben rechts im Bild ist der Ingerberg zu sehen und davor am rechten Bildrand hat man einen Blick in die obere Buchbitze. | |
Die beiden Fotografien aus dem Jahr 1960 zeigen im oberen Bildausschnitt die Gaststätte "Zum alten Panzer“ von Theodor Kellershohn ( ab 1905 Jakob Panzer). Die beiden Fotografien aus dem Jahr 1960 zeigen im oberen Bildausschnitt die Gaststätte "Zum alten Panzer“ von Theodor Kellershohn ( ab 1905 Jakob Panzer). | |
Die Erbse und das Erbsenstroh sind von alters her Symbole der Fruchtbarkeit. Der „Äezebär“ (Erbsenbär) ist ein mit Erbsenstroh verkleideter Mann, der einen schreitenden Rundtanz vollführt und von meist maskierten Musikanten begleitet wird. Sie ziehen... Die Erbse und das Erbsenstroh sind von alters her Symbole der Fruchtbarkeit. Der „Äezebär“ (Erbsenbär) ist ein mit Erbsenstroh verkleideter Mann, der einen schreitenden Rundtanz vollführt und von meist maskierten Musikanten begleitet wird. Sie ziehen in Lohmar am Karnevalsdienstag von Haus zu Haus oder von Geschäft zu Geschäft und sammeln für einen guten Zweck. (B. Walterscheid-Müller, Lohmarer Mundart, Lohmar 1983) | |
Diese Kirche im Heidedorf Altenrath zählt wahrscheinlich zu den älteren Pfarrgemeinden des Bergischen Landes. Auf dem Foto sind der eingeschossige Westturm aus Bruchsteinmauerwerk mit Eckquaderung aus Trachyt, der seit Anfang der sechziger Jahre... Diese Kirche im Heidedorf Altenrath zählt wahrscheinlich zu den älteren Pfarrgemeinden des Bergischen Landes. Auf dem Foto sind der eingeschossige Westturm aus Bruchsteinmauerwerk mit Eckquaderung aus Trachyt, der seit Anfang der sechziger Jahre verputzt ist, zu sehen. Die Glockenstube hat an jeder Seite zwei Rundbogenschall-Fenster. Bekrönt wird der Westturm von einer achtseitigen, geknickten Schieferpyramide. Die Abseiten (Seitenschiffe) werden durch Rundbogenfenster und Strebepfeiler, der Obergaden des Mittelschiffs durch Rundbogenfenster gegliedert. Im Vordergrund des Fotos ist der die Kirche umgebende Friedhof zu erkennen. | |
Bis zum Bau des Rathauses Ende der 1960er Jahre war das Feuerwehrhaus am Ende des Marktplatzes in der Mittelstraße (heute Rathausstraße). Auf dem Foto vom Anfang der 1960er Jahre inspizieren die Feuerwehrleute ihre nostalgische, handbetriebene Pumpe,... Bis zum Bau des Rathauses Ende der 1960er Jahre war das Feuerwehrhaus am Ende des Marktplatzes in der Mittelstraße (heute Rathausstraße). Auf dem Foto vom Anfang der 1960er Jahre inspizieren die Feuerwehrleute ihre nostalgische, handbetriebene Pumpe, die auch heute noch existiert. Links erkennt man Karl Heinz Höndgesberg. Im Hintergrund ist ein Teilgebäude der Konservenfabrik von Peter Meurer zu sehen. Quelle: Wilhelm Pape, Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Lohmar, in: Festschrift 75 Jahre Löschzug Lohmar, 1998 | |
Das Prinzenpaar von Lohmar war 1963 Karl Josef Kappes und seine Freundin Irmgard Bergfelder aus Siegburg. Das Foto wurde im Musikzimmer des neuen Küsterhauses gemacht (Kirchstraße 21, vor dem Wohnhaus Kümpel). Karl Josef Kappes war mit seiner Ehefrau... Das Prinzenpaar von Lohmar war 1963 Karl Josef Kappes und seine Freundin Irmgard Bergfelder aus Siegburg. Das Foto wurde im Musikzimmer des neuen Küsterhauses gemacht (Kirchstraße 21, vor dem Wohnhaus Kümpel). Karl Josef Kappes war mit seiner Ehefrau Magdalene geb. Roth 1972 noch einmal das Prinzenpaar von Lohmar. Der karnevalistische Höhepunkt in seinem Leben war jedoch, als die Kölner Karnevalsgesellschaft „Jan van Werth“ – der er auch angehörte – ihn 1985 als Prinz im Dreigestirn des Kölner Karnevals stellte. Mit seinem musikalischen Talent war Karl Josef Kappes, geb. am 7.10.1940 in Lohmar, als Chordirektor ADC und Dirigent vieler Chöre weit über Lohmar hinaus bekannt und geschätzt. Er starb viel zu früh am 16.6.2003 in seinem Wohnort Krahwinkel. | |
|
1958
- 15959 Weil im Winter 1958/59 der Saal im „Hotel zur Linde“ abgebrannt war (N. Steinbach, Walterscheid, o.J.) fanden Veranstaltungen im Zelt oder später in der Aula der Hauptschule statt. Weil im Winter 1958/59 der Saal im „Hotel zur Linde“ abgebrannt war (N. Steinbach, Walterscheid, o.J.) fanden Veranstaltungen im Zelt oder später in der Aula der Hauptschule statt. | |
|
1950
- 1960 Dieses Foto wirft einen Blick hinter die Theke der „Gaststätte Schnitzler“ Mitte der 1960er Jahre. Wahrscheinlich war das in der Zeit der Kirmes, da vier Kellner hinter der Theke stehen, um alle Gäste bedienen zu können. In der Mitte am Zapfhahn ist... Dieses Foto wirft einen Blick hinter die Theke der „Gaststätte Schnitzler“ Mitte der 1960er Jahre. Wahrscheinlich war das in der Zeit der Kirmes, da vier Kellner hinter der Theke stehen, um alle Gäste bedienen zu können. In der Mitte am Zapfhahn ist Werner Schwillens. | |
|
1950
- 1960 Das Foto, Mitte der 1960er Jahre, zeigt das ehemalige Haus Waldesruh auf der Hauptstraße mit Blick in Richtung Gaststätte Schnitzler. Die Villa wurde um die Jahrhundertwende des 19. Jahrhunderts von Arnold Niessen aus Köln gebaut. Ab 1906 wohnte in... Das Foto, Mitte der 1960er Jahre, zeigt das ehemalige Haus Waldesruh auf der Hauptstraße mit Blick in Richtung Gaststätte Schnitzler. Die Villa wurde um die Jahrhundertwende des 19. Jahrhunderts von Arnold Niessen aus Köln gebaut. Ab 1906 wohnte in Haus Waldesruh der Leutnant und Bürgermeister Ludwig Polstorff. Das Haus ging später in den Besitz des Landwirts Steimel über und wurde 1980 im Zuge des Neubaus der Kreissparkasse abgerissen. Links davon das ehemalige Kolonialwarengeschäft von Christine Müller („et Möllesch Stiensche“), dann die KSK Lohmar und das dreistöckige Haus die Waldesruh. | |
|
1965
- 2019 Ein markanter Punkt auf dem Weg von Lohmar nach Seligenthal – daher auch Talweg genannt – war die Zwölfapostelbuche im Lohmarer Wald. Wenn man die Pützerau weiter durchgeht, gelangte man hinter dem Reitstall nach etwa 500 Metern an diesen Baum (heute... Ein markanter Punkt auf dem Weg von Lohmar nach Seligenthal – daher auch Talweg genannt – war die Zwölfapostelbuche im Lohmarer Wald. Wenn man die Pützerau weiter durchgeht, gelangte man hinter dem Reitstall nach etwa 500 Metern an diesen Baum (heute eine Baumgruppe, die 1979 gepflanzt wurde). Auf dem Foto von etwa 1965 sind von den in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gepflanzten 13 Stämmen – der 13. stand als Symbol für Jesus – nur noch 9 zu erkennen. Die anderen waren morsch und sind weggeschnitten worden. Bei der jährlichen Rochusprozession wurde am Sonntag nach dem 16. August auf dem Weg von der Kirche in Lohmar nach Seligenthal an der Zwölfapostelbuche die erste Rast gemacht. Der Hl. Rochus ist der Schutzheilige gegen Pest, Seuchen und Ansteckende Krankheiten. Jungfrauen sollen bei der Wallfahrt auch um einen guten Ehemann gebetet haben. | |
Auf dem Foto vom Mai 1965 schaut man von der Kirche in die Altenrather Straße. Vorne links ist der Friedhof und dahinter der Sportplatz mit Sportlerheim und Turnhalle. Rechts vorne sieht man den Garten der Familie Postertz, dahinter die Gewächshäuser... Auf dem Foto vom Mai 1965 schaut man von der Kirche in die Altenrather Straße. Vorne links ist der Friedhof und dahinter der Sportplatz mit Sportlerheim und Turnhalle. Rechts vorne sieht man den Garten der Familie Postertz, dahinter die Gewächshäuser der Gärtnerei Ramme und auf der linken Seite der Altenrather Straße das Haus Klostermann, an dem gerade angebaut wird, dann das Haus Pape (Nr. 17, gebaut 1962), das Haus Schmitz (Nr. 23), das Haus Schwarzrock (Nr. 25) und dahinter das Haus Uiwari (Nr. 27). Auf der rechten Seite ist das Haus Ennenbach (Nr. 10, gebaut 1938) und das Haus Hackmann (Nr. 20, heute MSS, Moderne Sonnenschutzsysteme GmbH), das sich noch im Bau befindet. Auf der anderen Seite der Einmündung des Breiter Weg sind die Häuser Ningelgen (Nr. 22), Völkerath (Nr. 24), Schönenborn (Nr. 26), Lange (danach Opitz, Nr. 28) und das Haus Höfgen (Nr. 34). | |
|
1968
Das Pastorat ist das Wohnhaus des Pfarrers – hier auf einem Foto von 1968. Es befand sich in der Kirchstraße hinter der Pfarrkirche und war vom Kirchenvorplatz durch eine Mauer getrennt. Unter Pfarrer Düsterwald ist das stattliche Haus 1896 gebaut... Das Pastorat ist das Wohnhaus des Pfarrers – hier auf einem Foto von 1968. Es befand sich in der Kirchstraße hinter der Pfarrkirche und war vom Kirchenvorplatz durch eine Mauer getrennt. Unter Pfarrer Düsterwald ist das stattliche Haus 1896 gebaut worden; die Stallungen hat man 1908 angebaut. Als Pfarrer Paul Josef Düsterwald im Januar 1923 in den Ruhestand ging, wollte er nicht aus dem Pfarrhaus ausziehen. Deshalb musste sein Nachfolger, Pfarrer Johannes Hellen im alten kleinen Küsterhaus wohnen. Pastor Hellen war darüber so gekränkt, dass sich sein angeschlagener Gesundheitszustand weiter verschlechterte, so dass er am 15.7.1925 starb. Pfarrer Düsterwald schied am 19.12.1926 mit 87 Jahren aus dem Leben. Ende der 1970er Jahre musste das Pfarrhausr dem Bau des Pfarrzentrums weichen. | |
|
1972
- 1973 Dieses Foto aus der Zeit um 1972/73 zeigt die Einmündung in den Breiter Weg, Blickrichtung Westen vom Backes Garten aus. Die Häuser von links nach rechts: Friedrich Ramme, Gartenbaubetrieb, Winking & Breuer, Pharmazie Siegburg, Erben van der Viefen,... Dieses Foto aus der Zeit um 1972/73 zeigt die Einmündung in den Breiter Weg, Blickrichtung Westen vom Backes Garten aus. Die Häuser von links nach rechts: Friedrich Ramme, Gartenbaubetrieb, Winking & Breuer, Pharmazie Siegburg, Erben van der Viefen, Bäckerei Kraheck, später Musil, Bless, Mylenbusch und heute Jansen, im Vordergrund Steinbrecher. Das heutige Grundstück „Im Backesgarten“ der LindenApotheke Dr. Bolten, Hauptstraße 55, war unbebaut, lediglich das Bauschild auf dem Grundstück wies auf den kommenden Neubau hin. Die Vorbesitzer dieser Parzelle waren die Geschwister Gertrud und Elisabeth Broich | |
Das Foto von etwa 1977 gestattet einen Blick in den Hof hinter dem „Hotel zur Linde“. In dem linken Gebäude war bis 1925 die Dampf-Kornbrantweinbrennerei des Peter Josef Knipp („de Pettenösel“) untergebracht. Hier stellte er den im Volksmund „Knepps... Das Foto von etwa 1977 gestattet einen Blick in den Hof hinter dem „Hotel zur Linde“. In dem linken Gebäude war bis 1925 die Dampf-Kornbrantweinbrennerei des Peter Josef Knipp („de Pettenösel“) untergebracht. Hier stellte er den im Volksmund „Knepps Fusel“ genannten Kornbrand her, der damals 80 Pfennige pro Liter kostete. Die Familie Knipp ist in Lohmar schon vor 1800 nachgewiesen. Zwischen 1797 und 1799 heiratete Johann Knipp die aus Rheidt stammende, aber in Lohmar wohnende Anna Elisabeth Henselers. Ein Enkel von ihnen ist Peter Josef Knipp. | |
|
1981
Auf diesem Foto von 1981 sieht man den Campingplatz Lohmar-Ort aus der Vogelperspektive. Er wurde 1967 von der Gemeinde Lohmar angelegt und an Katharina Heimig (Lebensmittelgeschäft in der Kirchstraße 6) verpachtet. Ihr Sohn Hans Dieter Heimig kaufte... Auf diesem Foto von 1981 sieht man den Campingplatz Lohmar-Ort aus der Vogelperspektive. Er wurde 1967 von der Gemeinde Lohmar angelegt und an Katharina Heimig (Lebensmittelgeschäft in der Kirchstraße 6) verpachtet. Ihr Sohn Hans Dieter Heimig kaufte den Platz 1976 von der Gemeinde Lohmar, renovierte ihn gründlich, baute ein großes neues Sanitärgebäude, vergrößerte die vorhandene Gaststätte, verlegte Strom- und Wasserleitungen unterirdisch an jeden Stellplatz – der Campingplatz hatte 350 Stellplätze – und hatte einen Teil der Stellplätze schon an den Kanal angeschlossen als er 1986 den Platz an die Firma Schmitz aus Kürthen weiterverkaufte. | |
Vorne sind die Bahngleise und dahinter die namenlose Dorfstraße (heute Donrather Straße). Rechts ist der Gasthof „Zum Weißen Haus“ zu sehen, der von Fritz Kreuzer betrieben wurde und in der Mitte das „Hotel zur Aggerburg“ (Donrather Str. 38), das im... Vorne sind die Bahngleise und dahinter die namenlose Dorfstraße (heute Donrather Straße). Rechts ist der Gasthof „Zum Weißen Haus“ zu sehen, der von Fritz Kreuzer betrieben wurde und in der Mitte das „Hotel zur Aggerburg“ (Donrather Str. 38), das im Besitz der Familie Böttner war. Diese haben die Aggerburg an eine aus Schweden stammende Familie Lönqvist verkauft. Die neuen Eigentümer hatten zuerst auf der anderen Straßenseite (heute Marienkirche) eine Außengastronomie eingerichtet, die sie später hinter das Haus verlegt und zusätzlich für die Hotelgäste noch eine Liegewiese angelegt hatten. Links neben der Aggerburg ist das heutige Haus Gatzweiler (Donrather Str. 36). Es war ursprünglich das Wohnhaus von Ludmilla Böttner („et Aggerburchs Milla“), die sehr fromm war und ihr Haus der Kirche vermacht hat. Die Kirche verkaufte es an die Familie Sieberts, von denen es an Familie Gatzweiler vererbt wurde. Die Pfarrei Lohmar hat von dem Erlös des Hauses in der Kirchstraße in Lohmar eine neue Vikarie (Wohnung des Kaplans) gebaut, in der später das Wasserwerk war. Heute ist dort der Lidl-Parkplatz. Hinter den beiden Häusern ist Sottenbach zu erkennen. Weiter rechts in der Bildmitte, das letzte Haus in Sottenbach, ist das Haus von Wilhelm Klein („de Trappe Wellem“) und seiner Frau Margarethe geb. Söntgerath. Diese Bezeichnung leitet sich ab von „Trappe“ = Treppen. Das Grundstück lag abschüssig und war mit Treppen erschlossen. Ihr Sohn hatte in Lohmar in der Kirchstraße das „Kleins Büdchen“ betrieben. Er hieß auch Wilhelm und bekam somit auch den Namen „de Trappe Wellem“. Ihre Tochter Katharina („et Trappe Trienche“) bewirtschaftete den kleinen Hof und die andere Tochter Maria („et Trappe Marie“) war eine gute Schneiderin. Oberhalb von Sottenbach sind die Häuser am Heppenberg zu sehen – am linken Bildrand die „Villa Wilhelmsruh“, die etwa 1926 von Bankdirektor a.D. Paul Engstfeld gekauft und seit dieser Zeit „Villa Engstfeld“ genannt wurde. | |
|
1905
Das Fachwerkhaus Kemmerich, heute Hauptstraße 80, – hier auf einem Foto von etwa 1905 – wurde um 1860 gebaut. Im rechten Gebäudeteil war zunächst die Schmiede des Johann Krebs. Aus der Einrichtung des vor 1880 aufgegebenen Betriebs errichtete Peter... Das Fachwerkhaus Kemmerich, heute Hauptstraße 80, – hier auf einem Foto von etwa 1905 – wurde um 1860 gebaut. Im rechten Gebäudeteil war zunächst die Schmiede des Johann Krebs. Aus der Einrichtung des vor 1880 aufgegebenen Betriebs errichtete Peter Schneider seine Schmiede am Auelsweg. Danach wurde die Schmiede zu einem Wohnteil umgebaut, in dem Matthias Küpper wohnte und eine Schusterei betrieb. Im linken Teil wohnte die Familie Krebs bzw. später Johann Theodor Kemmerich, der in erster Ehe am 24.6.1882 Josepha Krebs heiratete, die am 23.6.1885 verstarb. Nachdem Matthias Küpper nebenan ein neues Haus gebaut und seine Schusterwerkstatt dorthin verlegt hatte, gründete Johann Theodor Kemmerich (mit 70 Jahren am 20.8.1926 gestorben) in dem freigewordenen Gebäudeteil um die Jahrhundertwende ein Lebensmittelgeschäft, das von seiner zweiten Ehefrau Elisabeth geb. Kannengießer betrieben wurde. Um 1930 übernahm die Tochter Anna Katharina, die mit Wilhelm Urbach verheiratet war, das Geschäft. Diese bauten einige Jahre später daneben ein neues Haus, Hauptstraße 82, und führten darin das Geschäft weiter. | |
Das Foto entstand 1908 aus Anlass des 40-jährigen Bestehens des Kameradschaftlichen Vereins. Dieser wurde 1868 unter dem Vorsitz des Leutnants Carl Freiherr von Francken aus Haus Freiheit in Inger gegründet. Auf dem Foto präsentieren sich 62... Das Foto entstand 1908 aus Anlass des 40-jährigen Bestehens des Kameradschaftlichen Vereins. Dieser wurde 1868 unter dem Vorsitz des Leutnants Carl Freiherr von Francken aus Haus Freiheit in Inger gegründet. Auf dem Foto präsentieren sich 62 Vereinsmitglieder. In der ersten Reihe befinden sich die Musiker, die in Birk zu den unterschiedlichsten Anlässen aufspielten. | |
Das bis jetzt bekannte Bild mit Schülerinnen und Schüler der Birker Schule ab dem Geburtsjahrgang 1896 wird umrahmt rechts vom Lehrer Hermann Eulenbroich (1890-1930), links vom Lokal-Schulinspektor und Pfarrer Heinrich Heidhues (1907-1913). Die... Das bis jetzt bekannte Bild mit Schülerinnen und Schüler der Birker Schule ab dem Geburtsjahrgang 1896 wird umrahmt rechts vom Lehrer Hermann Eulenbroich (1890-1930), links vom Lokal-Schulinspektor und Pfarrer Heinrich Heidhues (1907-1913). Die Gräber mit den Grabdenkmälern von Lehrer und Pfarrer sind auf dem Birker Friedhof noch erhalten. | |
|
1910
Bereits um 1850 betrieb Wilhelm Roth in Franzhäuschen an der Zeithstraße eine Gastwirtschaft. Nach dem Ausbau der Straße, der für die umliegenden Gemeinden mit hohen Kosten verbunden war, wurde Wilhelm Roth von 1863 bis zum 31.12.1865 als... Bereits um 1850 betrieb Wilhelm Roth in Franzhäuschen an der Zeithstraße eine Gastwirtschaft. Nach dem Ausbau der Straße, der für die umliegenden Gemeinden mit hohen Kosten verbunden war, wurde Wilhelm Roth von 1863 bis zum 31.12.1865 als Chausseegeld-Erheber eingesetzt. Nachdem die Straße in das Eigentum des Staates übergegangen war, entfiel diese Art Maut. | |
Zu sehen ist ein Kraftomnibus um 1912 auf der Zeithstraße an der Haltestelle Neuenhaus (gegenüber Hochhausen). Der Bus ist auf dem Weg von Siegburg nach Much. Für die Strecke benötigte er ungefähr 1,5 Stunden. Neben den Fahrgästen wurden auch Briefe... Zu sehen ist ein Kraftomnibus um 1912 auf der Zeithstraße an der Haltestelle Neuenhaus (gegenüber Hochhausen). Der Bus ist auf dem Weg von Siegburg nach Much. Für die Strecke benötigte er ungefähr 1,5 Stunden. Neben den Fahrgästen wurden auch Briefe und Pakete befördert. Der Fahrer steht voller Stolz an seinem Fahrzeug. Der motorbetriebene Bus war in dieser Zeit eine Sensation, denn bis etwa 1910 fuhren auf der Strecke noch Pferdekutschen. Das Fahrzeug hat Rechtslenkung, Karbidlampen und Vollgummibereifung. Das Kennzeichen IZ steht für Rheinprovinz. Das Fachwerkhaus im Hintergrund ist die Gaststätte Matthias, später Peter Weber und zugleich die Postagentur für Birk. Links war die Gaststätte, rechts das Postbüro. | |
In der Nähe der alten Fähre richtete in den Jahren 1910/11 die Familie Schultheis eine Kahnstation mit Bootsverleih ein. Da diese Stelle der Agger sich durch die ehemalige Furt mit meist Niedrigwasser für den Bootsverleih nicht besonders eignete,... In der Nähe der alten Fähre richtete in den Jahren 1910/11 die Familie Schultheis eine Kahnstation mit Bootsverleih ein. Da diese Stelle der Agger sich durch die ehemalige Furt mit meist Niedrigwasser für den Bootsverleih nicht besonders eignete, eröffnete sie die Kahnstation kurze Zeit später flussabwärts in Höhe der heutigen Firma GKN-Walterscheid und Eaton. Die ehemalige Gaststätte „Zum Rudersport“ erinnerte an diesen einstigen Bootsverleih, der später von der Familie Brüll weitergeführt wurde. Auf dem Bild erkennt man kurz nach dem Ersten Weltkrieg britische Besatzungssoldaten bei einer Kahnpartie. Bei einer Leihgebühr von nur 20 Reichspfennige je Stunde und Boot waren die Ruderboote bei gutem Wetter fast immer ausgebucht. Am linken Bildrand sieht man die Dorfjugend des Unterdorfs, die ihren angestammten Badestrand am sogenannten „Kuttekülisch Stöck“ hatten. Dort befand sich ein ziemlich großer Altarm am westlichen Ufer der Agger mit stehendem Gewässer. | |
|
1914
Dieses Foto entstand etwa 1914 und zeigt die Familie Kemmerich im Hof ihres Haus an der Hauptstraße 80. Von links nach rechts sieht man stehend: Heinrich Kemmerich (wohnte später im früheren Försterhaus, Haus im Auelsweg Ecke Hauptstraße), Margarethe... Dieses Foto entstand etwa 1914 und zeigt die Familie Kemmerich im Hof ihres Haus an der Hauptstraße 80. Von links nach rechts sieht man stehend: Heinrich Kemmerich (wohnte später im früheren Försterhaus, Haus im Auelsweg Ecke Hauptstraße), Margarethe Kemmerich verh. Weber, Josef Kemmerich (im Ersten Weltkrieg gefallen), Peter Kemmerich (Rendant, wohnte später an der Hauptstraße, wo heute das Stadthaus ist), Anna Katharina Kemmerich verh. Urbach (Geschäft an der Hauptstraße 84) und davor Christine Kemmerich verh. Lohmar (wohnte später im Bungert); sitzend: Anna Kemmerich verh. Bollen, Vater Theodor Kemmerich, Mutter Elisabeth Kemmerich geb. Kannengießer und Maria Kemmerich verh. Schopp (wohnte später an der Hauptstraße neben der Kreissparkasse). | |
Liebesgaben-Kommissionen bildeten sich im Ersten Weltkrieg in vielen Orten und Städten des Deutsches Reiches, so auch in Honrath. Man sammelte Lebensmittel, um sie als Liebesgaben zur Unterstützung der Soldaten an die Front zu schicken, aber auch zur... Liebesgaben-Kommissionen bildeten sich im Ersten Weltkrieg in vielen Orten und Städten des Deutsches Reiches, so auch in Honrath. Man sammelte Lebensmittel, um sie als Liebesgaben zur Unterstützung der Soldaten an die Front zu schicken, aber auch zur Unterstützung von Kriegsfamilien und zur Linderung der Not von Hinterbliebenen. Möglicherweise haben Mitglieder der Honrather Kommission den durchreisenden Soldaten Erfrischungen am Bahnhof Honrath gereicht. | |
Die ebenfalls um die Jahrhundertwende entstandene stark retuschierte Fotografie von 1916 mit einer Gesamtansicht von Lohmar, aus Südosten gesehen, zeigt einen damals vorwiegend von der Landwirtschaft geprägten Ort, die Alte Lohmarer Straße und einen... Die ebenfalls um die Jahrhundertwende entstandene stark retuschierte Fotografie von 1916 mit einer Gesamtansicht von Lohmar, aus Südosten gesehen, zeigt einen damals vorwiegend von der Landwirtschaft geprägten Ort, die Alte Lohmarer Straße und einen Teil der Bachstraße von Siegburg nach Donrath in Höhe des Korresgarten. | |
|
1920
„Im Backesgarten“ heißt heute die Sackgasse, die von der Hauptstraße zwischen dem Schuhhaus Palm (Nr. 53) und der Lindenapotheke (Nr. 55) in Richtung Bachstraße führt. Dort stand am unteren Ende (damals Bachstraße Nr. 23) das Haus Lehr – der... „Im Backesgarten“ heißt heute die Sackgasse, die von der Hauptstraße zwischen dem Schuhhaus Palm (Nr. 53) und der Lindenapotheke (Nr. 55) in Richtung Bachstraße führt. Dort stand am unteren Ende (damals Bachstraße Nr. 23) das Haus Lehr – der ehemalige „Backeshof“. | |
|
1920
Das Foto der Bachstraße um 1920 zeigt im Vordergrund einen Bildstock, einen sogenannten Fußfall, auf dem Grundstück Aust (des ehemaligen Vogtshofs, der heute durch die Wohn- und Geschäftshausbebauung in die zweite Reihe gerückt ist). Es handelt sich... Das Foto der Bachstraße um 1920 zeigt im Vordergrund einen Bildstock, einen sogenannten Fußfall, auf dem Grundstück Aust (des ehemaligen Vogtshofs, der heute durch die Wohn- und Geschäftshausbebauung in die zweite Reihe gerückt ist). Es handelt sich um den letzten noch vorhanden von sieben(?) Fußfällen der Dorfstraße. Ein Fußfall ist eine besondere historische Form des Kniefalls. Er stellt einen Bittgang durch die Dorfstraßen oder die Flur dar, wobei an sieben Wegekreuzen, Kapellen oder Heiligenhäuschen, den sogenannten Fußfällen, jeweils einer oder zwei Stationen des Leidensweges Christi in Jerusalem betend gedacht wurde. Mancherorts sind eigens für den Gang gestiftete Bildstöcke, Passionsszenen darstellend, erhalten. Links erkennt man den Auelsbach in offener Vorflut. | |
Die Aufnahme zeigt die Aggerbrücke zwischen Lohmar und Altenrath etwa um 1920. Die Form der Brücke ist eine Stahlbogenbrücke aus einem Flussbogen und einem Landbogen mit gebogenen kastenförmigen Ober- und geraden Untergurten, senkrechten und... Die Aufnahme zeigt die Aggerbrücke zwischen Lohmar und Altenrath etwa um 1920. Die Form der Brücke ist eine Stahlbogenbrücke aus einem Flussbogen und einem Landbogen mit gebogenen kastenförmigen Ober- und geraden Untergurten, senkrechten und diagonalen Stabwerken, mit eingelegter Fahrbahn. Die Brückenkonstruktion ist mittig auf einem gemauerten Landpfeiler aufgelegt. Die Brückenköpfe sind mit Kies aufgefüllte Rampen, deren Fahrspur noch keine feste Oberschicht aufweisen. Die Absturzgeländer sind aus den alten Feldgleisen des stillgelegten Bähnchens nach Altenrath gefertigt. Die Brücke wurde am Ostersonntag, dem 1.4.1945 gesprengt. | |
Susanna Schreckenberg im Alter von 64 Jahren vor ihrem Haus Nr. 31 in Birk mit ihrem Sohn Heinrich und dessen Freund Rudolf Schwamborn. Susanna Schreckenberg im Alter von 64 Jahren vor ihrem Haus Nr. 31 in Birk mit ihrem Sohn Heinrich und dessen Freund Rudolf Schwamborn. | |
Im Margarethen-Saal in Schlehecken gab es schon vor dem Ersten Weltkrieg erste Tanzveranstaltungen. Erzählt wird auch von handfesten Auseinandersetzungen mit den Nachbarn aus Hoffnungsthal um die schönsten Mädchen. Der Margarethen-Saal wurde aber... Im Margarethen-Saal in Schlehecken gab es schon vor dem Ersten Weltkrieg erste Tanzveranstaltungen. Erzählt wird auch von handfesten Auseinandersetzungen mit den Nachbarn aus Hoffnungsthal um die schönsten Mädchen. Der Margarethen-Saal wurde aber auch noch durch eine andere Begebenheit bekannt. Im Zweiten Weltkrieg lagerten im Saal eine größere Menge Wehrmachtsartikel. In der schlechten Nachkriegszeit wurden aus den Wolldecken Kleider genäht und so entstand die Redensart: „Er kleidet sich auch in Schlehecker Grün.“ | |
|
19. Juni 1926
In Schlehecken gab es Anfang der 20er Jahre drei Vereine: den Turnverein, den Tambourcorps Arbeiter-Turnverein und den Scheibenschützenverein. Der Schießstand des Vereins befand sich unterhalb von Schlehecken in Richtung Honrath. Gerade in kleinen... In Schlehecken gab es Anfang der 20er Jahre drei Vereine: den Turnverein, den Tambourcorps Arbeiter-Turnverein und den Scheibenschützenverein. Der Schießstand des Vereins befand sich unterhalb von Schlehecken in Richtung Honrath. Gerade in kleinen Ortschaften war das Vereinsleben ein wesentlicher Bestandteil des dörflichen Lebens. | |
Das ehemalige Wohnstallhaus im Fachwerkstil der Familie Hagen, 1891 erbaut, hat am Verbindungsweg von Siegburg nach Hohkeppel in der sogenannten „Op däe Jass“ gestanden. Heute entspricht diese seinerzeit namenlose Gasse in etwa dem Verlauf der... Das ehemalige Wohnstallhaus im Fachwerkstil der Familie Hagen, 1891 erbaut, hat am Verbindungsweg von Siegburg nach Hohkeppel in der sogenannten „Op däe Jass“ gestanden. Heute entspricht diese seinerzeit namenlose Gasse in etwa dem Verlauf der Gartenstraße. 1932 brannte dieses Fachwerkhaus völlig aus und wurde daneben 1932/33 neu, massiv errichtet. Die Aufnahme aus den 1920er Jahren zeigt Frau Gertrud Hagen, die Großmutter von Hubert Hagen, der auch heute noch dort wohnt, und Gertrud Pohl, die Mutter von Hubert Pohl. Der Name des Kindes ist nicht bekannt. | |
„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“. Die Gründungsmitglieder der ersten organisierten Feuerwehr in Lohmar an der Grotte im Park der Villa Friedlinde im Jahre 1924. Von links nach rechts und von unten nach oben sind zu erkennen: Polizeisergeant Adam... „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“. Die Gründungsmitglieder der ersten organisierten Feuerwehr in Lohmar an der Grotte im Park der Villa Friedlinde im Jahre 1924. Von links nach rechts und von unten nach oben sind zu erkennen: Polizeisergeant Adam Schug, Johann Heuser, Heinrich Boddenberg, Heinrich Flamm, Johann Pape, Jakob Brodesser, Johann Schneppenheim, Willi Schneppenheim, Wilhelm Schmitz, Peter Lüdenbach, Heinrich Pütz, Jakob Berg, Peter Orth und Otto Schug. Die erste listenmäßige Erfassung der Mitglieder der Feuerwehr stammt aus dem Gründungsjahr, 1.11.1923. Anfängliche Ausrüstungsgegenstände waren einfache blaue Arbeitsanzüge, ein paar Löscheimer und einige Brandhaken. Bei Ausbruch eines Brandes musste ein Feuerwehrmann durchs Dorf laufen und ins Horn blasen, um Feueralarm zu geben. Mit einer für damalige Verhältnisse sehr modernen Kolbensaugund Druckpumpe und dem zugehörigen Saug- und Druckschlauchmaterial, wobei die Handspritze entweder mit Pferdebespannung oder per Hand gezogen wurde, mussten die Männer der freiwilligen Feuerwehr das Feuer angreifen. | |
Diese Luftaufnahme zeigt das Herrenhaus der Lohmarer Burg. Sie wurde um 1350 erbaut und vermutlich zwischen 1572 und 1582 grundlegend umgebaut. Die dreifl ügelige, zum Herrenhaus offene Fachwerkvorburg, die vom Hauptgebäude ursprünglich durch einen... Diese Luftaufnahme zeigt das Herrenhaus der Lohmarer Burg. Sie wurde um 1350 erbaut und vermutlich zwischen 1572 und 1582 grundlegend umgebaut. Die dreifl ügelige, zum Herrenhaus offene Fachwerkvorburg, die vom Hauptgebäude ursprünglich durch einen Wassergraben getrennt war, ist in der heute noch existierenden Bausubstanz erheblich jüngeren Datums (1717). Der Zugang zur Burg führt über eine gemauerte Brückenzufahrt über den einstigen Wassergraben, der jetzt trocken gefallen und dessen nordöstliche Hälfte zugeschüttet ist. Wie noch die Urflurkarte zeigt, stellte diese Hofausfahrt bis 1936 vor dem Bau der Reichsautobahn, die direkte axiale Verbindung mit dem Kirchdorf her. Links vom Weg nach Altenrath erkennt man den Bachhof und im Hintergrund, vor der Stahlbrücke über die Agger, das Fährhaus. Die Aufnahme ist 1926 entstanden. | |
Der erste Prinz Karneval von Birk war der Gastwirt Anton Salgert aus Franzhäuschen. Prinz Anton I., im Bild ganz oben links. Sein Gefolge waren Mitglieder des Männergesangvereins „Liederkranz“ Birk. Die Liste der Teilnehmer ist nicht vollständig. Der erste Prinz Karneval von Birk war der Gastwirt Anton Salgert aus Franzhäuschen. Prinz Anton I., im Bild ganz oben links. Sein Gefolge waren Mitglieder des Männergesangvereins „Liederkranz“ Birk. Die Liste der Teilnehmer ist nicht vollständig. | |
|
1929
1929 ein Motorrad zu haben, war schon etwas Besonderes. Dieses Motorrad ist eine Ardie 500 (die Firma mit Sitz in Nürnberg wurde von Arno Dietrich gegründet und produzierte von 1919 bis 1958 Motorräder). Alle wollten gerne einmal mitfahren. 1929 ein Motorrad zu haben, war schon etwas Besonderes. Dieses Motorrad ist eine Ardie 500 (die Firma mit Sitz in Nürnberg wurde von Arno Dietrich gegründet und produzierte von 1919 bis 1958 Motorräder). Alle wollten gerne einmal mitfahren. | |
Diese Aufnahme zeigt die Hauptstraße/Ecke Kirchstraße. Diese Ecke hat seit 1976 ein völlig verändertes Aussehen. Damals in den 1890er Jahren wurde die Gastwirtschaft und Hotel „Zur Linde“ erbaut. Auf dem Bild ist der Eingang zum Nebengebäude, dem... Diese Aufnahme zeigt die Hauptstraße/Ecke Kirchstraße. Diese Ecke hat seit 1976 ein völlig verändertes Aussehen. Damals in den 1890er Jahren wurde die Gastwirtschaft und Hotel „Zur Linde“ erbaut. Auf dem Bild ist der Eingang zum Nebengebäude, dem großen Saal mit Bühne aus der Zeit vor 1929 zu erkennen, einer der Hauptveranstaltungsräume von Lohmar für größere Versammlungen und Feierlichkeiten und für viele der Vereine das Vereinslokal. 1976 wurde das Gebäude abgerissen und durch den heute städtebaulich wenig schönen Zweckbau ersetzt, ohne die architektonische Qualität des lokalen Umfelds, Hauptstraße/Ecke Kirchestraße, zu erreichen. | |
|
1925
- 1935 Der Verbindungsweg zwischen Siegburg und Donrath, die heutige Bachstraße, verläuft in etwa parallel, in Nord-Süd-Richtung, zur 1845 erbauten Provinzialstraße, der Hauptstraße (B 484). Sie ist weitaus älter und in deren Mitte verlief anfangs der... Der Verbindungsweg zwischen Siegburg und Donrath, die heutige Bachstraße, verläuft in etwa parallel, in Nord-Süd-Richtung, zur 1845 erbauten Provinzialstraße, der Hauptstraße (B 484). Sie ist weitaus älter und in deren Mitte verlief anfangs der Auelsbach in freier Rinne. Wie auf dem Foto zu erkennen ist, ist der zur Seite verlegt worden. Später wurde dieer dann verrohrt. Von dieser Straße zweigten auch die meisten Verbindungspfade, -wege und Gässchen rechts und links in Ost-/West-Richtung ab. Das Bild wird zwischen dem Ende der 1920er Jahre und der Mitte der 30er Jahre entstanden sein. Links sieht man den Bildstock vom Vogsthof und rechts den Steg über den Auelsbach zum Lehrs Fachwerkhof im Backesgarten. Um die Jahrhundertwende 1900 befanden sich hier ebenso viele Fachwerkhäuser wie an der Hauptstraße. | |
Das von Lehrer Johann Scharrenbroich 1818 erbaute Fachwerkhaus in der Mitte des Bildes wurde 1856 von dessen ledig gebliebenen Tochter Veronika der Kirche in Birk als Stiftung für wohltätige Zwecke vermacht. Das Haus hieß danach „Veronikastift“ und... Das von Lehrer Johann Scharrenbroich 1818 erbaute Fachwerkhaus in der Mitte des Bildes wurde 1856 von dessen ledig gebliebenen Tochter Veronika der Kirche in Birk als Stiftung für wohltätige Zwecke vermacht. Das Haus hieß danach „Veronikastift“ und diente lange Zeit der Gemeindeschwester Maria Höck als Wohnung. Durch die Erweiterung der Pfarrkirche mit neuem Turm 1888 verblieb zwischen Kirche und benachbarter Bebauung nur ein enger Fußpfad. Dicht neben dem Veronikastift stand die uralte Gaststätte und Schnapsbrennerei Scharrenbroich, vormals Dick und Kuttenkeuler. Im rückwärtigen Saal fand eine Zeit lang bis 1846 Schulunterricht statt. Durch die dichte Bebauung um die Kirche war die Dorfstraße so eng, dass ein Gegenverkehr nicht möglich war. 1930 wurden beide Häuser mit umgebenden Gebäuden verkauft und abgerissen. | |
|
1920
Das Heidehaus - ein stattliches, solide gebautes Herrenhaus hat viele Jahre in Heide an der Franzhäuschenstraße gegenüber des heutigen Dorfplatzes gestanden. Es wurde ca. 1910 von Herrn Sandmann, einem Industriellen aus Bad Godesberg für seine Frau... Das Heidehaus - ein stattliches, solide gebautes Herrenhaus hat viele Jahre in Heide an der Franzhäuschenstraße gegenüber des heutigen Dorfplatzes gestanden. Es wurde ca. 1910 von Herrn Sandmann, einem Industriellen aus Bad Godesberg für seine Frau als "Wochenendhaus" gebaut. Zu der Zeit stellte es in dem dünn besiedelten, nur mit kleinen Fachwerkhäusern bebauten Heide eine Besonderheit dar. Bis zum Zweiten Weltkrieg bewohnten verschiedene Fabrikanten das Haus, oft nur am Wochenende. | |
Der junge Priester Heinrich Roth feierte am 22.2.1931 seine Primiz in der Pfarrkirche Sankt Mariä Geburt in Birk. Das Foto zeigt ihn im Kreis seiner Familie und zahlreicher Gäste vor seinem Elternhaus in Inger. In der ersten Reihe ganz rechts ist... Der junge Priester Heinrich Roth feierte am 22.2.1931 seine Primiz in der Pfarrkirche Sankt Mariä Geburt in Birk. Das Foto zeigt ihn im Kreis seiner Familie und zahlreicher Gäste vor seinem Elternhaus in Inger. In der ersten Reihe ganz rechts ist Anton Michels, Pfarrer in Birk von 1926 bis 1958 zu erkennen. | |
An der Stelle des heutigen Gasthofes Fielenbach befand sich schon während des gesamten 19. Jahrhunderts eine Gastwirtschaft, deren Besitzer nacheinander die Familie Heister, Rudolf Schmitz und zuletzt die Familie Oligschläger waren. Aus den 30er... An der Stelle des heutigen Gasthofes Fielenbach befand sich schon während des gesamten 19. Jahrhunderts eine Gastwirtschaft, deren Besitzer nacheinander die Familie Heister, Rudolf Schmitz und zuletzt die Familie Oligschläger waren. Aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts stammt dieses Foto, auf dem die Witwe des Josef Oligschläger als Wirtin Erwähnung fi ndet. Rudolf Schmitz, eine Zeit lang Beigeordneter der Bürgermeisterei Lohmar, errichtete den sogenannten „Kaisersaal“. Hinzu kam später ein Lebensmittelladen im Foto rechts, der jedoch nur kurze Zeit bestand. | |
|
1896
- 1899
Kirchdorf von Lohmar vor 1900 – von der Altenrather Straße aus gesehen
Kirchdorf von Lohmar vor 1900 – von der Altenrather Straße aus gesehen
Von der Hauptstraße kommend war die rechte Seite der Kirchstraße – wie das Foto zwischen 1896 und 1900 zeigt – noch unbebautes freies Feld. Links ist das Gebäude der Volksschule Lohmar von 1856/57 (heute Lidl-Parkplatz) mit Toilettenhaus im Hintergrund. Daneben das 1819 gebaute Küsterhaus, in dem bis 1857 der jeweilige Küster, der auch gleichzeitig Lehrer war, Unterricht erteilte. Es wurde im Herbst 1954 abgerissen. | |
Erst 1938 kaufte die Gemeinde Lohmar das Grundstück von den Erben des Peter Schneider. Im hinteren Bereich, dort wo sich heute das Rathaus befindet, wurde ein neues Feuerwehrgerätehaus erbaut. Auf dem Foto vor dem Gebäude ist noch der Spritzenwagen... Erst 1938 kaufte die Gemeinde Lohmar das Grundstück von den Erben des Peter Schneider. Im hinteren Bereich, dort wo sich heute das Rathaus befindet, wurde ein neues Feuerwehrgerätehaus erbaut. Auf dem Foto vor dem Gebäude ist noch der Spritzenwagen zu erkennen.
| |
Der rechte Gebäudekomplex – vom Fachwerkhaus bis zur Werkhalle – gehörte der Metzgerei und Fleischkonservenfabrik des Peter Meurer. 1975 wurde hier die Raiffeisenbank mit dem späteren Erweiterungsbau errichtet. Der rechte Gebäudekomplex – vom Fachwerkhaus bis zur Werkhalle – gehörte der Metzgerei und Fleischkonservenfabrik des Peter Meurer. 1975 wurde hier die Raiffeisenbank mit dem späteren Erweiterungsbau errichtet.
| |
|
12. April 2024
Am 12. April 2024 stellte Friedhelm Limbach in der Lohmarer Buchhandlung LesArt sein Buch "Jugendchor WE ALL und Chor DA CAPO 1973 - 2018" vor. Es erinnert an 45 Jahre erfogreiche Chorgeschichte unter seiner Leitung. Viele ehemalige Chormitglieder... Am 12. April 2024 stellte Friedhelm Limbach in der Lohmarer Buchhandlung LesArt sein Buch "Jugendchor WE ALL und Chor DA CAPO 1973 - 2018" vor. Es erinnert an 45 Jahre erfogreiche Chorgeschichte unter seiner Leitung. Viele ehemalige Chormitglieder und Gäste waren gekommen.Gegen eine kleine Spende für die Lohmarer Tafel konnten sie die Chronik mit nach Hause nehmen. Nicht passender hätte die Vorstellung enden können als mit dem Lied "Oh happy day" und den Solisten Jörg Scheid und Karl-Heinz Frankeser und der musikalischen Gästeschar. Ein Lied, das der Chor "DA CAPO" am häufigsten gesungen hat und Friedhelm Limbach sichtlich Feude daran hatte. | |
71 Lohmarer Sagen und Geschichten sind von Hans Dieter Heimig und Bernhard Walterscheid-Müller gesammelt und in einer 2. erweiterten Auflage 2008 als Buch herausgegeben worden. 7 Beiträge daraus hat der 1991 verstorbene Bernhard Walterscheid-Müller... 71 Lohmarer Sagen und Geschichten sind von Hans Dieter Heimig und Bernhard Walterscheid-Müller gesammelt und in einer 2. erweiterten Auflage 2008 als Buch herausgegeben worden. 7 Beiträge daraus hat der 1991 verstorbene Bernhard Walterscheid-Müller mit Tonkassette in Lohmarer Mundart vorgelesen. Die Geschichte Nr. 5 "Em Deuvelspötz (Im Teufelsbrunnen)" spielt sich in der Sauren Wiese unterhalb von Lohmarhohn ab. Sie wurde dem Autor von seinem Vater Heinrich Müller mündlich überliefert, der sie wiederum von seinem Vater Johann übernommen hatte. | |
|
5. November 2023
- 5. Gut 350 Besucher erfreuten sich am Jubiläumskonzert des MGV Eintracht Honrath zu Ehren Ihres Dirigenten Rolf Pohle in der Honrather Kirche. Gleich 5 Chöre präsentierten musikalischen Hochgenuss mit Begleitung von Edgar Zens am Piano. Rolf Pohle... Gut 350 Besucher erfreuten sich am Jubiläumskonzert des MGV Eintracht Honrath zu Ehren Ihres Dirigenten Rolf Pohle in der Honrather Kirche. Gleich 5 Chöre präsentierten musikalischen Hochgenuss mit Begleitung von Edgar Zens am Piano. Rolf Pohle leitet seit 40 Jahren den Honrather Männerchor. In ihrer Laudatio hoben Bürgermeisterin Claudia Wieja, Vorsitzender Frank Lindenberg und sein langjähriger Vorgänger Lothar Peters hervor, dass Rolf Pohle bereits mit 23 Jahren sein Chorleiterstudium am Konservatorium der Stadt Köln abschloss und im gleichen Jahr (1983) die Chorleitung übernahm. 1987 legte er sein Examen als „Magister Artium“ an der Uni Bonn ab. Es sei ihm gelungen, stets Freude und Spaß am Gesang zu vermitteln und den Chor an die heutige Zeit anzupassen. Rolf Pohle dirigiert 9 Chöre darunter auch den Meisterchor „Singgemeinschaft Birk“. 1997 zeichnete ihn der Fachverband Deutscher Berufschorleiter mit dem Titel „Musikdirektor FDB“ aus.
| |
Ende August und Anfang September finden traditionell zunächst die Wahlscheider Kirmes und dann die Lohmarer Kirmes statt. Ein Höhepunkt in Wahlscheid ist das Schörreskarrenrennen am Kirmesmontag, dass 1946 der TV Wahlscheid ins Leben rief. In Lohmar... Ende August und Anfang September finden traditionell zunächst die Wahlscheider Kirmes und dann die Lohmarer Kirmes statt. Ein Höhepunkt in Wahlscheid ist das Schörreskarrenrennen am Kirmesmontag, dass 1946 der TV Wahlscheid ins Leben rief. In Lohmar ist es die Gerichtsverhandlung über den Kirmeskerl zum Ende der Kirmes. Der Brauch geht zurück in das Jahr 1912 und wurde von den Lohmarer Junggesellen bis 1960 gepflegt. Später spielte eine lebende Person als „Anton Kermesmann“ den Kirmeskerl. Ihm, auch als "Paijass" (französisch: paillasse = Strohsack, Hampelmann) bekannt, werden alle Missgeschicke und Schandtaten während der Kirmes und während des ganzen Jahres zugeschrieben, über die dann zum Kirmesende eine Gerichtsverhandlung stattfindet. In dem Audio erzählt Bernhard Walterscheid-Müller in Mundart über das Geschehen in früheren Jahren. Der Kirmeskerl wurde als Puppe am alten Spritzenhaus am Park der Villa Friedlinde auf eine Stange gesetzt, wo er bis Kirmesdienstag auf seine Gerichtsverhandlung warten musste. Seinen späteren Stammplatz hatte der Kirmeskerl am Balkongeländer vom „Hotel zum Aggerthal“ beim Johann Schnitzler. Das Urteil lautete stets auf Todesstrafe, nur bei der Form der Hinrichtung bestand Spielraum. Mal wurde er an der Aggerbrücke oder am Rudersport im Ziegelfeld ertränkt; ein andermal wurde er verbrannt oder mit einer Guillotine geköpft.
| |
Aus dem Lohmarer Sagen- und Geschichtenbuch erzählt Bernhard Walterscheid-Müller in Mundart vom Baumgeist im Ingerberg. Die Geschichte wurde von alten Lohmarern erzählt: "...es gab kaum einen, der keine Angst hatte, wenn er auf dem Weg nach Algert... Aus dem Lohmarer Sagen- und Geschichtenbuch erzählt Bernhard Walterscheid-Müller in Mundart vom Baumgeist im Ingerberg. Die Geschichte wurde von alten Lohmarern erzählt: "...es gab kaum einen, der keine Angst hatte, wenn er auf dem Weg nach Algert und Birk zu Fuß durch "de Holl" bergan gehen musste. Oben standen die großen alten Buchenstämme. Da haben sie ihn gesehen, ganz in weiß leuchtete er, und nur, wenn es dunkel war. Er flimmerte hüpfte auf einem kleinen Platz, wo alte Stümpfe standen hin und her. Auch schaurig krächzen will man ihn gehört haben." Die Erzählung rührt daher, dass die Bewohner des Oberdorfes seltsame Erfahrungen mit dem Ingerberg gemacht hatten. Sie beherzigten früher wohl das zeitgemäße Sprichwort: "Omm bläcke Ingebärch donn Bletz onn Donner ärch" (Auf dem nackten - baumlosen - Ingerberg tun Blitz und Donner arg). Der alte Hohlweg (de Holl) ist einer der alten Eisenwege, der aus dem Raum Köln über Altenrath über die Lohmarer Aggerfurt an der Burg zur Zeithstraße weiter ins Eisengebiet des Siegerlandes führte. | |
|
1. Mai 2023
Bei angenehm warmen Temperaturen wurde vor dem Vereinshaus das Heimatvereins in der Lohmarer Bachstraße der Mai 2023 angesungen. Nachdem wie in den vergangenen Jahren den Dorfschönen der Maibaum aufgestellt worden war, überraschte der Singkreis... Bei angenehm warmen Temperaturen wurde vor dem Vereinshaus das Heimatvereins in der Lohmarer Bachstraße der Mai 2023 angesungen. Nachdem wie in den vergangenen Jahren den Dorfschönen der Maibaum aufgestellt worden war, überraschte der Singkreis FRICHOLO unter der Leitung von Freidhelm Limbach mit dem "Lohmarlied" zum Maiansingen und Mitsingen. Ein schöner Beitrag zur Verbundenheit und Identifikation mit unserer Heimat. Die zahlreichen Gäste hatten ihre Freude und bedankten sich mit viel Applaus.
| |
|
1983
In der Tonbandaufzeichnung von 1983 liest Bernhard Walterscheid-Müller die Geschichte vom "Kosakentring" in Lohmarer Mundart vor. Sie handelt von einer Auseinandersetzung der Kathrin vom Katharinenbachshof bei Wahlscheid mit russsischen Kosaken, die... In der Tonbandaufzeichnung von 1983 liest Bernhard Walterscheid-Müller die Geschichte vom "Kosakentring" in Lohmarer Mundart vor. Sie handelt von einer Auseinandersetzung der Kathrin vom Katharinenbachshof bei Wahlscheid mit russsischen Kosaken, die die Franzosen nach dem verlorenen Krieg 1812/13 bis über den Rhein jagten und auch hier ihr Unwesen trieben. Die Kirchenbücher von Honrath, sonst nur äußerst knapp die Personenstände vermerkend, berichten hier über außergewöhnliche Ereignisse:
| |
|
2020
- 2023 Herzlich begrüßte Johannes Wingenfeld als Kommmentator des Karnevalszuges am Rosenmontag 2023 die langjährige Leiterin des katholischen Kindergartens in Lohmar Ursula Muß. Sichtlich gut gelaunt verfolgte sie die vorbeiziehenden Mottowagen und... Herzlich begrüßte Johannes Wingenfeld als Kommmentator des Karnevalszuges am Rosenmontag 2023 die langjährige Leiterin des katholischen Kindergartens in Lohmar Ursula Muß. Sichtlich gut gelaunt verfolgte sie die vorbeiziehenden Mottowagen und Fußgruppen und freute sich über die große Kindergartengruppe "Ihres" katholischen Kindergartens, die den Zug anführte. 40 Jahre lang hatte Sie mit Kindergartenkindern und Eltern am Zug teilgenommen und sich 2020 verabschiedet. Zum Abschied hatten Ihr eine große Zahl "Ehemaliger" nicht nur als Zugteilnehmer, sondern auch mit einem Abschiedslied "All dat mät se met Hätz, von Aanfang bes zoletz..." im katholischen Pfarrheim einen herzlichen Abschied bereitet. | |
|
1983
In der Audioaufnahme erzählt der verstorbene Lohmarer Ehrenbürger und Heimatforscher Bernhard Walterscheid-Müller in Mundart über den alten Brauch, einen Dorfmaibaum zu setzen. Danach stellten schon im 19. Jahrhundert die "Jonge vom Maijelooch" in... In der Audioaufnahme erzählt der verstorbene Lohmarer Ehrenbürger und Heimatforscher Bernhard Walterscheid-Müller in Mundart über den alten Brauch, einen Dorfmaibaum zu setzen. Danach stellten schon im 19. Jahrhundert die "Jonge vom Maijelooch" in der Nacht zum 1. Mai den Maibaum auf und nach der Gründung des Jungesellenverein 1897 "woe et jang on jäbe". Einen Stammplatz hatte der Baum lange Zeit nicht. Er stand nach dem Zweiten Weltkrieg einige Jahre auf dem heutigen Rathausvorplatz. Meistens gelang das Aufstellen des Maibaums ohne Probleme, bis auf einmal als "ne fiese Storm opkom" und am anderen Morgen "stond däe Boom wengsch". Mit kräftigen Windböen hatte auch das Vereinkomitee Lohmar beim Maibaumsetzen 2018 zu kämpfen. Trotz schwerem Krangerät gelang es nicht den Baum standfest zu verkeilen. Erst nachdem er um drei Meter verkürzt wurde, konnte er stablilisiert werden. Das Vereinskomitee hatte 2012 den Brauch wieder aufleben lassen. | |
1919 errichteten die britischen Besatzungstruppen ein Waldlager am Ziegelfeld für ca. 1.000 Soldaten. Die Bevölkerung fühlte sich von den Besatzern unterdrückt. Über sein Verhältnis zu den Engländern berichtet Peter Büscher (Jahrgang 1901) als... 1919 errichteten die britischen Besatzungstruppen ein Waldlager am Ziegelfeld für ca. 1.000 Soldaten. Die Bevölkerung fühlte sich von den Besatzern unterdrückt. Über sein Verhältnis zu den Engländern berichtet Peter Büscher (Jahrgang 1901) als Zeitzeuge in einem Gespräch mit Hans Dieter Heimig, das 1983 aufgenommen wurde. | |
Auf Initiative des Vorsitzenden Hermann Gierlach des Männergesangvereins Frohsinn Lohmar wurde der Film vom deutschen Heimatfilmdienst Axel von Kurz am 12. Mai 1955 hergestellt. Heinrich Kraus, Hermann Gierlach und Kurt Meldau begleiteten den... Auf Initiative des Vorsitzenden Hermann Gierlach des Männergesangvereins Frohsinn Lohmar wurde der Film vom deutschen Heimatfilmdienst Axel von Kurz am 12. Mai 1955 hergestellt. Heinrich Kraus, Hermann Gierlach und Kurt Meldau begleiteten den Kameramann bei den Aufnahmen. Der Filmkommentar stammt von Hans Dieter Heimig. Sprecher ist Rainer Böhm. Der Filmausschnitt zeigt den Festzug der Vereine durch die Poststraße. | |
Bernhard Walterscheid-Müller (1918 - 1991) hat einige Geschichten aus dem Buch Sagen und Geschichten, 1983 herausgegeben vom Heimat-und Kulturverein Lohmar, auf Tonträger gesprochen. Die Geschichte von den unterirdischen Gängen hat er selbst... Bernhard Walterscheid-Müller (1918 - 1991) hat einige Geschichten aus dem Buch Sagen und Geschichten, 1983 herausgegeben vom Heimat-und Kulturverein Lohmar, auf Tonträger gesprochen. Die Geschichte von den unterirdischen Gängen hat er selbst aufgezeichnet. Viele alte Lohmarer haben bei der Überlieferung mitgewirkt | |
Hans Dieter Heimig hat im Jahr 1978 einige Gespräche mit alten Lohmarerinnen und Lohmarern auf Tonkassetten festgehalten, u.a. auch mit dem verstorbenen Lohmarer Orginal Josef Kümmler (Jahrgang 1897), bekannt als „Kümmlers Jüpp“ und Peter Büscher,... Hans Dieter Heimig hat im Jahr 1978 einige Gespräche mit alten Lohmarerinnen und Lohmarern auf Tonkassetten festgehalten, u.a. auch mit dem verstorbenen Lohmarer Orginal Josef Kümmler (Jahrgang 1897), bekannt als „Kümmlers Jüpp“ und Peter Büscher, Jahrgang 1901, der auch einige Jahre Vorsitzender des Bienenzuchtvereins Lohmar war. In dem Audioclip sprechen sie über die Betreiber der Lohmarer/Pilgrams Mühle
| |
|
1983
Ein alter Brauch war das Pfingsteiersammeln, das vornehmlich im Rheinland, aber auch im Elsaß ausgeübt wurde. In Lohmar trafen sich die "Pingsjonge" aus dem Jungesellenverein "Pingssamsdach ovends" an der Schnitzlers Eck (heute Lohmarer Höfe) und... Ein alter Brauch war das Pfingsteiersammeln, das vornehmlich im Rheinland, aber auch im Elsaß ausgeübt wurde. In Lohmar trafen sich die "Pingsjonge" aus dem Jungesellenverein "Pingssamsdach ovends" an der Schnitzlers Eck (heute Lohmarer Höfe) und zogen durch das Dorf von Haus zu Haus. Nach dem Absingen des Pfingstliedes wurden Eier, Speck und sonstige Gaben gesammelt. "Dat Hengehäe" wurde dann am ersten oder zweiten Pfingsttag mit dem ganzen Dorf gefeiert. In Teilen des bergischen Landes geht man heute noch wie eh und jeh zum Pfingsteiersingen. In Lohmar wird dieser Brauch nur noch vereinzelt ausgeübt, wie zum Beispiel von der Straßengenmeinschaft "Am Bungert". Der verstorbene Ehrenbürger der Stadt Lohmar und langjährige Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsverein Lohmar Bernhard Walterscheid-Müller (5.4.1918 - 21.7.1991) hat diesen Brauch zu Pfingsten sowohl auf Tonkassette als auch schriftlich festgehalten: So auch die Anekdote wie "ene Vremde namens Homuth" die Pingsjonge für Räuber hielt und aus seinem Gewehr Schüsse in die Luft abgab, der Eierkorb aber gerettet wurde.
| |
|
7. Mai 2021
Am 7. Mai 2021 wurde an der Ecke Rathausstraße/Bachstraße/Mühlenweg vor dem Haus "Dunkels Eck" die Skulptur der "Lohmarer Mühle" - vielen auch als "Pilgrams Mühle" bekannt - der Öffentlichkeit übergeben. Wegen der Corona-Einschränkungen waren nur... Am 7. Mai 2021 wurde an der Ecke Rathausstraße/Bachstraße/Mühlenweg vor dem Haus "Dunkels Eck" die Skulptur der "Lohmarer Mühle" - vielen auch als "Pilgrams Mühle" bekannt - der Öffentlichkeit übergeben. Wegen der Corona-Einschränkungen waren nur die unmittelbar am Projekt Beteiligten und Bürgermeisterin Claudia Wieja zur Präsentation eingeladen. Neben der Skulptur wurde eine Infotafel, die die geschichtlichen Hintergründe erläutert und eine von dem Bildhauer und Steinmetz Markus Weisheit gestiftete Ruhebank aufgestellt. Finanziert wurde das Projekt „Lohmarer Mühle“ durch eine großzügige Spende der Eheleute Margarethe und Dr. Dieter Bretzinger an den Heimat- und Geschichtsverein (HGV) Lohmar. Es war Ihnen ein Anliegen, gemeinsam mit dem HGV ein heimat- und identitätsstiftendes Denkmal in Lohmar zu schaffen. Der Vorschlag der Lohmarer Künstlerin (Kunst im Fachwerk) und Vorsitzenden des Kunstvereins LohmArt Martina Furk und des HGV-Geschäftsführers Wolfgang Röger, das Thema Mühlen aufzugreifen und an die markante Lohmarer Mühle am Auelsbach zu erinnern, fand sofort Zuspruch. Der künstlerische Entwurf von Martina Furk wurde gemeinsam mit Markus Weisheit, Steinmetz- und Bildhauerwerkstatt aus Siegburg und Christian Thiesen, Metallbau Thiesen aus Lohmar zur Fertigungsreife entwickelt und umgesetzt. Als Materialien wurden Gesteinsblöcke aus bergischer Grauwacke und Cortenstahl gewählt. Als Standort wurde die Grünfläche vor dem Haus "Dunkels Eck" mit der Stadt Lohmar abgestimmt. Er liegt sehr exponiert in der Nähe des Auelsbaches unweit des ursprünglichen Mühlenstandortes. Das Grundstück wurde im Zuge der Verlegung der Rathausstraße von der Stadt erworben und als Grünfläche angelegt. Die Skulptur erinnert an die große technische und kulturgeschichtliche Bedeutung der Wassermühlen. Viele Ortsnamen in der Stadt Lohmar erinnern noch heute daran. Das Mühlrad wurde nach der Einweihung arretiert und ist nicht mehr beweglich.
| |
Vom Fährbetrieb über die Agger vor dem Bau der eisernen Aggerbrücke in Jahr 1899 erzählt der verstorbenen Ehrenbürger Bernhard Walterscheid-Müller auf Tonkassette in Lohmarer Mundart. In einem schriftlichen Vertrag von 1873 ist festgehalten, dass... Vom Fährbetrieb über die Agger vor dem Bau der eisernen Aggerbrücke in Jahr 1899 erzählt der verstorbenen Ehrenbürger Bernhard Walterscheid-Müller auf Tonkassette in Lohmarer Mundart. In einem schriftlichen Vertrag von 1873 ist festgehalten, dass das zur Burg Lohmar gehörende Fährhaus - heute Restaurant "Zur alten Fähre" - an den Ackerer und Holzschneider Wilhelm Lehr verpachtet wurde. Er und seine Frau Sibylla wurden kurz danach Eigentümer des Fährhauses. Sibylla übernahm den kompletten Fährbetrieb. Dieser diente dem Übersetzen von Passanten mit Gepäck und Handfahrzeugen. Zu diesem Zweck war ein Drahtseil über die Agger (etwas oberhalb des Fährhauses) gespannt mit einer Rolle, an der der Holznachen befestigt war. Mittels Drahtseil und Rolle ließ sich der Kahn ohne große Mühe zum anderen Ufer führen. Bald gab es keinen Fahrgast, der sich nicht bedenkenlos der Fahrkunst der »Buchholz-Möön« – wie sie nun genannt wurde – anvertraute. Am Fährhaus, einem kleinen Fachwerkhaus, war ein kleines Glöckchen angebracht, das durch einen Draht von der anderen Aggerseite bedient werden konnte. Der übliche Ruf „Holl rövve!“ (Hol rüber!) war dadurch nicht mehr nötig. Und wenn das Glöckchen ertönte, wusste man, dass jemand von der anderen Aggerseite übersetzen wollte. Die Gebühren waren sehr niedrig: 10 Pfennig für ein Pferd oder eine Kuh, 3 Pfennig für kleinere Tiere wie Schafe oder Ziegen, auch für eine Handkarre, 5 Pfennig für Erwachsene und 3 Pfennig für Kinder. Die Zahl der Fahrgäste war sehr gering, lediglich bei Kirmes in Lohmar oder Altenrath war mehr zu tun. Die Einnahmen waren also sehr niedrig. Eine kleine zusätzliche Einnahmequelle bestand in der Schankerlaubnis, angedeutet durch einen in der Nähe der Haustür stehenden Wacholderstrauch. So verlief das Fährdienstleben, das bald von Bertram Kronenberg, der am 4. 11. 1893 Anna Catharina Lehr geheiratet hatte, übernommen wurde. Anna Catharina Kronenberg, »et Fahr-Tring« genannt, übernahm den Fährdienst. Von ihr wird erzählt, dass sie öfters zudringlichen Fahrgästen eine Abkühlung verschaffte, indem sie ihnen ein unfreiwilliges Bad in der kühlen Agger verschaffte. Doch sehr bald, nämlich 1899, kam es zur Fertigstellung der Aggerbrücke. Damit hatte dann die Fähre ausgedient und wurde stillgelegt. Kurze Zeit später, am 26. 1. 1901, starb Sibylla Lehr, »de Buchholz-Möhn« und fünf Jahre später, am 17. 6. 1906 Wilhelm Lehr. | |
1976 ließen sich vor dem Standesbeamten Hans Köb im Lohmarer Rathaus Renate und Reiner Krämer trauen. Beide stammen aus bekannten Lohmarer Familien und engagieren sich seit Gründung in der Bürgerstiftung Lohmar. Renate, geb Braschoß stammt aus der... 1976 ließen sich vor dem Standesbeamten Hans Köb im Lohmarer Rathaus Renate und Reiner Krämer trauen. Beide stammen aus bekannten Lohmarer Familien und engagieren sich seit Gründung in der Bürgerstiftung Lohmar. Renate, geb Braschoß stammt aus der Burg Lohmar. Ihre Mutter Gerta Wasser hatte 1962 die rechte Hälfte der Burg Lohmar geerbt und zuvor den Landwirt Josef Braschoß aus Spich geheiratet. Reiner Krämer war bis 2005 Inhaber und Geschäftsführer der Firma Kudla Elektrobau, die über drei Generationen im Familienbesitz war. In dem Filmausschnitt von 1976 sind neben dem Brautpaar und dem Standesbeamten die beiden inzwischen verstorbenen Trauzeugen die Mutter des Bräutigams Charlotte Krämer und der Vater der Braut Josef Braschoß bei ihrer Unterschrift festgehalten. | |
|
1983
In Zeiten des Corona- Lockdowns wird es 2021 am Karnevalsdienstag keinen Umzug des „Äezebärs“ (Erbsenbär) - eine weitgehend ausgestorbene Tradition, die in Lohmar erhalten geblieben ist und sogar 2008 in der Gründung des Vereins „Ääzebär e. V.“... In Zeiten des Corona- Lockdowns wird es 2021 am Karnevalsdienstag keinen Umzug des „Äezebärs“ (Erbsenbär) - eine weitgehend ausgestorbene Tradition, die in Lohmar erhalten geblieben ist und sogar 2008 in der Gründung des Vereins „Ääzebär e. V.“ mündete - durch die Straßen geben. Dieses Brauchtum geht zurück ins 19. Jahrhundert. In Köln ist der „Ähzenbär“ schon 1859 bezeugt als Teilnehmer des Rosenmontagszuges. Im Bonner Land tanzte der Äezebär bei den Heischeumzügen – auch als Köttzoch bekannt – auf den Straßen. Die verkleideten jungen Leute sammelten Speck, Eier, Wurst und Geld ein. Das Erheischte wurde anschließend verzehrt. Bei dem Äezebär-Treiben am Karnevalsdienstag in Lohmar werden die gesammelten Geldspenden einem gemeinnützigen Zweck zugeführt.
| |
Neben Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter bildet der Karneval im Rheinland die 5. Jahreszeit. Der erste närrische Höhepunkt ist die Proklamation der Tollitäten. In der Session 2020/21 sollten Prinz Wolfgang I. (Boldt), Bauer Rolf (Pauli) und Jungfrau... Neben Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter bildet der Karneval im Rheinland die 5. Jahreszeit. Der erste närrische Höhepunkt ist die Proklamation der Tollitäten. In der Session 2020/21 sollten Prinz Wolfgang I. (Boldt), Bauer Rolf (Pauli) und Jungfrau Andrea (Andrè Bläß) von der Tanzgruppe „De Drömdöppe“ die Lohmarer Jecken regieren. Doch der Corona-Lockdown verhinderte nahezu alle Traditionsveranstaltungen, so auch die Proklamationssitzung des KAZI. Das designierte Dreigestirn kann sich aber auf die nächste Session freuen, da die Karnevalsgesellschaft „Ahl Jecke“ sich bereit erklärte, ihre Narrenherrschaft um ein Jahr zu verschieben. Sie wird dann 2022/23 zum „77 jährigen“ die Tollitäten stellen. Zahlreiche Lohmarer Prinzen kommen aus den Reihen der KG „Ahl Jecke“, angefangen 1952 mit Gerhard Schönenborn. 1976 wurde ihr Gründungsmitglied Bältes I. (Krieger) und seine Frau Anneliese I. von Bürgermeister Hans Günther van Allen proklamiert. Die Sitzung leitete Sitzungspräsident Werner Knorre. Die Regierungserklärung verlas Adjudant Josef van der Viefen. Die Tanzcorps "Lühmere Mädche" und die Kazi-Funken "Rut Wieß" mit ihrem Tanzmarichen Elke Nitsch (verh. Jahnke) und Tanzoffizier Klaus Schröder sowie viele weitere einheimische Kräfte gaben sich die Ehre. Horst König hat Ausschnitte in einer Filmaufnahme über die Gemeinde Lohmar festgehalten.
| |
|
1976
Der Filmausschnitt erinnert an die legendären Hauptschulsitzungen, die Rektor Hans-Georg Fingerhuth(Vorschaubild) 1963 ins Leben rief und die leider 2013 - auch weil die Haupstschule aufgelöst wurde - nach 50 jähriger Tradition ein Ende nahmen. 36... Der Filmausschnitt erinnert an die legendären Hauptschulsitzungen, die Rektor Hans-Georg Fingerhuth(Vorschaubild) 1963 ins Leben rief und die leider 2013 - auch weil die Haupstschule aufgelöst wurde - nach 50 jähriger Tradition ein Ende nahmen. 36 Jahre organisierte Hauptschullehrer Erwin Rußkowski als Sitzungspräsident den Schulkarneval. Schön, dass er diese Nachwuchs- Förderung der rheinischen Mundart und des Karnevalsbrauchs in dem Verein „Saach hür ens“ fortgesetzt hat und hier weitere fantastische Karnevalssitzungen veranstaltet, wenn nicht gerade wie in der Session 2020/21ein Corona-Virus den Karnevals-Virus überbietet. | |
|
1984
Das Gedicht „En de Weihnachtszek“ hat Bernhard Walterscheid-Müller (1918 - 1991) auf eine Tonkassette gesprochen. In der heimatlichen Mundart „Lühmer Platt“ liest er aus seinem Buch „Heimatliche Winterzeit – Erinnerungen“ vor und lässt uns die... Das Gedicht „En de Weihnachtszek“ hat Bernhard Walterscheid-Müller (1918 - 1991) auf eine Tonkassette gesprochen. In der heimatlichen Mundart „Lühmer Platt“ liest er aus seinem Buch „Heimatliche Winterzeit – Erinnerungen“ vor und lässt uns die weihnachtliche Atmosphäre und Kinderträume in den 1920er Jahren nachempfinden. Ein Auszug des Vortrages ist in der Audiodatei enthalten. | |
|
1984
Zwar ist Corona-Pandemie von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres 2020 gewählt worden, aber auch die Bewegung "Fridays for Future" mit den Themen Klimawandel und Erderwärmung hat die öffentliche Diskussion beherrscht. Viele... Zwar ist Corona-Pandemie von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres 2020 gewählt worden, aber auch die Bewegung "Fridays for Future" mit den Themen Klimawandel und Erderwärmung hat die öffentliche Diskussion beherrscht. Viele fragen sich in der winterlichen Weihnachtszeit, ob unsere Kinder zu Hause jemals noch mal eine geschlossene Schneedecke über mehrere Wochen erleben werden - so wie früher. Wie die Kinder ihre Freizeit im Winter 1928 verbrachten, erzählt Bernhard Walterscheid-Müller (1918 - 1991) in seiner Muttersprache in "Lühmer Platt". Ein Auszug aus einer Aufnahme auf Tonkassette ist auf der Audiodatei zu hören.
| |
Traditionsgemäß läuft im November die Theatersaison beim Dilettantenverein in Neuhonrath. Die Laienschauspieler strapazieren dann 3 bis 4 mal wöchentlich vor ausverkauftem Haus auf der Baacher Bühne in Neuhonrath die Lachmuskeln der Zuschauer. So war... Traditionsgemäß läuft im November die Theatersaison beim Dilettantenverein in Neuhonrath. Die Laienschauspieler strapazieren dann 3 bis 4 mal wöchentlich vor ausverkauftem Haus auf der Baacher Bühne in Neuhonrath die Lachmuskeln der Zuschauer. So war es noch bis 2019. In 2020 mussten leider alle Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Der Filmauschnitt von 1976 erinnert an die Zeit als der Verein im Saal des Gasthauses "Auf dem Berge" in Höffen seine Vereinsbühne hatte. 1976 drehte Horst König unter der Schirmherrschaft des damaligen Gemeindedirektors Albrecht Weinrich ein Film über Streifzüge durch die Gemeinde Lohmar. Eine Videonachbearbeitung durch Wolfgang Hilleke, Honrath wurde durch den Verkehrs- und Verschönerungsverein Wahlscheid unterstützt.
| |
|
1989
Den Ausklang des Video-Films "Lohmar live" aus dem Jahr 1989 untermalte die Singgemeinschaft Birk - 8-facher Meisterchor im Chorrverband NRW - mit dem Lohmar Lied. Rolf Pohle hatte es komponiert und der ehemalige Bürgermeister Wilhelm Schulte den... Den Ausklang des Video-Films "Lohmar live" aus dem Jahr 1989 untermalte die Singgemeinschaft Birk - 8-facher Meisterchor im Chorrverband NRW - mit dem Lohmar Lied. Rolf Pohle hatte es komponiert und der ehemalige Bürgermeister Wilhelm Schulte den Text dazu geschrieben. Jürgen Morich hatte 1989 den Videowettbewerb der Gemeinde Lohmar gewonnen und in einem Querschnitt die Geschichte des Jahres 1989 in Lohmar in bewegten Bildern festgehalten. | |
Peter Büscher (geb. 1901) erzählt in einem Gespräch mit Hans Dieter Heimig im Jahr 1983 über seine Erinnerungen an den Ulrather Hof. Der Ulrather Hof befand sich im Lohmarer Wald nahe der Agger auf dem Weg zum Brückberg in Siegburg. Viele Lohmarer... Peter Büscher (geb. 1901) erzählt in einem Gespräch mit Hans Dieter Heimig im Jahr 1983 über seine Erinnerungen an den Ulrather Hof. Der Ulrather Hof befand sich im Lohmarer Wald nahe der Agger auf dem Weg zum Brückberg in Siegburg. Viele Lohmarer waren um 1900 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges in den Königlichen Werken, das sind die Preußischen Rüstungsbetriebe Feuerwerkslaboratorium und Geschoßfabrik, auf dem Brückberg beschäftigt und gingen zu Fuß oder fuhren mit dem Fahrrad am „Ulerod“ vorbei zu ihrer Arbeit. Der Ulrather Hof ist nach seinen Urahnen, den Herren von Ulroide, die schon 1380 ihr Erbe – den Ulrather Hof – verkauften, benannt. Bei einer Steuerschätzung im Jahre 1565 war der Hof schon verfallen. Aus dieser Zeit stammt noch die heutige Ruine, die man über den Waldweg nördlich der Bundestraße 56 n entlang erreichen kann. Hier findet die jährliche Gedenkfeier der Stadt Siegburg statt zur Erinnerung an drei luxemburgische Kriegsgefangene, die hier am 23 August 1944 ermordet wurden. 1903 entstand bei der Ruine ein Waldrestaurant mit großem Gastgarten, das aber nach dem Zweiten Weltkrieg aufgegeben und im August 1964 abgerissen wurde, um der Autobahnauffahrt nach Bonn Platz zumachen. | |
1989 interviewte Jürgen Morich den damaligen Gemeindedirektor Horst Schöpe. Unter dem Thema „Lohmar live“ hatte die Gemeinde Lohmar 1989 einen Videowettbewerb ausgeschrieben. Der Film von Jürgen Morich erhielt den ersten Preis. Er hatte zahlreiche... 1989 interviewte Jürgen Morich den damaligen Gemeindedirektor Horst Schöpe. Unter dem Thema „Lohmar live“ hatte die Gemeinde Lohmar 1989 einen Videowettbewerb ausgeschrieben. Der Film von Jürgen Morich erhielt den ersten Preis. Er hatte zahlreiche kulturelle und kommunalpolitische Ereignisse sowie Vereinsveranstaltungen festgehalten. Horst Schöpe war 1959 in den Dienst der Gemeinde Wahlscheid eingetreten. 1984 wurde er zum Beigeordneten der Gemeinde Lohmar und 1988 zum Gemeindedirektor gewählt. 1991 wurde Lohmar Stadt und der Verwaltungschef führte den Amtstitel Stadtdirektor. Am 3.Nov.1994 wählte Ihn der Rat der Stadt Lohmar zum ersten hauptamtlichen Bürgermeister. Bei der Kommunalwahl 1999 wurde er von der Bürgerschaft direkt gewählt. 2004 verabschiedete sich Horst Schöpe nach 45 Dienstjahren. | |
|
1978
In dem Audio-Clip erzählt Josef Kümmler in „Lühmer Platt“, weshalb die Pfarrei Lohmar zur Zeit Pfarrer Düsterwalds Anfang des 20. Jahrhunderts besonders attraktiv war. Hans Dieter Heimig hat im Jahr 1978 einige Gespräche mit alten Lohmarerinnen und... In dem Audio-Clip erzählt Josef Kümmler in „Lühmer Platt“, weshalb die Pfarrei Lohmar zur Zeit Pfarrer Düsterwalds Anfang des 20. Jahrhunderts besonders attraktiv war. Hans Dieter Heimig hat im Jahr 1978 einige Gespräche mit alten Lohmarerinnen und Lohmarern auf Tonkassetten festgehalten, u.a. auch mit dem verstorbenen Lohmarer Orginal Josef Kümmler (Jahrgang 1897), bekannt als „Kümmlers Jüpp“. Josef Kümmler hatte einen Friseurladen in Lohmar an der Hauptstraße 59 – neben der Lindenapotheke -, den später sein Sohn Bruno Kümmler weiterführte. Die Friseurstube war mit Hilfe von Sünner-Korn und Strang-Tabak der Umschlagplatz für Dorfgeschichten. Ein lustiger Ausspruch zu Neujahr 1946 ist in der Vereinschronik der KG „Ahl Jecke“ von ihrem Ehrenmitglied Bernd Palm festgehalten: „Prosit Neujohr, de Katz die hätt kenn Hohr, de Hungk hätt kene Stüpp, dat säht de Kümmlers Jüpp“.
| |
|
1989
Der Videoausschnitt zeigt das Geschehen um die Kommunalwahl im Jahr 1989. Sie endete im Ergebnis in einer großen Koalition von CDU und SPD. Rolf Lindenberg wurde zum Bürgermeister gewählt. Seine Amtsperiode dauerte bis 1994. Er war der letzte... Der Videoausschnitt zeigt das Geschehen um die Kommunalwahl im Jahr 1989. Sie endete im Ergebnis in einer großen Koalition von CDU und SPD. Rolf Lindenberg wurde zum Bürgermeister gewählt. Seine Amtsperiode dauerte bis 1994. Er war der letzte ehrenamtliche Bürgermeister in Lohmar. Danach wurde durch die Änderung der Kommunalverfassung die sogenannte Doppelspitze (Stadtdirektor – Bürgermeister) abgeschafft und der hauptamtliche Bürgermeister eingeführt. Unter dem Thema „Lohmar live“ hatte die Gemeinde Lohmar 1989 einen Videowettbewerb ausgeschrieben. Der Film von Jürgen Morich erhielt den ersten Preis. Er hatte zahlreiche kulturelle und kommunalpolitische Ereignisse sowie Vereinsveranstaltungen festgehalten. | |
|
1976
Die traditionelle Rathauserstürmung am Rosenmontag wurde von der ältesten Lohmarer Karnevalsgesellschaft „Ahl Jecke“ ins Leben gerufen. Der Videoausschnitt aus „Unsere Gemeinde Lohmar“ zeigt den Sturm auf das Rathaus 1976 als das Prinzenpaar Bältes... Die traditionelle Rathauserstürmung am Rosenmontag wurde von der ältesten Lohmarer Karnevalsgesellschaft „Ahl Jecke“ ins Leben gerufen. Der Videoausschnitt aus „Unsere Gemeinde Lohmar“ zeigt den Sturm auf das Rathaus 1976 als das Prinzenpaar Bältes I. und Anneliese I. (Krieger) das Narrenvolk regierte. Bältes Krieger war Gründungsmitglied der „Ahl Jecke“ im Jahr 1946. Gemeindedirektor Weinrich und Bürgermeister Dr. Hans Günther van Allen erklärten den Rücktritt.
| |
Der Filmausschnitt zeigt die Verabschiedung von Pfarrer Fritz Pleuger im Sommer 1976 in der Wahlscheider St. Bartholomäus-Kirche auf dem Berg. Der Filmausschnitt zeigt die Verabschiedung von Pfarrer Fritz Pleuger im Sommer 1976 in der Wahlscheider St. Bartholomäus-Kirche auf dem Berg.
| |
|
1976
40 Tage nach Ostersonntag ist Christi Himmelfahrt. Der Tag ist seit 1934 in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag und fällt immer auf einen Donnerstag. Schon im Mittelalter wurde Christi Himmelfahrt auch als Vatertag bezeichnet, allerdings im... 40 Tage nach Ostersonntag ist Christi Himmelfahrt. Der Tag ist seit 1934 in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag und fällt immer auf einen Donnerstag. Schon im Mittelalter wurde Christi Himmelfahrt auch als Vatertag bezeichnet, allerdings im christlichen Sinne, da Jesus zu seinem Vater aufsteigt. Die Rituale des Vatertages haben ihre Wurzeln im 18. Jahrhundert in den USA, als zu einem festgelegten Zeitpunkt die jungen Männer in die Sitten und Gebräuche des Erwachenenlebens eingeführt wurden. Vatertagstouren in Lohmar waren auf der Agger sehr beliebt. Der Videoauschnit aus dem Film "Unsere Gemeinde Lohmar", von Horst König, aus dem Jahr 1976 lässt einen die Gaudi nachempfinden. Die feucht fröhlichen Männergelage sind allerdings auf dem Rückzug. Heute wird Vatertag mehr und mehr als Familientag für Ausflüge genutzt. | |
|
1976
1976 drehte Horst König unter der Schirmherrschaft des damaligen Gemeindedirektors Albrecht Weinrich ein Film über Streifzüge durch die Gemeinde Lohmar. Eine Videonachbearbeitung durch Wolfgang Hilleke, Honrath wurde durch den Verkehrs- und... 1976 drehte Horst König unter der Schirmherrschaft des damaligen Gemeindedirektors Albrecht Weinrich ein Film über Streifzüge durch die Gemeinde Lohmar. Eine Videonachbearbeitung durch Wolfgang Hilleke, Honrath wurde durch den Verkehrs- und Verschönerungsverein Wahlscheid unterstützt. Der Filmausschnitt zeigt eine Sitzung des Gemeinderates unter der Leitung des Bürgermeisters (1975-1984) Dr. Hans Günther van Allen mit vielen bekannten Persönlichkeiten aus dem politischen Gemeindeleben, u.a. die späteren ehrenamtlichen Bürgermeister Wilhelm Schulte (1969-1975 u.1984-1989), Rolf Lindenberg (1989-1994) und die hauptamtlichen Bürgermeister Horst Schöpe (1994-2004), Wolfgang Röger (2004-2014). | |
Das Sportfest 1955 auf dem ehemaligen Sportplatz am Breiter Weg fand großen Zuspruch bei den Zuschauern. Unter der Leitung von Hans Braschoß zeigen die Mädchen- und die Jungenriege des TUS Lohmar (heute TV Lohmar) eine Reihe von Turnübungen. Der... Das Sportfest 1955 auf dem ehemaligen Sportplatz am Breiter Weg fand großen Zuspruch bei den Zuschauern. Unter der Leitung von Hans Braschoß zeigen die Mädchen- und die Jungenriege des TUS Lohmar (heute TV Lohmar) eine Reihe von Turnübungen. Der Filmausschnit aus "Bei uns zu Haus" hält das Ereignis fest. | |
|
1955
Der Filmausschnitt von "Bei uns zu Haus" zeigt eine Übung der Lohmarer Feuerwehr aus dem Jahr 1955. Der Feuerwehreinsatz startete am Spritzenhaus in der damaligen Mittelstraße - dort wo heute das Rathaus steht -. Das Übungsgelände war an der... Der Filmausschnitt von "Bei uns zu Haus" zeigt eine Übung der Lohmarer Feuerwehr aus dem Jahr 1955. Der Feuerwehreinsatz startete am Spritzenhaus in der damaligen Mittelstraße - dort wo heute das Rathaus steht -. Das Übungsgelände war an der Bachstraße auf dem heutigen Gelände des Evangelischen Altenheims | |
|
1955
Der Film zeigt die Kirche Sankt Johannes im Jahr 1955 und einige Akteure aus dieser Zeit. Er ist ein Ausschnitt aus dem Heimatfilm "Bei uns zu Haus", der damals vom Männerchor Lohmar aufgenommen wurde. Der Film zeigt die Kirche Sankt Johannes im Jahr 1955 und einige Akteure aus dieser Zeit. Er ist ein Ausschnitt aus dem Heimatfilm "Bei uns zu Haus", der damals vom Männerchor Lohmar aufgenommen wurde. | |
|
1955
Im Park Lohmarhöhe befand sich bis Anfang der 1960er Jahre der erste Kindergarten in Lohmar. Träger des Kindergartens war die Ordensgemeinschaft vom "armen Kinde Jesu". Der Orden wurde 1844 von Clara Fey gegründet. Einen kleinen Einblick in den Park... Im Park Lohmarhöhe befand sich bis Anfang der 1960er Jahre der erste Kindergarten in Lohmar. Träger des Kindergartens war die Ordensgemeinschaft vom "armen Kinde Jesu". Der Orden wurde 1844 von Clara Fey gegründet. Einen kleinen Einblick in den Park und die Abläufe im Jahr 1955 gibt der Filmausschnitt aus dem Heimatfilm des Männergesangverein Lohmar. | |
|
20. November 1978
In einem Gespräch mit Hans Dieter Heimig im Jahre 1978 erzählt Josef Kümmler, Jahrgang 1894 und Peter Büscher, Jahrgang 1901 von der Zeit als das Bürgermeisteramt in Lohmar, Hauptstraße 27 gebaut wurde. Im April 1908 bezog der damalige Bürgermeister... In einem Gespräch mit Hans Dieter Heimig im Jahre 1978 erzählt Josef Kümmler, Jahrgang 1894 und Peter Büscher, Jahrgang 1901 von der Zeit als das Bürgermeisteramt in Lohmar, Hauptstraße 27 gebaut wurde. Im April 1908 bezog der damalige Bürgermeister Ludwig Postorff mit seiner Verwaltung das neu errichtete Bürgermeisteramt. Bis dahin hatte er in Donrath residiert. Die Bedeutung von Lohmar als Zentralort des Amtes und seiner Gemeinden nahm seitdem ständig zu. | |
In einer eleganten S-Form schwingt sich die im Mai 2013 eröffnete an zwei stählernen Pylonen aufgehängte Holzbrücke über die Agger in Wahlscheid. Sie soll für Fußgänger und Radfahrer die Erweiterung des Landschaftsgartens Aggerbogen auf der anderen... In einer eleganten S-Form schwingt sich die im Mai 2013 eröffnete an zwei stählernen Pylonen aufgehängte Holzbrücke über die Agger in Wahlscheid. Sie soll für Fußgänger und Radfahrer die Erweiterung des Landschaftsgartens Aggerbogen auf der anderen Flussseite erschließen und die überwiegend kleinen Besucher der Naturschule über die Agger bringen. Auch soll sie das Radfahren im Aggertal verbessern. Mit der Hängebrücke wurden Pfeiler im Flussbett vermieden, die bei Hochwasser die Strömung behindern könnten. Durch die S-Form konnte eine Brückenlänge von 62 Metern untergebracht werden, so dass die Fahrbahn nur eine maximale Steigung von 6% aufweist und damit auch für Rollstuhlfahrer benutzbar ist.
| |
Peter Büscher, Jahrgang 1901, erzählt in einem Gespräch mit Hans Dieter Heimig im Jahre 1978 u.a. von der Wallfahrt nach Seligenthal und einer möglichen Heiligenerscheinung in der Pützerau in Lohmar. 1689 ging nachweislich die erste Fußwallfahrt von... Peter Büscher, Jahrgang 1901, erzählt in einem Gespräch mit Hans Dieter Heimig im Jahre 1978 u.a. von der Wallfahrt nach Seligenthal und einer möglichen Heiligenerscheinung in der Pützerau in Lohmar. 1689 ging nachweislich die erste Fußwallfahrt von Lohmar zum heiligen Rochus nach Seligenthal. Rochus (1275-1327) gilt als Schutzpatron der Pilger und Reisenden und als Nothelfer bei ansteckenden Krankheiten, insbesondere der Pest. 1709 wurde die barocke Wallfahrtskapelle Sankt Rochus südwestlich des Klosters Seligenthal errichtet. Die Pilger aus Altenrath, Scheiderhöhe und Lohmar gingen vom alten Lohmarer Kirchdorf über den früheren »Thalweg« (hergeleitet von Seligenthal) oberhalb der heutigen Pützerau, vorbei am heutigen Reiterhof Waldeck zur »Zwölf-Apostel-Buche«. Über den Reit- und Wanderweg A 2 vorbei am Haus Rothenbach ging es dann über die Zeithstraße durch den Kaldauer Wald Richtung »Dall« (Thal). Die Sage vom Heiligensprung bezieht sich auf ein Flurstück in der Lohmarer Pützerau (Pützer(h)au bedeutet die Hau - abzuholzendes Waldgrundstück- des alten Pützerhofes in der Kirchstraße). Hier liegt in der Nähe des Talweges das Flurstück "Der Engelssprung" mit einem kleinen Quell, dem sogenannten Maibronnen. Hier in der Nähe wurden viele Dorffeste veranstaltet. Die alten Leute erzählten sich früher, dass man hier in früheren Jahren eine feenhafte Gestalt erblickt hätte, die gnadenreichen Einfluss ausgeübt hätte.
| |
|
11. Februar 2024
Die erste Eucharistiefeier im Kölner Dialekt fand am 29. Febr. 1976 in der Liebfrauenkirche in Köln Mülheim statt anlässlich des hundertsten Geburtstages des Kölner Komponisten Willi Ostermann, der dort getauft worden war. Am 11. Febr. 2024, der... Die erste Eucharistiefeier im Kölner Dialekt fand am 29. Febr. 1976 in der Liebfrauenkirche in Köln Mülheim statt anlässlich des hundertsten Geburtstages des Kölner Komponisten Willi Ostermann, der dort getauft worden war. Am 11. Febr. 2024, der Sonntag vor Rosenmontag, wurde in der Lohmarer Pfarrkirche Sankt Johannes die „Kölsche Mess“ gefeiert. Der Vorsitzende des Vereinskomitees Lohmar Hansel Fingerhuth erinnerte an die Ursprünge und dankte Heribert Frielingsdorf, dem Ehrenmitglied und Ehrensitzungspräsidenten des KAZI Lohmar, der 1994 die Initiative zu der Messfeier in Mundart ergriffen hatte. Heribert Frielingsdorf hatte den volkstümlichen Kölner Pfarrer Professor Gerhard Herkenrath, der für seine kölsche Messen beliebt war, im Kölner Stadtgarten erlebt und nahm begeistert die Idee mit nach Lohmar. Dort konnte er mit Hilfe seiner Schwester Ursula Pfarrer Albrecht Hey überzeugen, obwohl dieser gebürtiger Düsseldorfer war. Das erste Zwiegespräch in der "Kölsche Mess" in Sankt Johannes hielten 1994 Heribert Frielingsdorf und Adi Arz. Umrahmt war die Messfeier 2024 in Sankt Johannes von vielen kostümierten Jecken unter der Regentschaft des Lohmarer Dreigestirns Prinz Bork I., Bauer Sven und Jungfrau Maximiliane. Pfarrer Francis und Diakon Roos waren die närrischen Geistlichen. In einem Zwiegespräch beleuchteten Johannes Wingenfeld (Kazi-Sitzungspräsiden) und Henning Jahnke (Sitzungspräsident „Saach hür ens“) die gesellschaftliche Stimmungslage und riefen dazu auf, mehr das „Wir“ und weniger das „Ich“ in den Vordergrund zu stellen. Für eine besondere karnevalistische und gleichzeitig besinnliche Stimmung sorgte die musikalische Begleitung von Regina und Jupp Mester und den „Halunken“.
| |
|
20. Dezember 2023
Nach fast 50 Jahren am Standort des Wegekreuzes in der Schmiedgasse 10 wurde das Denkmal von der Firma Markus Weisheit, Steinmetz und Bildhauerwerkstatt aus Siegburg kurz vor Weihnachten am 20. Dez. 2023 demontiert. Es soll restauriert und im Bereich... Nach fast 50 Jahren am Standort des Wegekreuzes in der Schmiedgasse 10 wurde das Denkmal von der Firma Markus Weisheit, Steinmetz und Bildhauerwerkstatt aus Siegburg kurz vor Weihnachten am 20. Dez. 2023 demontiert. Es soll restauriert und im Bereich des Rathausvorplatzes in der Nähe des ursprünglichen Standortes (Meurers Eck) wieder aufgebaut werden. Längere Zeit hatte sich der frühere Vorsitzende des Heimatvereins Lohmar Gerd Streichardt und Wolfgang Weber, Leiter der Heimatpflege- und Naturschutzgruppe im Heimatverein für den Erhalt eingesetzt. Letztlich entschied die Stadt Lohmar, das denkmalgeschützte Wegekreuz restaurieren und wieder aufzustellen zu lassen.
| |
|
12. Dezember 2023
Zu den Öffnungszeiten des HGV Hauses in der Bachstraße 12 a trifft sich regelmäßig dienstagsvormittags ein Personenkreis rund um die Archivgruppe des Heimatvereins zum "Verzäll". Von Anfang an mit dabei ist Hans Dieter Heimig, Gründungs- und... Zu den Öffnungszeiten des HGV Hauses in der Bachstraße 12 a trifft sich regelmäßig dienstagsvormittags ein Personenkreis rund um die Archivgruppe des Heimatvereins zum "Verzäll". Von Anfang an mit dabei ist Hans Dieter Heimig, Gründungs- und Ehrenmitglied des Vereins und stets eine besondere Erzählung im Gepäck. So auch am 12.Dezember 2023. Er präsentierte eine kleine Statue einer Frauenfigur, die er vor Jahren auf einer Reise erworben hatte. Sie ist die Nachbildung der Venus von Willendorf. Die Venus von Willendorf ist eine knapp 11 cm hohe Figurine und eine der wichtigsten Zeugnisse beginnender Kunst in Europa, die im Naturhistorischen Museum in Wien aufbewahrt wird. Sie besitzt eine Ausstrahlung - gesichtslos, ohne Füße und kaum erkennbare Hände -, die ihr eine besondere Anziehung zukommen lässt. Sie ist ca. 30.000 Jahre alt und wurde 1908 in der Wachau (Öesterreich) gefunden. Jüngste Forschungen haben ergeben, dass das Material, die Gesteinsart Oolith, vermutlich aus Norditalien stammt. Weitere Untersuchungen könnten auch Aufschluss geben über den Aufenthalt und die Mobilität der frühen Menschen im Alpenraum. Der berühmte "Ötzi" existierte erst viel später vor 5.300 Jahren. | |
|
27. Juni 1943
In der Nazizeit wurde 1939 verboten, mit Sakramentsprozessionen durchs Dorf zu ziehen. Unter dieses Verbot fiel auch die Fronleichnamsprozession. Am 60. Tag nach Ostern – am zweiten Donnerstag nach Pfingsten – feiern die Katholiken seit Jahrhunderten... In der Nazizeit wurde 1939 verboten, mit Sakramentsprozessionen durchs Dorf zu ziehen. Unter dieses Verbot fiel auch die Fronleichnamsprozession. Am 60. Tag nach Ostern – am zweiten Donnerstag nach Pfingsten – feiern die Katholiken seit Jahrhunderten das „Fest des heiligsten Blutes und Leibes Christi“. Schon 1279 zog die Prozession durch Köln, bei der das geweihte Brot in einer Monstranz durch die Straßen getragen wird. In der handschriftlich verfassten Pfarrchronik der Pfarrei Lohmar berichtet Pfarrer Wilhelm Offergeld, dass 1943 das Fronleichnamsfest auf den nächsten Sonntag, den 27. Juni verlegt wurde. Zum ersten Mal seit 1939 wurde außerhalb der Kirche wieder eine Sakramentsprozession abgehalten, die sich jedoch auf den Friedhof beschränken musste. | |
Wenige Jahre nach dem zweiten Weltkrieg veranstaltete der Lohmarer Kirchenchor St. Cäcilia Karnevalssitzungen zunächst im Pfarrsaal (heute Lidl Parkplatz Kirchstraße) und später im Saal Hotel "Zur Linde". Die Sitzungen wurden durch eigene Kräfte... Wenige Jahre nach dem zweiten Weltkrieg veranstaltete der Lohmarer Kirchenchor St. Cäcilia Karnevalssitzungen zunächst im Pfarrsaal (heute Lidl Parkplatz Kirchstraße) und später im Saal Hotel "Zur Linde". Die Sitzungen wurden durch eigene Kräfte gestaltet. Die Nachfrage war groß und der Saal meistens zu klein, um alle Besucherwünsche zu erfüllen. | |
In der Februar Revolution 1848 in Frankreich wurde der König zur Abdankung und zur Flucht gezwungen und die Zweite franz. Republik ausgerufen. Die Nachricht vom gelungenen Aufstand in Frankreich setzte die "März-Revolution" in Deutschland in Gang.... In der Februar Revolution 1848 in Frankreich wurde der König zur Abdankung und zur Flucht gezwungen und die Zweite franz. Republik ausgerufen. Die Nachricht vom gelungenen Aufstand in Frankreich setzte die "März-Revolution" in Deutschland in Gang. In Lohmar war in dieser Zeit Josef Busbach Bürgermeister (1840 – 1851). Er hatte das Bürgermeisteramt von Haus Rottland in Donrath in den Frohnhof – eines der ältesten Gebäude im Kirchdorf in Lohmar - verlegt. Von Ereignissen in Lohmar, die er als 11jähriger um 1848/49 erlebt hatte, erzählte der 93jährige Jakob Gerhards 1930 dem Lehrer Karl Schmidt. Bernhard Walterscheid Müller hat sie in der Schulchronik festgehalten: „Es war an einem Märztag, als das sonst so ruhige, friedliche Leben im Dorf in Unruhe und Bewegung geriet. Schon den ganzen Morgen hatten sich Gruppen von Männern auf der Straße versammelt, um schlimme Nachrichten von draußen zu diskutieren. Am Abend sollte im Gasthof „Zum Schwanen“ im alten Backeshof neben dem heutigen neuerbauten Schwanenhof (2020 wurde die Gaststätte endgültig geschlossen) eine Zusammenkunft alter Männer stattfinden. Die Gebrüder van der Vieven würden als die führenden Demokraten des Dorfes sprechen. Mit Anbruch der Dunkelheit gingen die Männer, teils mit Gewehren bewaffnet, zum Lokal. Einige wurden von ihren Frauen begleitet, die ihre „Helden" aufzuhalten trachteten. Auf dem Tisch stand einer der Gebrüder van der Vieven, von Beifall häufig unterbrochen, lautstark über Freiheit, Mitverantwortung in Staat und Gemeinde und über den drillhaften preußischen Kommiß sich auslassend. Frauen und Jugendliche standen draußen an den Fenstern, ergriffen lauschend. Drinnen war die Stimmung dem Siedepunkt nahe. Der Sturm auf das Siegburger Zeughaus 1849 ging von einer etwa 100 Mann starken Truppe aus Bonn aus und endete in einem Fiasko. Im Zeughaus lagerten Waffen, deren man sich bemächtigen wollte, um die Errungenschaften der Revolution zu verteidigen. Kurz nachdem die Freischärler das rechtsrheinische Gebiet betreten hatten, wurden sie von Dragonern widerstandslos in alle Himmelsrichtungen zersprengt.
| |
|
22. November 2022
Im Alter von 82 Jahren verstarb am 22. November 2022 der ehmalige Bürgermeister der Stadt Lohmar, Rolf Lindenberg. Er amtierte von 1989 bis 1994 und wurde nach Änderung der Kommunalverfassung durch den hauptamtlichen Bürgermeister Horst Schöpe... Im Alter von 82 Jahren verstarb am 22. November 2022 der ehmalige Bürgermeister der Stadt Lohmar, Rolf Lindenberg. Er amtierte von 1989 bis 1994 und wurde nach Änderung der Kommunalverfassung durch den hauptamtlichen Bürgermeister Horst Schöpe abgelöst. Rolf Lindenberg war ein Wahlscheider Urgestein. Er wurde am 5. Januar 1940 im Müllerhof in Wahlscheid geboren und lebte bis zu seinem Tod in Wahlscheid. Beruflich war er von 1970 bis 2003 Geschäftsführer des ev. Altenheim Wahlscheid e. V.. In seiner Freizeit engagierte er sich in der Politik und im Sport. Ein "WSV-Herz" hat aufgehört zu schlagen, überschrieb der Wahlscheider Sportverein seinen Nachruf auf Rolf lindenberg, der den Verein als Vorsitzender von 1973 bis 1981 geführt hatte. Politisch trat Rolf Lindenberg mit 24 Jahren der SPD bei. Von 1975 bis 2004 war er Mitglied des Rates der Gemeinde/Stadt Lohmar und wurde 1989 zum Bürgermeister gewählt. Besondere Höhepunkte in seiner Amtszeit waren die Stadtwerdung und die Gründung des Lohmarer Gymnasiums 1991. | |
|
30. September 2022
Einen erlebnisreichen Wandertag hatten die Kinder der Klasse 4 b der Lohmarer Waldschule am letzten Schultag vor den Herbstferien mit Wolfgang Weber und Wolfgang Röger vom Heimatverein Lohmar. Start der Wanderung war das Denkmal „Lohmarer Mühle“ Ecke... Einen erlebnisreichen Wandertag hatten die Kinder der Klasse 4 b der Lohmarer Waldschule am letzten Schultag vor den Herbstferien mit Wolfgang Weber und Wolfgang Röger vom Heimatverein Lohmar. Start der Wanderung war das Denkmal „Lohmarer Mühle“ Ecke Rathausstraße/Mühlenweg. Viele Kinder kannten zwar das Berufsbild des Müllers, wussten aber nicht, dass in der Buchbitze am Auelsbach schon im Mittelalter eine Wassermühle stand, in der für die Versorgung der Lohmarer Bevölkerung das Getreide gemahlen wurde. Weiter ging der Weg über den Mühlenweg in die Buchbitze zur Fischzucht Pilgram. Hier entdeckten die Kinder an der Hausfassade den alten Mahlstein der Wassermühle. Im Gebäude durften die Kinder Forellen in den Wasserbecken füttern und aus nächster Nähe eine große Lachsforelle bewundern, die Herr Woltering von der Firma Pilgram mit einem Fangnetz herausgefischt hatte. Einen weiteren kurzen Halt machten die Kinder an der Hinweistafel zum Naturwald Ingerberg. Sie interessierten sich nicht nur für ein Foto Ihrer Waldschule, sondern auch die für die anschaulichen Bilder über den Naturkreislauf im Naturwald. Über schmale Pfade ging es weiter über den Damm des Hochwasserrückhaltebeckens am Auelsbach bis hin zur Schutzhütte am Höhenweg in Richtung Heide. Hier wurden zwei Nistkästen von den Bäumen geholt, gesäubert und wieder aufgehängt. Als Highlight pflanzte jedes Kind und die Klassenlehrerin Simone Kampf zum Abschluss einen einheimischen Baum in den Waldpflanzgarten an der Schutzhütte. Ein selbstgestanztes Namenschild wurde anschließend an der Drahtschutzhülle des neu gepflanzten Bäumchens befestigt. Gestärkt durch kräftige Bisse in einen Apfel, den Fernsehgärtner Rüdiger Ramme für jeden gespendet hatte, machten sich die Kinder auf den Heimweg zu ihrer Waldschule. | |
|
23. Juni 1912
Auf der Lohmarer Hauptstraße wurde einige Jahre nach den 2005 abgeschlossenen Umbaumaßnahmen im Zuge der Umsetzung des Lärmaktionsplanes von 2012 im Ortszentrum Tempo 30 angeordnet. Manche Autofahrer erfahren das leidvoll bei den sporadisch... Auf der Lohmarer Hauptstraße wurde einige Jahre nach den 2005 abgeschlossenen Umbaumaßnahmen im Zuge der Umsetzung des Lärmaktionsplanes von 2012 im Ortszentrum Tempo 30 angeordnet. Manche Autofahrer erfahren das leidvoll bei den sporadisch durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen der Polizei. Schon vor mehr als hundert Jahren galt Tempo 30 in Lohmar. Anfang des 20. Jahrhunderts durften Kraftfahrzeuge in geschlossenen Ortschaften nicht schneller als 30 km/h fahren. Polizeisergeant Johann Adam Schug kontrollierte mit einem Gehilfen die Geschwindigkeit auf der Provinzialstraße heute Hauptstraße mittels Stoppuhren. Der eine stand am Anfang der andere am Ende einer Strecke von 300 Metern. Am 23. Juni 1912 erwischten sie ein Auto laut Schugs Bericht mit “54,756 km/h“ und mit „rasendem Tempo“. Der Übeltäter war Fürst Adolf von Schaumburg-Lippe zu Bückeburg. Die königliche Regierung in Köln teilte mit, dass deutsche Bundesfürsten strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden könnten. Dagegen wehrte sich der damalige Bürgermeister Ludwig Polstorff mit einem Einspruch. Leider ist nicht bekannt, wie es ausging. Auch in Wahlscheid wurde regelmäßig mit Stoppuhren kontrolliert. Hierüber beschwerte sich im Herbst 1928 der Märkische Automobil-Club e. V. Hagen und andere Mobilclubs. Im Dezember 1928 gab es eine Besichtigung der „Abstoppstrecken“ im Siegkreis und im Kreis Köln Land durch Oberregierungsrat, Polizeirat und Vertreter von Verkehrsverbund und Kreis. Als Ergebnis setzten der Lohmarer Bürgermeister und andere das „Abstoppen“ für ein halbes Jahr aus. Danach berichtete der Lohmarer Bürgermeister, dass sich die Geschwindigkeitsübertretungen kaum geändert hätten, der Nachweis allerdings jetzt nicht mehr erbracht werden könne. Jedoch meldete er, dass die Staublage zumindest durch die Pflasterung der Straße behoben sei.
| |
|
1. Mai 2022
- 1. Mai 2023 Der Brauch des Maibaumsetzens in Lohmar geht zurück auf Ende des 19. Jahrhunderts und wurde Jahrzehnte lang von dem 1897 gegründeten Junggesellenverein "Gemütlichkeit" Lohmar bis in die 1960er Jahre ausgeübt. Es gehörte zur Tradition, den Baum mit... Der Brauch des Maibaumsetzens in Lohmar geht zurück auf Ende des 19. Jahrhunderts und wurde Jahrzehnte lang von dem 1897 gegründeten Junggesellenverein "Gemütlichkeit" Lohmar bis in die 1960er Jahre ausgeübt. Es gehörte zur Tradition, den Baum mit einem Schild "Den Dorfschönen" zu widmen. Nachdem der Jungesellenverein nicht mehr existierte hat der Heimatverein Lohmar das Brauchtum 1985 wieder aufleben lassen und viele Jahre den Maibaum geschlagen und am Frouardplatz aufgestellt. Seit 2008 hat der HGV sein Vereinshaus in der Bachstraße 12 a und stellt hier am 1. Mai den Maibaum auf, den er den "Dorfschönen widmet: So auch am 1. Mai 2022 und 2023. Urkundlich sind Maibäume und -zweige schon im 13. Jahrhundert bekannt, die als Schmuckmaien, Ehren- oder Liebesmaien verschenkt wurden. Sie sind die historischen Vorläufer des Maibaum, der seit dem 16. Jahrhundert urkundlich erwähnt wird. Er ist die Vergrößerung des Segenszweiges und der Lebensrute, ein Fruchtbarkeit und Segen bringender Baum. Dem geliebten Mädchen wird ein Busch oder Maibaum als Liebeszeichen gesetzt. Oft erfährt er auch eine besonders schmuckreiche Gestaltung. | |
Anfang der 1990er Jahre stand der Bau eines Bürgerhauses in Lohmar ganz oben auf der Agenda im Rathaus. Mit Mitteln aus dem Städtebauförderprogramm wurde ein Architektenwettbewerb ausgelobt. Drei Entwürfe kamen 1993 in die engere Auswahl. Letztlich... Anfang der 1990er Jahre stand der Bau eines Bürgerhauses in Lohmar ganz oben auf der Agenda im Rathaus. Mit Mitteln aus dem Städtebauförderprogramm wurde ein Architektenwettbewerb ausgelobt. Drei Entwürfe kamen 1993 in die engere Auswahl. Letztlich entschied sich die Jury einstimmig für den Entwurf des Kölner Architekturbüros Walter von Lom. Hier war der Spagat gelungen, einen Gebäudekörper mit einem großen Saal mit 550 Sitzplätzen vor Tischen in den Park zu integrieren und gleichzeitig die den Park prägende Dominanz der Villa Friedlinde zu erhalten. Zum Bau des Bürgerhauses kam es jedoch nicht, weil die Bezirksregierung nicht sofort die notwendigen Städtebauförderungsmittel bewilligte und die Stadt sich entschied, bei der Planung der Jabachhalle 2 im Schulzentrum Donrather Dreieck neben Sport und Aula für das 1991 neu errichtete Gymnasium eine Mehrfachnutzung auch für kulturelle Veranstaltungen vorzusehen. Die Jabachhalle 2 wurde am 23. Oktober 1999 eingeweiht und bietet Platz für bis zu 1800 sitzende Gäste. Die Villa Friedlinde, die überwiegend als Begegnungsstätte für Senioren und Seniorinnen genutzt wird, wurde 2004 nach den Plänen des Archtiekten Bernd Oxen, Köln umgebaut. Die neuen erdgeschossigen Anbauten aus Sichtbeton und Glas sollen den alten Bachsteinbau umklammern.
| |
|
1. Mai 1935
- 1936 Von 1200 an ist in der höfisch-ritterlichen Welt des Mittelalters der Mairitt und Maigang am 1. Mai nachgewiesen und ab dem 16. Jahrh. auch der Brauch der Mailehen. Die Kirche feiert am 1. Mai das Fest „Josef der Arbeiter“ und in Paris wurde 1889 der... Von 1200 an ist in der höfisch-ritterlichen Welt des Mittelalters der Mairitt und Maigang am 1. Mai nachgewiesen und ab dem 16. Jahrh. auch der Brauch der Mailehen. Die Kirche feiert am 1. Mai das Fest „Josef der Arbeiter“ und in Paris wurde 1889 der 1. Mai als sozialistischer Feiertag festgelegt. Das alles wurde von den Nationalsozialisten aufgegriffen, um in ihrem Sinne am 1. Mai mit viel „Tamtam“ den Tag der Arbeit zu feiern. In dem Buch „Erzeugnisse unserer Arbeit“ der I.G.Farbenindustrie AG, Frankfurt (Main) von 1938, heißt es auf Seite 7: „Aller schaffenden deutschen Menschen Feiertag ist heute, der erste Mai! [...] Tag des Klassenkampfes und des Hasses der Menschen gegeneinander anderswo in der Welt; Tag der Nationalen Arbeit, der Ordnung und der Eintracht bei uns. Bereits zum gemeinsamen Anmarsch auf das Festgelände hörten wir die Ansprache unseres Betriebsführers und unseres Betriebsobmannes, die in dieser alljährlich sich wiederholenden Gemeinschaftsstunde mit herzlichen Worten unserer unentwegten Einsatzbereitschaft und unserem kameradschaftlichen Zusammenhalt Ausdruck verleihen.“ So wird es auch in Lohmar gewesen sein. Die Feierlichkeiten fanden auf der „Schultes Wiese“ (Hauptstraße zwischen Eissalon und Lohmarer LesArt) statt. Der verstorbene Studiendirektor und Heimatforscher Wilhelm Pape berichtet: " Am 1. Mai 1935 findet für alle Schulkinder auf der "Schultes Wiese" eine Versammlung mit der HJ des gesamten Amtes Lohmar und ihren Führern statt. Übertragen wird die Rede des Reichsjugendführers Baldur von Schirach und danach eine Rede Hitlers an alle Partei- und Volksgenossen. Anschließend marschieren Polizei, SA, SS und Mitglieder der DAF (Deutsche Arbeiterfront) über die Hauptstraße durch Lohmar". | |
|
22. September 1927
Am 22.9.1927 heiratete Katharina Maria Burger aus Donrath Heinrich Ebel aus Overath. Da die Burgers nahe der Agger wohnten, hatte sich die Hochzeitsgesellschaft am Dornheckenweg am Aggerufer mit seinem malerischen Hintergrund des Aggerlaufes mit der... Am 22.9.1927 heiratete Katharina Maria Burger aus Donrath Heinrich Ebel aus Overath. Da die Burgers nahe der Agger wohnten, hatte sich die Hochzeitsgesellschaft am Dornheckenweg am Aggerufer mit seinem malerischen Hintergrund des Aggerlaufes mit der 5-bogigen Steinbrücke (1873 fertiggestellt und 1940 vom Hochwasser zum Einsturz gebracht) für ein Foto aufgestellt. Oben links im Bild ist noch ein Teil des Spritzenhauses in Donrath zu sehen. Das Fachwerkhaus, das soeben noch durch die Bäume zu erkennen ist, ist das alte Fährhaus des „Fahr Wellem“, in dem seine Tochter Katharina Klein verh. Schwamborn die Post betrieb.
| |
|
5. Juni 1977
Der Kappellenchor Halberg feierte am 5. Juni 1977 mit einem Festkonzert in der Halberger Kapelle St. Isidor sein 25-jähriges Jubiläum. Der Kappellenchor Halberg feierte am 5. Juni 1977 mit einem Festkonzert in der Halberger Kapelle St. Isidor sein 25-jähriges Jubiläum. | |
|
1930
Im Rheinland gehörte die Fronleichnamsprozession (der Name „Fronleichnam“ bedeutet wörtlich übersetzt: Leib des Herrn) seit dem späten Mittelalter zu den Höhepunkten des Kirchenjahres, mit dem die leibliche Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der... Im Rheinland gehörte die Fronleichnamsprozession (der Name „Fronleichnam“ bedeutet wörtlich übersetzt: Leib des Herrn) seit dem späten Mittelalter zu den Höhepunkten des Kirchenjahres, mit dem die leibliche Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird. Zunächst wurde das Altarsakrament in der verschlossenen Pyxis (Hostienbehälter) mitgeführt, seit dem 14. Jahrhundert kam dann der Brauch auf, das Allerheiligste sichtbar in der Monstranz unter einem Traghimmel mitzutragen. Der Feiertag ist auf den ersten Donnerstag nach der Oktav des Pfingstfestes festgelegt. Die drei Bilder der Fronleichnamsprozession in Lohmar aus den 1920/30er Jahren zeigen eine Sequenz verschiedener Prozessionsformationen mit den Jungen an der Spitze, der feierlich in Weiß gekleideten Mädchen in ihren Kommunionkleidern in etwa an der gleichen Stelle der Hauptstraße und im dritten Bild die erkennbar große Anzahl der Pfarrangehörigen – die Frauen links, die Männer rechts und die Kinder in der Mitte. Die Prozession ging jeweils von der Pfarrkirche entlang der Kirchstraße, bog dann rechts in die Hauptstraße ein, weiter durch das Unterdorf – am Wegekreuz zwischen Rohloff und Hagen fand der sakramentale Segen statt – in die Bachstraße, dort wo Ecke Waldweg (heute Humperdinckstraße) am Wegekreuz ein weiterer Altar für den Segen aufgebaut war, dann weiter die Bachstraße entlang, wo an der Dunkels-Eck der dritte Segen erteilt wurde, den Mühlenweg entlang und die Hauptstraße zurück zur St. Johannes Enthauptungskirche zum Ausgangspunkt, wo der Schlusssegen erteilt wurde. | |
|
April 1933
Damals war noch bis in die 1960er Jahre hinein der Einschulungstermin immer nach den Osterferien. Lehrer Fritz Nußbaum hat vor der Kath. Volksschule in Lohmar in der Kirchstraße bei der Einschulung Ostern 1933 für das 1. und 2. Schuljahr ein Foto zur... Damals war noch bis in die 1960er Jahre hinein der Einschulungstermin immer nach den Osterferien. Lehrer Fritz Nußbaum hat vor der Kath. Volksschule in Lohmar in der Kirchstraße bei der Einschulung Ostern 1933 für das 1. und 2. Schuljahr ein Foto zur Erinnerung machen lassen. Die Volksschule war zunächst ein einzelner roter Backsteinbau. Er stand dort, wo heute die Ausfahrt vom Lidl-Parkplatz auf die Kirchstraße führt. Vorher hielt der Küster, der auch Lehrer war, den Unterricht in seiner Wohnung ab. Da aber die Küsterwohnung für die wachsende Schülerzahl zu klein geworden war, wurde 1856/57 dieses Schulgebäude errichtet. Es enthielt unten zwei Klassenräume und oben zwei Lehrerwohnungen. Der Schulhof war zu die dieser Zeit die unbefestigte Kirchstraße, und hinter dem Schulgebäude waren die Gärten der Lehrer. Um 1900 wurde auch dieses Gebäude zu klein, so dass man westlich daneben 1907/08 ein weiteres Gebäude mit einem dritten Klassenraum und einer dritten Lehrerwohnung errichtete. Diese beiden Gebäude hat man später mit einem Eisentor verbunden. Die vier Kastanienbäume auf dem Schulhof sind im November 1910 gepflanzt worden; man kann davon ausgehen, dass damit gleichzeitig die Lehrergärten zum Schulhof umfunktioniert wurden. | |
|
1. Juni 1925
Der Liederkranz war am Pfingstsonntag 31. Mai und Pfingstmontag, 1. Juni 1925 zu einem Sängerwettstreit nach Pracht an der Sieg eingeladen. Gut vorbereitet starteten die 41 Sänger zunächst mit dem Bus von Birk nach Siegburg. Von dort mit dem Zug nach... Der Liederkranz war am Pfingstsonntag 31. Mai und Pfingstmontag, 1. Juni 1925 zu einem Sängerwettstreit nach Pracht an der Sieg eingeladen. Gut vorbereitet starteten die 41 Sänger zunächst mit dem Bus von Birk nach Siegburg. Von dort mit dem Zug nach Au an der Sieg. Dann ging es weiter zum Empfang und Begrüßung. Im Anschluss wurden in einem Lokal die vorzutragenden Lieder geprobt. Das Wettsingen begann um 14:00 Uhr und endete um 0:00 Uhr nachts. Das Ergebnis für die Birker Sänger: Im Klassensingen den I. Preis, im Ehrensingen, den 1. Preis und im höchsten Ehrensingen den 2. Preis. Die Sänger nahmen voll Stolz die Ehrungen bei der Preisverleihung am Pfingstmontagmorgen entgegen. Nachdem das Ergebnis feststand wurden die Daheimgebliebenen und Vereine über den Erfolg unterrichtet. Kaum zu glauben, dass in der Kürze der Zeit die Vereine, Offiziellen und die Bevölkerung informiert und umfangreiche Vorbereitungen zum Empfang getroffen wurden. Der Schriftführer des Liederkranzes Peter Haas schrieb in seinem Bericht: "Groß war die Freude der Sänger, aber auch berechtigt, da der Verein mit überaus großer Konkurrenz zu kämpfen hatte. Am 1. Juni (Pfingstmontag) morgens 10 Uhr war Preisverleihung. Um 3 Uhr ging es von Au mit dem Zug zur Heimatstation Siegburg. Auf dem Bahnhof wurde der Verein von den Vertretern der Ortsvereine begrüßt und beglückwünscht. Auf dem Bahnhofsvorplatz harrten mehrere festlich geschmückte Wagen, in welchen die Sänger Platz nahmen, und in fröhlicher Fahrt gings der Heimat zu. Überaus festlich war der Empfang an der Gemeindegrenze, wo sämtliche Orts-und Nachbarvereine sowie die ganze Bürgerschaft dem preisgekrönten Verein einen herzlichen Empfang bereiteten. Von hier ging es durch die festlich geschmückten Orte ins Vereinslokal."
| |
|
1962
Der Tod eines MaskottchensEin Drama mit Happy End Im Februar 1962, nach dem Umzug 3. Kompanie von Siegburg-Brückberg in die neue Unterkunft in Lohmar-Heide, übergaben die Unteroffiziere des Bataillons anlässlich eines Umtrunks denen, die nun in Lohmar-Heide wohnten oder dienten, ein Maskottchen in... Im Februar 1962, nach dem Umzug 3. Kompanie von Siegburg-Brückberg in die neue Unterkunft in Lohmar-Heide, übergaben die Unteroffiziere des Bataillons anlässlich eines Umtrunks denen, die nun in Lohmar-Heide wohnten oder dienten, ein Maskottchen in Gestalt einer kleinen männlichen Bergziege mit Namen „Moritz. Die Bataillonsunteroffiziere übergaben das Tier, wohl mit frommen Wünschen, in die Obhut eines Soldaten der Kompanie. | |
Aus der älteren Karnevalsgeschichte wissen wir, dass kleinere Fastnachtsbälle bereits im Jahr 1879 in Lohmar veranstaltet wurden. Der Straßenkarneval kam nach dem zweiten Weltkrieg in Fahrt. Im Protokollbuch vom 4.2.1950 der 1946 gegründeten KG „Ahl... Aus der älteren Karnevalsgeschichte wissen wir, dass kleinere Fastnachtsbälle bereits im Jahr 1879 in Lohmar veranstaltet wurden. Der Straßenkarneval kam nach dem zweiten Weltkrieg in Fahrt. Im Protokollbuch vom 4.2.1950 der 1946 gegründeten KG „Ahl Jecke“ ist zu lesen, dass die Karnevalsgesellschaft mit zwei Wagen durch die Gemeinde fuhr. Der erste Wagen wurde von einem Esel der Gemeindeverwaltung gezogen. Der Esel stand bei Gemeindearbeiter und KG Gründungsmitglied Josef Büscher zu Hause im Stall. Im Jahr 1952 war zum ersten Mal ein Prinzenwagen dabei. Prinz Gerhard I. (Schönenborn) wurde vom Narrenvolk bejubelt. Die Karnevalsgesellschaft „Ahl Jecke“ organisierte die Rosenmontagszüge bis 1961. Dann trat an die Stelle der Ortsring Lohmar (Vorgänger des Vereinskomitees). In der Session 2021 wurde der Rosenmontagszug wegen des Corona-Lockdowns abgesagt. Bereits 1990 musste ein Zug (wegen des Orkans Vivian) abgesagt werden, der dann allerdings am 1. Mai mit großem Erfolg und mehreren zehntausend Zuschauern nachgeholt wurde. 1991 wurden Rosenmontagszüge wegen des Golfkrieges abgesagt.
| |
|
1927
- 1956 Kirche und Burg stehen in Honrath dicht nebeneinander. Der Kirchturm ist das älteste Gebäude (12. Jahrhundert). Am 19.7.1895 wird der Kirchturm durch einen Blitzeinschlag in Brand gesetzt. Die Kirchenglocken aus dem Jahr 1844 werden dabei zerstört.... Kirche und Burg stehen in Honrath dicht nebeneinander. Der Kirchturm ist das älteste Gebäude (12. Jahrhundert). Am 19.7.1895 wird der Kirchturm durch einen Blitzeinschlag in Brand gesetzt. Die Kirchenglocken aus dem Jahr 1844 werden dabei zerstört. Im gleichen Jahr wurden neue Glocken angeschafft. Davon ist heute nur noch die kleinste erhalten geblieben mit der Inschrift "Ich rufe zum Dienste des Herrn, ihr Menschenkinder folget gern". Die anderen Glocken wurden 1917 für Kriegszwecke eingeschmolzen. 10 Jahre später 1927 gab es ein neues Geläut. Auch das wurde dann im Zweiten Welkrieg wieder abgeholt und blieb unauffindbar. 1956 wurden neue Bronzeglocken wie 1927 von der Glockengießerei Rincker in Sinn / Dillkreis gegossen und feierlich von Pfarrer Freiherr von Lupin eingeweiht. | |
Diese Farblithographie – vermutlich um 1895 im Steindruck- oder Zinkdruckverfahren hergestellt – zeigt im oberen Teil den Ort Lohmar, von der Hardt aus gesehen. Da Lithographien keine Fotos, sondern Zeichnungen sind, unterliegt das Arrangement oft... Diese Farblithographie – vermutlich um 1895 im Steindruck- oder Zinkdruckverfahren hergestellt – zeigt im oberen Teil den Ort Lohmar, von der Hardt aus gesehen. Da Lithographien keine Fotos, sondern Zeichnungen sind, unterliegt das Arrangement oft der künstlerischen Freiheit, wodurch Kunstwerk und Wirklichkeit teilweise nicht übereinstimmen. So kann die Alleestraße rechts der Kirche weder die Hauptstraße noch die Kirchstraße sein. Zwei Gebäude sind jedoch eindeutig zu bestimmen: die Kirche und rechts davon mit dem herausragenden Dach der „Gasthof zum Aggerthal“ des Johann Hermanns. Im Vordergrund sind wahrscheinlich die Häuser entlang der Bachstraße zu sehen und im Hintergrund die entlang der Hauptstraße. In dem Medaillon ist die „Restauration zur Linde“ des Peter Josef Knipp – noch ohne Saalanbau – dargestellt. Links davon sieht man einen Teil der Waldesruh. Die Postkarte wurde am 13.7.1898 geschrieben. Der Text lautet: „Die herzlichsten Glück und Segenswünsche zum heutigen Tage nebst den besten Grüßen aus der Ferne sendet Ihnen und H. Gemahl. Anna Ophoven.“ Quer geschrieben steht: „freundlichen Gruß Frau Essor.“ | |
|
30. Juni 2006
Am Tag (30.Juni 2006) als Deutschland im Elfmeterschießen Argentinien im Viertelfinale der Fußballweltmeisterschaft besiegte und auch in Lohmar Fußballfans in Freudentaumel verfielen, bewegte sich ein "dürstender Trauerzug" von der Gaststätte... Am Tag (30.Juni 2006) als Deutschland im Elfmeterschießen Argentinien im Viertelfinale der Fußballweltmeisterschaft besiegte und auch in Lohmar Fußballfans in Freudentaumel verfielen, bewegte sich ein "dürstender Trauerzug" von der Gaststätte Schnitzlers Eck um den Kreisel Kirchstraße herum zurück zur Gaststätte an der Hauptstraße mit der Hausnummer 60. Die "Trauergäste" hatten sich zum Abschiedsfest für ihre Stammkneipe "Schnitzler", eine alte Lohmarer Traditionsgaststätte getroffen. Das Haus war 1908 als Hotel Herrmanns von dem Oberkellner Johann Schnitzler gekauft worden und wurde im 2. Weltkrieg stark zerstört und von Peter Schnitzler, dem Vater des letzten Eigentümers Hans Schnitzler wieder aufgebaut. Bis zum Abriss wurde die Gaststätte zuletzt 16 Jahre von Christa und Raymund Stricker bewirtschaftet. Es folgte im Februar 2008 der Bau der Lohmarer Höfe als Geschäfts- und Dienstleistungskomplex auf einer Bruttogrundfläche von 5650 qm. Die Baukosten beliefen sich auf 12 Mio Euro. Im Dezember 2008/Januar 2009 eröffneten mit Ernsting´s family, KiK, Bäckerei Oebel und Rossmann die ersten Läden in den Höfen. Als erste quasi Schnitzler-Nachfolgegastromomie zog "S(Sion) in den Höfen" mit der GmbH Khamassi als Betreiber ein. Nach mehreren Betreiberwechseln eröffnete zuletzt hier am 10.10.2020 Karikaala, ein indisch-tamilisches Restaurant.
| |
|
1929
Am ersten Sonntag im Oktober findet in Donrath traditionell der Erntezug statt. Es ist die größte Veranstaltung des Erntevereins Donrath. Wegen der Corona Pandemie wurde er für 2020 abgesagt. Der Ernteverein Donrath gründete sich im Jahre 1925. Er... Am ersten Sonntag im Oktober findet in Donrath traditionell der Erntezug statt. Es ist die größte Veranstaltung des Erntevereins Donrath. Wegen der Corona Pandemie wurde er für 2020 abgesagt. Der Ernteverein Donrath gründete sich im Jahre 1925. Er versteht sich selbst seit jeher als Verein zur Förderung und zum Erhalt des heimischen Kulturgutes und der ländlichen Gegend (Schutz, Pflege und substanzerhaltende Weiterentwicklung der historischen Kulturlandschaft) um Donrath und im Stadtgebiet von Lohmar. Die beiden Bilder von 1929, vier Jahre nach Gründung des Vereins, zeigen einen der festlich geschmückten Erntewagen, auf dem die Bäuerinnen und Bauern Platz nahmen, bei der Aufstellung des Erntezuges vor dem Sägewerk Braun und zehn junge Schnitterinnen vor ihrem Erntewagen. Der Höhepunkt des Erntedankfestes bildete der Krönungsball, Samstagabends, mit der offiziellen Einführung des Erntepaares im „Weißen Haus“. Nach dem Krieg erholte sich das Vereinsleben rasch, sodass man für viele Schaulustige wieder einen schönen Erntezug organisieren konnte. Auf dem Bild von 1948 ist links das Haus Siebertz (heute Donrather Straße 26) zu sehen, in dem unter Bürgermeister Peter Orth vom 20.2.1851 bis 15.12.1893 die Verwaltung der Landbürgermeisterei Lohmar war. Auf dem Foto von 1949 sieht man den Grimberger Wagen beim Erntezug am 2.10.1949. Vor dem Vierspänner geht eine, den verlorenen schrecklichen Krieg darstellende, Vogelscheuche. | |
Den früher üblichen Ofen nannte man in Wahlscheid „Venüss“ (offenbar eine Ableitung von dem franz. Wort „Fournaise“). Bei dem Venüss handelte es sich um einen ovalen, gußeisernen Ofen mit Vertiefungen für die Kochkessel. Der auf dem Bild erkennbare... Den früher üblichen Ofen nannte man in Wahlscheid „Venüss“ (offenbar eine Ableitung von dem franz. Wort „Fournaise“). Bei dem Venüss handelte es sich um einen ovalen, gußeisernen Ofen mit Vertiefungen für die Kochkessel. Der auf dem Bild erkennbare kantige Küchenherd löste den Venüss ab. Die älteren Wahlscheider kennen ihn noch als blitzblanken Herd. Die Hausfrau scheuerte die Herdplatte mit Schmirgelpapier und Asche aus dem Ofen. Auffallend waren die seitlichen hellen Keramikteile. Wenn der Wind nicht richtig stand oder die „Fooch“ (Hebel am Ausgang zur seitlichen „Ovenpief“ (Ofenrohr)) nicht richtig eingestellt war, „schwalekte“ (qualmte) der Ofen. Das „Fuhrwerken“ mit dem „Stöchihsen“ (Schüreisen) brachte meist Abhilfe. Rechts auf der Herdplatte stand das „Wasserschiff’. Unter dem Ofen befand sich der „Köllekasten“ (Kohlenschoß), in dem schon mal der „Stäuver“ (Handfeger) lag. Die Ringe bzw. den Deckel über der Feuerung nahm man mit dem „Heerdhöch“ (Ringeheber) bzw. dem „Deckelshaal“ ab. Staubig ging es zu, wenn das „Äscheschöß“ geleert werden mußte. Neben dem Ofen stand meist eine hölzerne Sitzbank. Hier saß Opa, der sich mit einer „Fimp“ Feuer aus dem Ofen für seine lange Pfeife holte. Ein „Füürspönsdöösjen“ kannte er nicht; mit einem Streichholz hätte er das untere Ende der Pfeife nicht erreicht. Später „stôchten“ die Wahlscheider, als es ihnen finanziell besser ging, mit Briketts. Damit eine kleine Glut über Nacht erhalten blieb und man morgens nicht in einer eiskalten Küche das Tagewerk zu beginnen brauchte, legte man über Nacht ein in nasses Zeitungspapier eingewickeltes Brikett in das Feuer. Für den Transport eines glühenden Briketts verwandte man die „Klooch“ (Feuerzange). | |
|
1964
Zeppelin über Kirchbach; eine Attraktion, die Autofahrer zu einem Halt veranlaßte. Rechts vor dem Esso-Schild ist der über den Eisenbahndamm führende Feldweg, den die Mackenbacher Bauern nutzten, um zu ihren Wiesen an der Agger zu gelangen,... Zeppelin über Kirchbach; eine Attraktion, die Autofahrer zu einem Halt veranlaßte. Rechts vor dem Esso-Schild ist der über den Eisenbahndamm führende Feldweg, den die Mackenbacher Bauern nutzten, um zu ihren Wiesen an der Agger zu gelangen, erkennbar. Der Kirchbach, der durch den sogenannten „Kirchsiefen“ und den gleichnamigen Weiler läuft, entspringt unterhalb von Weeg neben der Straße in Richtung Münchhof. | |
|
8. November 1950
8. November 1950. Die Lohmarer Volksschule blieb geschlossen. Lohmarer Bürger nahmen einen Tag Urlaub: Die Bevölkerung von Lohmar feierte die Diamantene Hochzeit (60 Jahre) von Katharina und Wilhelm Kurtsiefer aus dem Mühlenweg in Lohmar. Das ganze... 8. November 1950. Die Lohmarer Volksschule blieb geschlossen. Lohmarer Bürger nahmen einen Tag Urlaub: Die Bevölkerung von Lohmar feierte die Diamantene Hochzeit (60 Jahre) von Katharina und Wilhelm Kurtsiefer aus dem Mühlenweg in Lohmar. Das ganze Dorf begleitete das Paar auf dem Weg zur Kirche. Vorne spielte der Musikzug Höndgesberg aus Troisdorf. Für damalige Verhältnisse war es außergewöhnlich, dass unter der Bevölkerung eine Diamantene Hochzeit gefeiert wurde. Durch Krankheiten und eine hohe Sterberate wurde die Bevölkerung nicht so alt, wie zu heutigen Zeiten. Auch raffte der Zweite Weltkrieg Soldaten und die zivile Bevölkerung dahin. Die Menschen in Lohmar hatten Nachholbedarf zum Feiern. Der Zweite Weltkrieg war gerade mal fünf Jahre zu Ende und es herrschte noch Not und Armut. Katharina Bohnrath wurde am 3. Juni 1866 geboren, Wilhelm Kurtsiefer am 16. August 1868 in Lohmar. Bei der Heirat in Lohmar waren beide 22 bzw. 24 Jahre alt. Aus der Ehe gingen 12 Kinder hervor, von denen drei Kinder bereits im ersten Lebensjahr starben. Sie wohnten im Haus Mühlenweg Nr. 40. Das Haus war bereits von seinen Eltern aus einer Scheune erbaut worden. Noch Jahre danach wurde in der Bevölkerung von Lohmar über dieses große Ereignis gesprochen. Traurig war nur, dass drei Wochen nach dieser Feier Wilhelm Kurtsiefer am 1. Dezember 1950 im Alter von 88 Jahren verstarb. Seine Frau überlebte ihn noch vier Jahre und starb am 2. August 1954.
| |
| |
|
18. Februar 1947
| |
|
1946
| |
|
1939
- 1940
| |
|
Oktober 1930
- 1939
| |
|
1925
- 1925
| |
|
17. März 1930
Fast 200 Jahre lang hatte man sich in der Halberger Kapelle behelfen müssen. Weil keine Sakristei dabei war, mussten sich Priester und Messdiener hinter dem Altar umziehen. Es war kein Platz für einen vernünftigen Kleiderschrank vorhanden, man wusste... Fast 200 Jahre lang hatte man sich in der Halberger Kapelle behelfen müssen. Weil keine Sakristei dabei war, mussten sich Priester und Messdiener hinter dem Altar umziehen. Es war kein Platz für einen vernünftigen Kleiderschrank vorhanden, man wusste nicht mit den Paramenten wohin und hatte auch keinen Platz für sonstige Utensilien. Und zudem war der Fußboden in einem schlechten Zustand und es war viel zu wenig Platz für die vielen Kapellenbesucher. Daher wurde am 17.3.1930 der Grundstein gelegt für eine Erweiterung und Renovierung der Kapelle. Auf dem Foto ist der Rohbau mit Dachstuhl und Verschalung bereits fertig. Die Dachdecker sind dabei, die Verschieferung anzubringen. Vor der Kapelle stehen von links nach rechts: Professor Carl Maria Prill vom Hollenberg (Architekt und Bauleiter), Johann Mirbach (2. Vorsitzender des Kapellenvereins), Zimmermann Josef Burger aus Donrath, ein Zimmermannsgehilfe und Dachdecker Krahforst. | |
Es kam immer wieder vor, dass nach einem Unwetter der Dorfbach (Auelsbach) über die Ufer trat und die Bachstraße überschwemmte. Dabei lief das Wasser auch in die etwas tiefer liegende Gartenstraße; so auch am 6.8.1931. Für die Kinder war das in der... Es kam immer wieder vor, dass nach einem Unwetter der Dorfbach (Auelsbach) über die Ufer trat und die Bachstraße überschwemmte. Dabei lief das Wasser auch in die etwas tiefer liegende Gartenstraße; so auch am 6.8.1931. Für die Kinder war das in der Sommerzeit natürlich ein Gaudi. Das Foto wurde aus der Gartenstraße in Richtung Bachstraße aufgenommen. Rechts ist das 1891 gebaute Fachwerkhaus Hagen, das 1932 abgebrannt ist. Aus dem Fenster schaut Margarethe Hagen, die Großmutter des im heutigen Haus Hagen in der Gartenstraße 8 wohnenden Hubert Hagen. Der Vierte von rechts, im weißen Hemd und mit Mütze, ist Josef Steimel vom Gemischtwarengeschäft in der Gartenstraße 6. Links durch die Bäume erkennt man das Haus Weingarten. Daneben in dem Fachwerkhaus hatte Lorenz Weingarten seine Schreinerei eingerichtet. Später hatte er eine Schreinerei an der Hauptstraße, die dann Heinrich Lang später von ihm übernahm. Heute befi ndet sich an dieser Stelle der Parkplatz der VR-Bank. | |
|
1934
Im August 1934 wurde in Lohmar am Ziegelfeld an der Agger ein großes Zeltlager der „Hitlerjugend“ durchgeführt. Hier konnten Jugendliche in einer Zeltstadt mit über hundert weißen Rundzelten den Aufenthalt in der freien Natur mit Lagerfeuerromantik,... Im August 1934 wurde in Lohmar am Ziegelfeld an der Agger ein großes Zeltlager der „Hitlerjugend“ durchgeführt. Hier konnten Jugendliche in einer Zeltstadt mit über hundert weißen Rundzelten den Aufenthalt in der freien Natur mit Lagerfeuerromantik, Geländespielen, Survivaltechniken und Ähnliches erleben – doch leider mit dem damals üblichen vormilitärischen Drill des „Dritten Reiches“ der Nationalsozialisten. | |
1897 war die Gründung des Junggesellenvereins „Gemütlichkeit“ Lohmar. Im Juli dieses Jahres setzten sich die damaligen Jungmänner Balthasar Dunkel, Wilhelm Röhrig, Josef Brungs, Josef Lehr, Peter Hofstatt und Josef Kiel mit noch anderen Lohmarer... 1897 war die Gründung des Junggesellenvereins „Gemütlichkeit“ Lohmar. Im Juli dieses Jahres setzten sich die damaligen Jungmänner Balthasar Dunkel, Wilhelm Röhrig, Josef Brungs, Josef Lehr, Peter Hofstatt und Josef Kiel mit noch anderen Lohmarer Jungs zusammen, vielleicht auch in Anwesenheit des damaligen Pfarrers Düsterwald, und gründeten den o.g. Verein. Möglich wäre aber auch, dass es sich um eine Wiedergründung handelte, da laut einer Urkunde aus dem Jahr 1833 Lohmarer Junggesellen, mit Gewehren bewaffnet, die Kirmesprozession begleiteten Der Junggesellenverein, in den man ab 18 Jahre eintreten konnte, war der wichtigste brauchtumtreibende Verein Lohmars. Das fing Fastnachtdienstag mit dem „Äezebär“ an, dann das Maibrauchtum mit Ersteigern, Maibaumsetzen, Maipaar usw., Hielichholen bei jeder Hochzeit, Stiftungsfest, Pfingsteiersingen und endete mit dem Kirmeskerlbrauchtum Ende August. Leider hat sich der Verein 1962/63 aufgelöst, womit auch das meiste Brauchtum starb. Auf dem Stiftungsfest, das in der Regel im Juli stattfand, wurden befreundete Nachbarvereine eingeladen, mit denen man dann bei Musik und Fendelschwenken durch das Dorf zog. Acht Fendelschwenker sieht man auf dem Foto aus der Mitte der 1930er Jahre, das in Richtung Siegburg auf der Hauptstraße etwas hinter der Einmündung Gartenstraße aufgenommen wurde. Links ist das Haus Hauptstraße 105 ehemals Ramme, und das Fachwerkhaus daneben ist das sogenannte „Jüddehüsje“, in dem scheinbar irgendwann Juden wohnten, zuletzt aber von Johann Meiger mit seiner Ehefrau Trina (Katharina) bewohnt wurde. Rechts ist der Gasthof des Hubert Achnitz. Die Tradition dieser Gaststätte geht auf die 1860er Jahre zurück. Zu dieser Zeit wohnte dort Franz Karl Wacker mit seiner Familie, er war Gastwirt und „Chausseegeldempfänger“. 1878 baute Johann Krey dort ein Massivhaus, in dem der Schmiedemeister Peter Wimar Schneider das Restaurant „Jägersruh“ mit Kegelbahn betrieb. 1889 beantragte er die Konzession dafür (W. Rexhaus, Zur Geschichte der Lohmarer Hauptstraße, Lohmar 2005, S. 39). Nach dem Krieg ging das Haus in den Besitz der Familie Heppberger, die in den 1960er Jahren die Gaststätte an Karl Steinbach verpachtete. 1974 hatte dort Pino (Josef) Constantini dort den ersten Lohmarer Eissalon eingerichtet. Im Zuge des Ausbaus der Kreuzung Hauptstraße/Bachstraße/Auelsweg wurde das Haus 1998 abgerissen. | |
Am 11.5.1942 wurden zwei Kirchenglocken kriegsbedingt zur Verwertung abtransportiert, darunter auch die wertvolle Marienglocke von 1888. Das kleine Mädchen auf dem Foto, Margarete Oberhäuser möchte die große Glocke am liebsten festhalten. Die... Am 11.5.1942 wurden zwei Kirchenglocken kriegsbedingt zur Verwertung abtransportiert, darunter auch die wertvolle Marienglocke von 1888. Das kleine Mädchen auf dem Foto, Margarete Oberhäuser möchte die große Glocke am liebsten festhalten. Die Marienglocke kehrte am 27.9.1947 unversehrt von einem Glockenfriedhof in Hamburg zurück. Im Hintergrund sind die schönen Fachwerkhäuser Orth, Müller und Merten zu erkennen. | |
|
1947
Das „Mailehen“, die Versteigerung heiratsfähiger Mädchen des Ortes, fand in der Regel am Vorabend zum 1. Mai statt. Die Sitte ist uralt und geht darauf zurück, dass die Frauen einmal als Eigentum der Dorfgemeinschaft angesehen wurden, die über ihren... Das „Mailehen“, die Versteigerung heiratsfähiger Mädchen des Ortes, fand in der Regel am Vorabend zum 1. Mai statt. Die Sitte ist uralt und geht darauf zurück, dass die Frauen einmal als Eigentum der Dorfgemeinschaft angesehen wurden, die über ihren Verbleib zu bestimmen hatte. Der Vorsitzende des „Mailehen“, das auch „Maispiel“ genannt wurde, hat eine Liste der infrage kommenden Mädchen (die auch damit einverstanden waren) des Ortes und nennt sie dem Versteigerer („Usklöpper“), der redegewand mit viel Ulk und Humor die Mädchen den Junggesellen anpreist. Das Mädchen, mit dem höchsten Versteigerungspreis, wird Maikönigin und der Ersteigerer Maikönig. Die Mädchen, für die niemand etwas bietet, kommen in das sogenannten „Rötzchen“ und ein mitleidiger Junggeselle nimmt schließlich unter großem Gaudi der Anwesenden für einen ganz geringen Preis den ganzen „Schmiß“ und wird damit „Rötzjesvatter“. Die Ersteigerungsgelder werden zu einem Zehntel kassiert. Die Ersteigerer haben im ganzen Monat Mai ihrem Mailehen gegenüber, das unter ihrem Schutz steht, besondere Verpflichtungen. Für Lohmar sind darüber noch Statuten von 1878 bekannt. | |
Auf diesem Foto wurde am Sonntag nach dem 15. Mai (Fest des Hl. Isidors) im Jahre 1948 das Festhochamt der Halberger Kirmes in der Kapelle zelebriert. Man sieht auf dem Bild fünf Geistliche am Altar (ganz links steht Kaplan Rudolf Müller, am Altar... Auf diesem Foto wurde am Sonntag nach dem 15. Mai (Fest des Hl. Isidors) im Jahre 1948 das Festhochamt der Halberger Kirmes in der Kapelle zelebriert. Man sieht auf dem Bild fünf Geistliche am Altar (ganz links steht Kaplan Rudolf Müller, am Altar Pfarrer Wilhelm Offergeld, Prof. Dr. Josef Klein aus Ungertz, Pater Spilker vom Michaelsberg in Siegburg, Pater vom Hollenberg), mehr als beim höchsten Fest in der Pfarrkirche. Das hat folgenden Grund: In Halberg war es ein ungeschriebenes Gesetz und seit alters her Tradition, dass der oder die Geistlichen nach der Kirmesprozession in den Thelenhof und etwa ab 1933 in den Pastoratshof zu einem Mittagessen eingeladen wurden. Und da so kurze Zeit nach dem Krieg der Hunger noch sehr verbreitet war in der Bevölkerung – auch bei den Geistlichen –, ließen diese sich ein gutes und reichhaltiges Mittagessen nicht entgehen. Am Altar wurden gerade von zwei Geistlichen Weihrauchkörner ins Weihrauchfass nachgefüllt. Die Messdiener, wie auch die Kommunionkinder von 1948, begleiteten nach dem Festhochamt die Prozession. | |
|
1951
Das Plakat auf diesem Foto wirbt für die Lohmarer Kirmes am Sonntag, dem 2. bis Dienstag, dem 4.9.1951. Wahrscheinlich hing dieses Plakat im Schaufenster der Drogerie Starke, später Bekleidungsgeschäft Trapp zwischen der Post und der Gaststätte... Das Plakat auf diesem Foto wirbt für die Lohmarer Kirmes am Sonntag, dem 2. bis Dienstag, dem 4.9.1951. Wahrscheinlich hing dieses Plakat im Schaufenster der Drogerie Starke, später Bekleidungsgeschäft Trapp zwischen der Post und der Gaststätte Schnitzler (heute Lohmarer Höfe). Rudolph Starke war Drogist und Fotograf und hatte das Plakat mit Motiven von der Lohmarer Kirmes, die um diese Zeit noch auf der „Schultes Wiese“ gegenüber der Gaststätte Schnitzler stattfand, eingerahmt. Erwin Henseler, Anstreicher und Kunstmaler, konnte sich noch erinnern, dass er den Spruch unter dem Plakat seinerzeit für Rudolph Starke geschrieben hatte. Am 29. August gedenkt die Kirche der Enthauptung Johannes des Täufers, das Patrozinium der Lohmarer Pfarrkirche. Daher war immer am Sonntag nach dem 29. August Lohmarer Kirmes. Und da die Kirmes in Lohmar stets in die Erntezeit der Pflaumen/Zwetschgen fällt, ist es, so weit man sich zurückerinnern kann, in Lohmar Tradition, für die Kirmestage Pflaumenkuchen („Prommetaat“) zu backen. Die Lohmarer Kirmes war früher sehr beliebt, so dass viele Gäste aus den umliegenden Ortschaften die Kirmes besuchten. Auch war es üblich, dass die Lohmarer Familien ihre Verwandschaft zur Kirmes einluden, denen dann zum Kaffee frisch gebackene „Prommetaat“ serviert wurde. Im Vergleich zu heute war damals das Angebot der Wirte sehr groß und obwohl der Ort Lohmar weniger als die Hälfte der Einwohner hatte wie heute (im Vergleich zum Jahre 2009), waren die Säle, Zelte und Gaststätten immer überfüllt. Bei Wilhelm Schwamborn im Jägerhof war an allen Tagen Tanz im Festzelt. Sonntag ab 17.00 Uhr; Montag um 9.00 Uhr der Kirchgang des Junggesellenvereins und anschließend Frühball und ab 18.00 Uhr wieder Tanz; Dienstag ab 19.00 Schlussball. Ferner war an allen Tagen dort Preiskegeln. Bei Margarethe („Eta“) Bendermacher im Margarethenhof (heute Edeka Markt, Hauptstraße 39) wurde in den dortigen schattigen Gartenanlagen Unterhaltungsmusik geboten. Auch H. Laurentius im Hubertushof (Ecke Hauptstraße/ Auelsweg – heute Parkplatz) hatte an allen Kirmestagen Stimmung und Unterhaltungsmusik geboten. Im „Hotel zur Linde“ bei Peter Olligschläger war im großen Saal an allen Tagen großer Festball: Sonntag ab 17.00 Uhr, Montag ab 10.00 Uhr traditioneller Frühball des Männergesangvereins und ab 18.00 Uhr wieder Tanz, Dienstag war ab 19.00 Uhr Schlussball des Turnvereins 08 e.V. Bei Karl Weyer im Gasthaus „Zur alten Fähre“ war an allen Kirmestagen Unterhaltungsmusik und sonntags und montags "Großes Preiskegeln". Auch im Festzelt der Gaststätte Schnitzler war an allen Kirmestagen Tanz. Da Peter Schnitzler von Beruf Konditor war, konnte man bei ihm ganz hervorragend zu Kaffee und Kuchen („Prommetaat“ bzw. "Quetschetaat" = Pflaumen-/Zwetschgenkuchen) einkehren. Seine Gasträume waren immer „brechend voll“. Noch bis Anfang der 1950er Jahre war der Kirmesplatz auf der „Schultes Wiese“ (Hauptstraße 71), also direkt gegenüber der Gaststätte Schnitzler (heute Lohmarer Höfe). Bis Ende des Krieges am Balkongeländer und nach dem Krieg an der Fassade der neu gebauten Gaststätte saß an den Kirmestagen auf einem Stuhl eine lebensgroße Puppe, der Kirmeskerl oder Paijass. Die Kirmes begann – noch bis Ende der 1960er Jahre – immer sonntags nach der Sakramentsprozession, so gegen 10.30 Uhr. Für Montag und Dienstag hatten sich die meisten Berufstätigen Urlaub genommen. Am Montag war im Saal des „Hotel zur Linde“ und in den Zelten der sehr beliebte Frühball. Die Kirmes endete am Dienstag mit dem Schlussball. Ihm voraus ging am Nachmittag mit viel Klamauk die Verurteilung und Hinrichtung des „Paijass“, dem alle Vergehen und Schlechtigkeiten, die in dem jeweiligen Jahr in Lohmar vorgefallenen waren, angelastet wurden. Die Hinrichtung geschah dann durch Verbrennen oder Ertränken in der Agger. | |
In der Zeit von 1926-1930 wurden Regulierungsarbeiten an der Agger ausgeführt. Die Lohmarer Firmen Jakob Dunkel und Alois Weyer, damalige Kleinstunternehmer, haben die Arbeiten durchgeführt. Die Regulierungsarbeiten selbst erfolgten ausschließlich in... In der Zeit von 1926-1930 wurden Regulierungsarbeiten an der Agger ausgeführt. Die Lohmarer Firmen Jakob Dunkel und Alois Weyer, damalige Kleinstunternehmer, haben die Arbeiten durchgeführt. Die Regulierungsarbeiten selbst erfolgten ausschließlich in Handarbeit, wobei vielleicht 50 bis 100 m Feldbahngleise und einige Kipploren dem Transport des Kies- und Bodenmaterials dienten, die mit Hand geschoben wurden. Parallel hierzu wurde der Aggerdeich im Bereich der Gemeindegrenze Troisdorf/Lohmar, am rechten Ufer der Agger von der Straßenbrücke Siegburg-Troisdorf bis zum heutigen Aggerstadion, und weiter als Wanderweg nach Lohmar ausgeführt. Der Damm läuft in Nord-Südrichtung und wird ab dem Bereich Wahner Heide durch den am Steilhang des Lohmarbergs und des Güldenbergs liegenden Fuß- und Radweg Troisdorf-Lohmar – „Am alten Wasser“ – fortgeführt. Dieser Wanderweg wurde zum Teil durch Erwerbslose, die sich dadurch ihre Wohlfahrtsunterstützung etwas aufbessern konnten, angelegt. Das Bild könnte diese Ausbauarbeiten des Aggerdamms zeigen. Eine genaue Lokalisierung ist durch den gleichmäßigen Fichtenbestand im Hintergrund kaum möglich. | |
Am Wochenende 17. und 18. Juni 1933 feierte der Liederkranz Birk sein 25-jähriges Bestehen. Der nachfolgende Text ist weitgehend dem Festbuch von 1933 entnommen. Am Wochenende 17. und 18. Juni 1933 feierte der Liederkranz Birk sein 25-jähriges Bestehen. Der nachfolgende Text ist weitgehend dem Festbuch von 1933 entnommen. Foto: Festzug durch das festlich geschmückte Birk. Es beteiligten sich 20 Vereine in zwei Gruppen, beginnend mit dem Musikkorps, dann die Liederkranz-Ehrendamen, die Fahne des Jubelvereins und die Sänger (gekleidet im Frack, Zylinder und weißen Handschuhen). Es folgten: MGV „Frohsinn“ Lohmar, MGV „Sängerkreis“ Geber. Nach dem Festzug fand in den Sälen Wiel und Oligschläger ein Festkonzert mit zwölf Chören statt. | |
Nach dem Krieg war die Autobahn wie leergefegt und konnte für Spaziergänge benutzt werden. Wie man auf dem Foto von Pfingsten 1946 sieht, waren an der Autobahn noch keine Leitplanken angebracht und es fuhren statt benzinbetriebener Wagen Kinderwagen... Nach dem Krieg war die Autobahn wie leergefegt und konnte für Spaziergänge benutzt werden. Wie man auf dem Foto von Pfingsten 1946 sieht, waren an der Autobahn noch keine Leitplanken angebracht und es fuhren statt benzinbetriebener Wagen Kinderwagen über die Autobahn; der hier seinen Wagen schiebt ist Gerd Streichardt, viele Jahre 1. Vorsitzender des HGV Lohmar. | |
Die Kirmesprozession 1946 war soeben von der Pfarrkirche in Lohmar losgegangen. Nach dem Krieg war die Volksfrömmigkeit besonders groß, daher auch die rege Teilnahme. Vorne links im Foto sieht man von links nach rechts: 1. Heinz Klein, 2. Hans... Die Kirmesprozession 1946 war soeben von der Pfarrkirche in Lohmar losgegangen. Nach dem Krieg war die Volksfrömmigkeit besonders groß, daher auch die rege Teilnahme. Vorne links im Foto sieht man von links nach rechts: 1. Heinz Klein, 2. Hans Faßbender (mit krausem Haar), 3. Erwin Henseler, 4. Richard Höndgesberg, 5. Günter Höfgen und 6. Werner Schneider. Daran reihen sich die Kommunionkinder und „Engelchen“ in ihren weißen Kleidern an, die von der Lehrerin Fräulein Wingensiefen beaufsichtigt werden (Sie kennen sicherlich den Witz, wo eine feine Dame der anderen sagte: „Schau mal, die niedlichen kleinen Mädchen in ihren weißen Kleidchen.“ Da rief ihr eines der Mädchen zu, die das Gespräch gehört hatte: „Mir senn doch Engelche, Du Aschloch“). Ihnen folgen im Hintergrund die Männer. Der Kirmesplatz war um diese Zeit die „Schultes Wiese“ an der Hauptstraße gegenüber Bäckerei Liesenfeld. Das Kirmestreiben begann sonntags nach der Prozession und endete dienstagsabends mit der Verurteilung und Hinrichtung des Kirmeskerls (Paijas). | |
Hier ist der Junggesellenverein an seinem 50. Stiftungsfest 1947 auf dem Rückweg vom Festhochamt in der Kirche zum Vereinslokal „Hotel zur Linde“, wo Fendelschwenken und Tanz stattfanden, zu sehen. Hier ist der Junggesellenverein an seinem 50. Stiftungsfest 1947 auf dem Rückweg vom Festhochamt in der Kirche zum Vereinslokal „Hotel zur Linde“, wo Fendelschwenken und Tanz stattfanden, zu sehen. | |
Die Freiwillige Feuerwehr von Lohmar wurde am 1.10.1923 unter maßgeblicher Beteiligung von Heinrich Flamm gegründet. Am 1. September 1924 war sie mit 34 Mitgliedern angemeldet worden. Daher konnte 1948 das 25. Stiftungsfest – noch mit... Die Freiwillige Feuerwehr von Lohmar wurde am 1.10.1923 unter maßgeblicher Beteiligung von Heinrich Flamm gegründet. Am 1. September 1924 war sie mit 34 Mitgliedern angemeldet worden. Daher konnte 1948 das 25. Stiftungsfest – noch mit selbstgebranntem Schnaps und ohne finanzielle Mittel – gefeiert werden. | |
Adele Stoecker – Mitglied in der Damen-Karnevalsgesellschaft 2. Plöck – ist 1953 achtzig Jahre alt geworden. Auf dem Foto feiert sie zu Hause mit ihren Vereinskolleginnen diesen Festtag. Es sind jeweils von links nach rechts zu sehen, stehend: 1.... Adele Stoecker – Mitglied in der Damen-Karnevalsgesellschaft 2. Plöck – ist 1953 achtzig Jahre alt geworden. Auf dem Foto feiert sie zu Hause mit ihren Vereinskolleginnen diesen Festtag. Es sind jeweils von links nach rechts zu sehen, stehend: 1. Frau Roland (Ziegelfeld), 2. Frau Ennenbach, Mühlenweg, 3. unbekannt, 4. Katharina Frey, 5. Frau Meurer geb. Hoffmann, 6. unbekannt, 7. Käthe Eschbach und 8. Leni Kümmler; sitzend: 1. Frau Pütz, 2. Adele Stoecker und 3. Gertrud Kirschbaum. | |
|
1929
Über den uralten heimatlichen Brauch, dem Festtag des heiligen St. Martins, ist einiges festgehalten worden. Die Rede ist vom 11. November dem Martinszug der Schulklassen und die Aufführung der Mantelteilung vor den Toren von Amiens (heute am... Über den uralten heimatlichen Brauch, dem Festtag des heiligen St. Martins, ist einiges festgehalten worden. Die Rede ist vom 11. November dem Martinszug der Schulklassen und die Aufführung der Mantelteilung vor den Toren von Amiens (heute am Martinsfeuer), wo der Soldat Martin hoch zu Ross auf einen frierenden Bettler trifft, mit dem Schwert seinen weiten roten Mantel teilt, und die Hälfte seines Reitermantels dem Bettler übergibt. Alle diese Martinsveranstaltungen wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Lohmar, die einige Jahre vorher, im Jahre 1923 als Freiwillige Feuerwehr Lohmar wiedergegründet wurde, zusammen mit der Lehrerschaft geplant und durchgeführt. Der 1. Martinszug in Lohmar ging am 10.11.1926. Auf dem Bild in Lohmar auf der Schultes Wiese (Hauptstraße 71) wurde die Szene am Martinsfeuer (auch schon mal auf der Schneiders Wiese -heutiges Rathaus -, je nach Aufstellung und Beginn des Zuges an der Brücke oder an der Schule) nachgespielt. Im Jahr 1929 waren die Darsteller Josef Terhart als Sankt Martin und Heinrich Schwellenbach als Bettler, der schauspielerisch, dichterisch und gesanglich begabt war und dies schon oft bei karnevalistischen Vorträgen bewiesen hatte. Der Zug formierte sich im vorgenannten Jahr an der Aggerbrücke und marschierte unter der Begleitung der Schullehrerschaft mit Herrn Richard Müller, Karl Schmidt, Wilhelm Stockberg und Gertrud Wingensiefen zusammen mit den Schulkindern und ihren bunten Fackeln, klassenweise aufgestellt los. Den symbolischen Schimmel konnten die Lohmarer Landwirte in diesem Jahr nicht aufbieten, da es im ganzen Pferdebestand keinen Schimmel gab. Nach dem Martinszug fand dann unter reger Beteiligung der „Großen“ die Verlosung der Martinsgänse, entweder bei Johann Schnitzler oder im Gasthof „Zur Linde" bei Wilhelm Heere, statt. Bernhard Walterscheid-Müller weiß von folgender Begebenheit zu berichten: „Der Hauptlehrer Richard Müller hatte auch eine Gans gewonnen, die ihm am anderen Morgen entlief. Die Schüler der Oberstufe, Helmut Schug und Josef Frembgen erhielten den Befehl zum Einfangen der Gans. Das gelang den beiden schließlich nach 1½ km Weg an der Jabach. Solange hatten sie die Gans geschickt vor sich her getrieben. Nach der erfolgreichen Heimkehr war die Schule gerade aus, wie uns Helmut Schug erzählte.“ | |
Pfingsten 1948. Großes Zeltlager der Katholischen Jugend Lohmar an der Aggertalsperre. Die Lohmarer waren nicht die Einzigen, die in diesem Gebiet die Feiertage zum Zelten nutzten und am zweiten Pfingsttag nachmittags mit der Aggertalbahn nach Hause... Pfingsten 1948. Großes Zeltlager der Katholischen Jugend Lohmar an der Aggertalsperre. Die Lohmarer waren nicht die Einzigen, die in diesem Gebiet die Feiertage zum Zelten nutzten und am zweiten Pfingsttag nachmittags mit der Aggertalbahn nach Hause fuhren. Die Bahnlinie Gummersbach–Köln war nach dem Krieg noch nicht befahrbar, so dass das Ziel Köln nur über Aggertal und Troisdorf zu erreichen war. Dies führte zu einem total überfüllten Zug. Erstaunlich, dass bei der Fahrt außer einigen Tornistern niemand vom Dach gefallen ist. | |
Damit ist die bisher zu Lohmar gehörende Filiale selbstständig; zur katholischen Pfarre Birk gehören fortan Breidt, Inger (zum größten Teil) und die Hälfte der Gemeinde Halberg. Damit ist die bisher zu Lohmar gehörende Filiale selbstständig; zur katholischen Pfarre Birk gehören fortan Breidt, Inger (zum größten Teil) und die Hälfte der Gemeinde Halberg. |